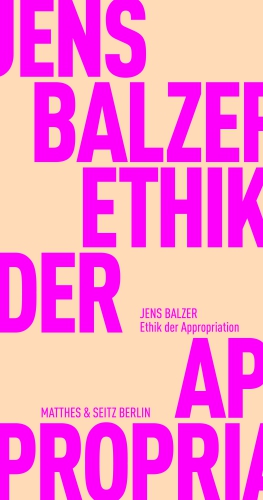Auf Spatzen geschossen
Vorweihnachten ist die beschissenste Zeit überhaupt, gekrönt mit einem total überschätzten Fest, dass einem sowieso schon vier Wochen vorher aus allen Ohren kommt. Ich kann nicht mehr mit dem Rad durch die Innenstadt fahren, weil an jeder zweiten Ecke eine Schunkelgruppe steht und sich den Hals mit Glühwein zukleistert. Und die Ecken dazwischen sind gefüllt von Schifferklavier-, Geigen- und Panflötengangs, die ihr Gedudel leider nicht nur auf CD anbieten.
Auch die Leute sind plötzlich komisch, und ich meine damit nicht nur die Schunkelgruppen. Ständig wird etwas missverstanden, umgedeutet und übel genommen. Die Nerven liegen blank und die Haut scheint nicht dicker, als das Alupapier um den Schokoladenweihnachtsmann.
Apropos Süßkram, das einzig Schöne war bislang immer, das Marzipanbrot aus dem Supermarkt, das mit Nougatkern. Das gab es immer pünktlich ab Oktober und an Heiligabend konnte ich es dann nicht mehr sehen. Das gibt es jetzt aber auch nicht mehr. Gestern habe ich gefragt, nein, zuerst habe ich mich gewundert. Da stehen 5 einsame Weihnachtsmänner in einem leeren Regal, wo sich doch auf den Gängen die Waren stapeln, dass sich wahrscheinlich schon in der Konzernzentrale darüber Gedanken gemacht wird, die Spurbreite der Einkaufswagen zu verschlanken, damit man da überhaupt noch durchkommt. Und dann gibt es da so eine Platzverschwendung. Das wird bestimmt gleich beräumt, denke ich und sehe schon jemanden eilig einherschreiten.
Hallo, wieso das Regal denn leer sei, frage ich, und erhalte zur Antwort, die Weihnachtsartikel seien alle restlos ausverkauft. Kommen keine mehr rein, hake ich nach. Nein, das lohnt sich nicht mehr, so kurz vorm Fest. Achso, na dann.
Essen ist kein Spaß, vor allem wenn man Hunger hat und noch nicht an der Reihe ist. Ich stehe regelmäßig vor der
Contine, der kleinen Mensa am Conticampus für einen großen Haufen von Juristen, BWLern, Germanisten, Anglisten und vielen anderen Studenten, die sich hier herumtreiben. Schon die Fachrichtungen alle aufzuzählen macht mir keinen Spaß, weil es zu lange dauert.
Die Contine ist eine so kleine Mensa, dass dort auf jedem Tisch ein Klappkärtchen steht, auf dem steht, dass das Benutzen eines Laptops zwischen 12 bis 15 Uhr verboten ist, damit die Neuankömmlinge, möglichst noch während der Vorbesitzer den letzten Bissens herunterhastet, auf dem vorgewärmten Platz Platz nehmen können. Wenn die Mensa es verbieten könnte, wäre selbst das Sprechen während dem Essen nicht erlaubt, um Zeit zu sparen. Hier wird das Besteck wie ein Staffelstab gereicht.
Es gibt in der Contine insgesamt 6 Schalter, an denen man sich mit Essen versorgen kann, davon sind zwei vegetarisch und der Rest ist Fleisch mit Soße oder Pommes mit C-Wurst und Soße. Regelmäßig stelle ich mich hinten an, um dann mit Erschrecken festzustellen, dass ein Pulk von angeblich teilnahmslosen Studenten, die nur mal kurz vorbei wollen, um ihre Karte noch aufzuladen oder auf die Speisekarte zu gucken, an mir vorbeirennen und sich am nächstbesten Schalter anstellen. Das geht deshalb so gut, weil das keine Sau nicht interessiert. Außer mir armen Sau, die sich darüber echauffiert.
Neulich bin ich auch zuerst gucken gegangen. Ich sah das eigentliche Problem der Schlangen. Sie zerteilt sich in zwei Hauptschlangen rechts und links vom Besteckregal und zerfasert dann zu einem eher losen Pulk in kleinere Einzelschlangen. Das ist wie eine Sanduhr, die rückwärts läuft. Drinnen wird es dann so unübersichtlich, dass man sich regelrecht durchkämpfen muss. Hilfestellung leisten dabei die überdimensionierten Tablettes, die man bäuchlings vor sich herträgt und anderen in die Nieren presst. Dreht sich doch einmal einer um, guckt man schnell nach hinten und ruft empört, wieso hier so gedrengelt wird.
Gedrengelt. Gedränge entsteht häufig da, wo es eng wird. Dass die beiden Worte keine gemeinsame etymologische Wurzel haben, ist schon mehr als erstaunlich, wo sie einander doch bedingen. Aber wahrscheinlich ist das nur wieder irgendwann vergessen worden, wie bei den anderen Wortpaaren, die sich meist auch noch zufällig reimen oder sich nur deshalb voneinander unterscheiden, weil vorher ein paar Konsonanten hinzugekommen sind. Nomen est omen, sage ich da nur.
Jedenfalls bin ich dann doch wieder hinausgegangen und habe mich brav an das Ende der Schlange gestellt. Ich habe mich einfach nicht getraut, da vorn zu bleiben und mich irgendwo reinzunuscheln. Ich bekam schlechte Laune und stellte mir vor, dass das Essen, was ich gleich esse, die Reste von gestern aus der Hauptmensa sind*. Als ich dann mein Essen hatte und endlich zwei Plätze an einem Tisch fand, besetzte ich gleich beide Plätze. Mein Rucksack platzierte ich auf dem Stuhl neben mir, und jedem der fragte, sagte ich, der Platz sei besetzt. Davon steht nämlich nichts auf den Klappkärtchen.
*Wenn Sie sich einmal die Mühe machen wollen, dann folgen Sie dem Link und schauen sich die Pläne genau an. Meine Vermutung ist nicht so weit hergeholt, wie ich mir das wünschen würde.
Gestern saß ich einem merkwürdigen Zufall auf, es nichts wirklich Besonderes, aber eben doch ungefähr so bemerkenswert, als würde einem plötzlich auffallen, dass Oma, Opa und Onkel alle mit O beginnen und außerdem auch noch Verwandte sind. Um das zu erleben, musste ich nicht nach dem Weltfrieden suchen, geschweige denn überhaupt Linden verlassen. Ich ging einfach mit dem Kinderwagen bewaffnet am Leineufer entlang und wendete mich an letzter Stelle wieder den Häuserzeilen zu. Schon von weitem sah ich es wackeln. Es war eine dieser Figuren, die man sich wahlweise auf die Heckablage oder auf das Armaturenbrett stellt, die meine Aufmerksamkeit erregte.
Ich schlich mich seitlich heran, denn was mir bereits von weitem auffiel, das Ding bewegte sich. Ich vermutete einen eventuell nach hinten geklappten Fahrersitz, wo ein Schwarztaxifahrer sich seine Mittagspause gönnt, oder vielleicht ein gestresster Familienvater mit mindestens zwei Kindern zu Hause, die so viel Krach machen, dass er seiner Frau noch kurz mitteilen musste, heute wieder eine Sonderschicht im Büro einlegen zu müssen. So etwas soll es ja geben. War aber nicht. Das Ding stand völlig verlassen auf dem Armaturenbrett und wackelte vor sich hin.
Früher gab es da diese Wackeldackel, die wackelten nur, wenn das Auto wackelte, wenn man ins Auto einstieg, aus dem Auto ausstieg oder wenn man über eine Bodenwelle fuhr. Ganz toll fand ich auch den hüftschwingenden Elvis, ähnliche Wirkungsweise. Schon damals fragte ich mich, welchen Nutzen das hatte, war aber einfach fasziniert wegen des simplen Systems. Es soll ja sogar Armbanduhren geben, deren Batterien sich durch Armbewegungen wieder aufladen. Tolle Technik.
Blumen hingegen waren mir in dieser Funktion, also dem Wackelmechanismus, bisher völlig fremd. Ich bin zwar selbst seit geraumer Zeit wieder Autofahrer, kümmere mich aber nicht um Glücksbänder, Anhänger, Wackeldackel oder sonstigen Scheiß, der Ablagen verquast und Staub fängt, der ohne Tand gar nicht da gewesen wäre. Jedenfalls stand auf dem Armaturenbrett eine Blume, eine Wackelblume. Ich kannte so etwas bisher nur aus längst vergangenen Zeiten, als es noch so lustige kleine Comics zum Ausschneiden und unter die Zunge legen gab. Ich fühlte mich gleich angenehm berührt. Ich gebe zu, ich dachte an den Weltfrieden.
Die Blume wackelte unaufhörlich und genauso schnell wie ich entrückt lächelnd in die Ferne gestarrt hatte, sah ich jetzt empört auf dieses Stück Plastik hinunter, das wahrscheinlich von einer Batterie betrieben nachhaltig die Umwelt zerstörte. Die Blume bestand komplett aus bunten Plastik, also Erdöl, ein paar krebserregende Weichmacher waren bestimmt auch drin, giftige färbende Inhaltsstoffe, die auf dem aufgeheiztem Armaturenbrett für gute Luft sorgten und so ganz nebenbei steckten darin bestimmt ein paar Batterien, die, irgendwann entsorgt, 50.000 Jahre benötigen, um sich restlos abgebaut zu haben.
Völlig darüber entrüstet in meinem Stadtteil solche rücksichtslosen Gesellen anzutreffen, ging ich davon. Ich kam nicht weit, da entdeckte ich die zweite dieser Wackelblumen, ebenfalls auf dem Armaturenbrett eines Autos. Das Auto hatte glücklicherweise kein Hannoveraner Nummernschild, weshalb ich milde darüber hinwegsah. Als ich jedoch nicht einmal eine Straßenecke weiter die dritte dieser Wackelblumen sah, da war ich doch arg besorgt, um die Gesundheit meiner Mitmenschen. Innerhalb weniger Straßenzüge, nicht einmal 5 Gehminuten voneinander entfernt standen 3 Wackelblumen auf Armaturenbrettern und wackelten vor sich hin, obwohl von Fahrern, Beifahrern, Mitfahrern, Abschleppern oder Dieben keine Spur war. Für wen wackeln die denn? Wozu?
Ich ging nach Hause, warf die Kiste an und googelte die Wackelblume. Wackelblume war die nahegelegenste Beschreibung dieser Ungeheuerlichkeit, ich wurde sofort fündig. Ich fand heraus, dass das teuerste Modell eine Kamera und ein Mikrofon enthält, die Wackelblumen im 10er Pack günstiger sind und überhaupt der Hit des Jahres 2012 waren. Ich hatte also wieder einen Trend verpasst. Verdammt! Immerhin liefen die meisten der Wackelblumen mit Solarenergie, für mich ein kleiner Trost.
Ich habe mir mehrere Zettel und einen Stift in die Jacke getan und sollte ich demnächst Oma, Opa oder Onkel Wackelblume sehen, werde ich einen Zettel auf der Windschutzscheibe hinterlassen. Darauf schreibe ich dann so etwas wie: Sie haben einen Trend verpasst.
Ich bin so ziemlich der inkonsequenteste Paketzustellerhasser, den ich kenne. Ich habe doch tatsächlich schon wieder geöffnet, erst unten die Haustür und dann oben an der Wohnungstür. Die Pakete stapeln sich bei uns bereits, weil meine Frau einer ähnlichen Neigung verfallen ist und anstatt sich nur darüber aufzuregen ebenfalls ständig Tür und Tor für Mist aller Art aufhält. Die Nachbarn sonnen sich derweil auf Balkonien, sind vielleicht zu ihren Eltern aufs Land gefahren oder liegen verkatert in ihren Betten, weil gestern irgendeine Sause stattfand.
Heute kam ein so kleines Paket, wie ich es noch nie gesehen habe. Es war so klein, dass es problemlos in den Schlitz jedes Briefkastens hineingepasst hätte, einschließlich einem von dem Format einer Rolle für Tageszeitungen. Das Paket war so winzig, dass kaum genug Platz darauf war, um Absender und Empfänger vernünftig voneinander zu unterscheiden, weil sie quasi wie ein Doppelname an der Tür direkt nebeneinander standen. In dem Paket hat eine Zigarettenschachtel Platz, eine Fernbedienung für die Standheizung des unten geparkten Autos oder ein orangefarbenes Reclambuch von Wolfram von Eschenbach mit dem Titel „Parzival 1“.
Der Sadist von Paketzusteller hat es trotzdem nicht für nötig befunden, uns zu verschonen. Er gibt in meinem Beisein meinen Namen, den er zuvor vom Klingelschild abgelesen hatte, falsch in sein Gerät ein, fragt dann noch einmal nach und berichtigt nicht. Er hält mir das Ding vor die Nase und lässt mir gerade genug Zeit, um einen Strich von der Länge eines Regenwurms auf dem Display zu hinterlassen und tut dann so, als hätte er es eilig. Mich mit dieser Lappalie erst überhaupt nicht zu belästigen, kam ihm natürlich nicht in den Sinn.
Gestern übrigens bin ich durch das Zooviertel gefahren und habe dort einen Briefkasten der Deutschen Post entdeckt, der gar nicht für Briefe ist, sondern für Pakete. Und weil das scheinbar so kompliziert ist, stand darauf, dies sei ein Briefkasten nur eben nicht für Briefe, sondern für Pakete. Und weil das so kompliziert ist, wo es doch einfach sein könnte, gehe ich zur Tür und nehme Pakete von der Größe eine Zigarettenschachtel an, die in jeden Briefkasten passen. Ich bin so blöd wie ein Paketkasten, der Briefkasten heißt aber eigentlich für Pakete ist, was extra draufgeschrieben steht, damit niemand einen Brief einwirft, in den Briefkasten für Pakete.
Ich öffne die Tür nicht, ich betätige den Türsummer nicht, basta. Ich öffne nur dann, wenn das Pack, das mir etwas verkaufen will, es bereits in den Hausflur geschafft hat. Das schaffen regelmäßig nur die Leute vom Wachturm, die haben bestimmt den Schlüssel vom Postboten geklaut, weswegen der jetzt immer klingeln muss und die Wachteln singen mir dafür ihr Lied vom lieben Gott vor, alle paar Wochen.
Wenn ich durch die Milchglasscheibe der Eingangstür die Schatten im Treppenhaus zählen kann und ich davon ausgehe, mit ihnen fertig zu werden, dann gebe ich vielleicht nach und schaue mal, wer da so rumlungert. Die ersten Schatten entpuppten sich als genau ein Schatten, ein Riesenschatten. Ich öffnete. Ein dicker Mann stand vor der Tür mit zwei Paketen, die dringend einen Abnehmer suchten. Ich sollte der Abnehmer sein. „Nehmen Sie Pakete? Für Ihre Nachbarn?“ Ich nahm die Pakete, schaute auf den Adressaten und sah hinüber zur Nachbarwohnung, wo gerade ein Schatten hinter der Tür verschwand. Meine Nachbarin war zu Hause und ich öffnete die Tür für ihr Paket. Ich hielt den Mann zurück und sagte, er könne das Paket gleich drüben abgeben, da sei doch jemand da. Ich ging rüber, klingelte, abgestellt. Ich klopfte. Meine Nachbarin machte die Tür auf und nahm ihr Paket selbst an.
Der Paketdealer hatte inzwischen meinen Nachnamen vom Klingelschild abgetippt und mir dann sein Gerät unter die Nase gehalten. Da stehen zwei Namen dran aber er hatte sich sofort für den richtigen Namen entschieden. Ich zog die linke Braue vor Hochachtung, behielt das zweite Paket und sagte nicht Tschüss. Ich ging wieder rein. Es klingelte erneut in diesem Moment und ich benutzte doch tatsächlich den Summer. Ich stand ja gerade da. Da konnte ich schon mal ganz nett sein. Zumal ich dem Paketmann ja gerade nicht so freundlich gekommen war. Das „Danke Pohost“ konnte ich nicht hören, die Tür war zu.
Es klingelte kurze Zeit später schon wieder. Natürlich, die Nachbarin, deren Paket ich angenommen hatte. Sie ist mir ein wenig suspekt, ihr Gesichtsausdruck sagt mir, dass sie es hasst, wenn ich ihre Pakete annehme. Sie wohnt im Erdgeschoss und ich im dritten Stock. Sie ist schwanger, gehetzt und mürrisch und speist mich mit einem faden Dank ab, den sie ins Treppenhaus jubelt. Sie wandte sich nämlich bereits den Stufen zu beim Reden und ließ mich im Türpfosten das Echo erwarten, es klang nach dringend nötiger Treppenhausreinigung.
Es klingelte schon wieder. Ich ging zur Tür und da stand schon wieder ein Schatten, ein Riesenschatten. Nein, es waren zwei Schatten und sie drifteten gerade auseinander, als wollten sie mir beim Türöffnen eine Rettungsgasse freihalten, für alle Fälle. Schon wieder Nachbarn. So langsam hatte ich die Schnauze gestrichen voll. Nicht nur, dass es in unserem Haus anscheinend zuging wie in einem Bienenstock, es mussten auch alle bei mir klingeln und irgendetwas abladen, und sei es nur ihre schlechte Laune. Außerdem ist es seit Tagen furchtbar laut, weil die neuen Nachbarn über uns mit Hammer und Meißel bewaffnet durch die Wohnung ziehen und jeden Quadratzentimeter mit Schlägen überziehen, angeblich weil die Dielennägel zum Schleifen zurück ins Holz getrieben werden müssten. Ich vermute ja eher einen Durchbruch zum Nachbarhaus, als Fluchtweg.
Die beiden hatten einen Sechserträger Bier und eine Gummitierkilogrammpackung in den Händen und überreichten diese feierlich an mich. Die Worte, die das Prozedere begleiteten, sollten mich vor noch lauteren Maßnahmen warnen, die uns, die wir ja unter ihnen wohnen, am Wochenende erwarten. Tischler arbeiten nämlich nur am Wochenende schwarz und die Geräte ihrer Arbeitgeber, wie zum Beispiel eine Dielenschleifmaschine kann der Arbeitgeber auch nur am Wochenende entbehren. Ich bin ja für eine 7-Tage Woche für Handwerker, vollbezahlt und im Ausland, dann kommen die Heinis nicht auf die Idee am Wochenende anderer Leute Nachbarn mit Lärm zu malträtieren.
Meine Augen sprachen von einem veganen und alkoholfreien Leben, während ich mir das gelatinegefüllte Gummikilo unter den Arm klemmte und es irgendwie schaffte, den Sechserträger unter dem anderen Arm zu parken. Mein Mund sagte etwas von Mittagsruhe wegen der Kinder. Ob das geht? Sie wüssten es nicht, der strenge Zeitplan und so, der Tischler, der nur am Wochenende kann und überhaupt, wo schlafen die Kinder denn, und könnte man da nicht. Nein, nahm ich sie ins Visier. Naja, eventuell gibt es ja leise Arbeiten ganz weit weg von den schlafenden Kindern in einem anderen Raum, hörte ich mich sprechen. Ich wurde zuerst mit Zucker und Alkohol überrumpelt und dann von mir verraten. Ich brauchte keine Glaskugel, um die Kopfschmerzen zu sehen. Ich kickte die Tür zu, weil die Hände nicht frei waren und gehe für diese Woche nicht mehr zur Tür, basta.
Ich hörte heute Nachmittag einen Radiobeitrag auf D-Radio Kultur. Zufällig erwischte ich genau den Moment, an dem ich das Radio ausschalten konnte, ohne mich später darüber zu ärgern, vielleicht noch etwas Wichtiges verpasst zu haben. Ich sitze nämlich nicht selten im Auto und höre einen Radiobeitrag und dann gilt es auszusteigen, zu arbeiten. Hey, du bist da!, denke ich mir zu und schalte wehmütig den Motor aus; mit ihm das Radio. Dann ärgere ich mich sogar darüber, überhaupt Radio gehört zu haben.
Aber ich höre nicht einfach Radio. Ich höre meistens D-Radio Kultur. Ich kenne das Programm, finde die Musik gut, die Literaturtipps, überhaupt das Feuilleton. Fahre ich morgens am Dienstag los, um meinem Job nachzugehen, erwische meist ein wenig davon und später, wenn alles eingekauft worden ist und ich zurückfahre, höre ich noch ein wenig von der Ortszeit, einer Nachrichtensendung mit größerem Umfang.
Nachmittags höre ich fast nie Radio, es sei denn, ich habe irgendeinen Weg, so wie heute, dann kommt es schon einmal vor, dass ich das Nachmittagsfeuilleton einschalte. Es geht um Lampen, um LED, um genauer zu sein. Ich verstehe nichts, weil ich den Anfang verpasst habe, bis ich plötzlich Marketingleiter, neues Lampensystem und Stimmungslampe höre und von einem Raum gesprochen wird, in dem 3 Lampen stehen, die unterschiedliches Licht aussenden. Man stelle sich vor, es gibt da eine App, die berechnet die Lichtqualität aus einem Foto heraus und stellt die Beleuchtung im Raum danach ein. Ein Karibikfoto und schon ist das Wohnzimmer in Karibiklicht getaucht, Urlaubsstimmung durch Beleuchtung.
Ich habe nicht am Ende des Beitrages ausschalten können, weil ich mein Fahrtziel bereits vorher erreicht hatte. Ich ärgerte mich nicht darüber, ich schrieb ja bereits, dass ich genau den richtigen Moment erwischte, um auszuschalten. Es ging gerade darum, welche Stimmungen in dem Leuchtensystem bereits vorprogrammiert seien, als ich mich ohne zu zögern von diesem Radiobeitrag trennen konnte. Es gibt da zum Beispiel spezielles Licht zum Schlafen.
Früh am Morgen stehe ich auf, verrichte Dinge und setze mich irgendwann gemütlich an meinen Schreibtisch, um weitere Dinge zu tun. Dann klingelt es. Ich weiß, dass da niemand vor der Wohnungstür steht, höchstwahrscheinlich steht da nur jemand vor der Haustür unten auf der Straße. Noch bevor ich überhaupt auf den Gedanken komme, aufzustehen und nachzusehen, weiß ich schon das Getrappel von oben zu deuten: der Postbote hat geklingelt, im ganzen Haus an jeder Klingel.
Ich gehe zum Fenster, öffne es und schaue herab auf das blaue Fahrrad, spucken wollte ich, denn der Gedanke, den ich eben zu fassen bereit war, ist weg. Ich setze mich also wieder und versuche erneut, mich in meine Dinge zu versenken, mich auf sie einzulassen, um vielleicht einen Text für mein Blog zu schreiben. Es klingelt wieder. Ich gehe wieder nicht zur Tür, öffne aber das Fenster. Unten steht eine Blondine mit einem Smartphone und spricht hinein. Verklingelt muss sie sich haben, ich kenne sie nämlich nicht.
Und dann, ich bin gerade dabei mir eine schöne Wendung auszudenken und den Dreh zu kriegen, klingelt es schon wieder. Eindringlich und lange. Ich denke, vielleicht ist es mein Nachbar, dessen Paket ich gestern annahm, als ich mich dummerweise ebenfalls darauf verstieg, den Türsummer zu benutzen. Ist er aber nicht. Ich benutze den Summer, ich stehe ja gerade an der Wohnungstür, da brüllt es von unten hoch: „Danke! Post!“ Nebenher klimpert ein Schlüsselbund.
Die gelben Postboten – im Gegensatz zu den blauen Postboten – besitzen nämlich einen Schlüssel zu unserer Haustür, das weiß ich, weil ich einmal gesehen habe, wie ein Aushilfspostbote elendig lange an seinem Bund nach dem richtigen Schlüssel gesucht hat. Sie können aufschließen und sind somit gar nicht darauf angewiesen, schwer arbeitende Bewohner aus ihren Tätigkeiten herauszuklingeln. Den benutzen sie aber nicht, weil das Schlüsselbund so groß und unhandlich ist, weil sie den Schlüssel vergessen haben, weil sie sich nicht vorstellen können, dass es Menschen gibt, die nicht bis Mittag schlafen, die sie mit ihrem Geklingel und einem hämischen Grinsen daran erinnern, dass sie gestern viel zu spät und viel zu besoffen ins Bett gegangen sind, um heute etwas anderes zu tun, als auszuschlafen. Sie stehen dann lächelnd im Eingang der Haustür und brüllen ihr „Danke! Post!“ nach oben, klappern mit dem Schlüsselbund und werfen Müll in die Briefkästen.
Eben war ich unten, keine Post.
Dieser Text gehört zu der bekannten Reihe um den geschäftigen Laborchef Dr. Klenk.
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Nicht nur die eine Theorie zu Grau hatte der gute Goethe, sondern mindestens zwei sind weithin bekannt. Das Grau steht hier für die Tristesse eines theorieüberladenen Magisterlebens auf der einen Seite und auf der anderen hatte Goethe seine ganz eigene Theorie zur Farbenlehre, dem Grau kommt dabei noch eine besondere Rolle zu, wie wir gleich feststellen werden.
Der zweiten Tristesse, also dem Grau nicht im, sondern auf dem Kopf, wurde vor kurzem der Kampf angesagt. Einerseits, so sagt es uns Doktor Klenk, sei es ein neuer Megatrend, zu seinem grauen Haupthaar zu stehen, und andererseits hätte er ein probates Mittel entdeckt, das Grau auch auf seine Farbechtheit hin erstrahlen zu lassen. Doktor Klenk bemächtigte sich nämlich der Theorie Goethes und hat sie für uns alle praxistauglich gemacht. „Mit Blick auf die steigenden Verkaufszahlen“ zeigt sich der Herr Doktor deshalb sehr selbstbewusst und zuversichtlich. Doch Moment! Worum geht es hier überhaupt?
Fangen wir besser am Anfang an: „Und grün des Lebens goldner Baum.“, endet das berühmte Bonmot Goethes und nichts anderes hat der Doktor Klenk getan. Er hat sich zum einen der etwas seltsamen Farbmetapher bedient; die als Kulturartikel getarnte Werbebotschaft in der Zeitung mit der gewagten thesenartigen Überschrift „Goethe hätte PowerGrau genommen“ beginnt nämlich mit einem ähnlich gut ausgeklügelten Teaser: „Der bekannte Laborchef Dr. A. Klenk über sein Shampoo, das graue Männer vom Gilb befreit.“ Und zum zweiten kann hier die Farbenlehre Goethes nachvollzogen werden, denn: grün ist des Lebens goldner Baum!
Das Grau des Hauptes ist vom Gilb beschmutzt. Dr. Klenk kämpfte jahrelang um die Emanzipation des Grau, weil er mittlerweile selbst ergraut ist über seine Tätigkeit im Labor, und Alpecin stellt ja leider keine Haarfärbemittel her. Wie hat er das gemacht? Er hat seinem Shampoo „lila Farbpigmente“ beigemengt, die den Gilb abdecken und das Grau in seinem vollen Glanz erstrahlen lassen. Um dies zu verdeutlichen hat er seiner Werbebotschaft diesmal keine Wachstumskurve beigefügt, sondern 5 Haarsträhnen unterschiedlicher Couleur, die im Verlaufe von keiner Haarbehandlung über 5, 10, 30 bis insgesamt 60 Haarwäschen immer grauer werden. So oder so ähnlich findet sich das Ganze schon bei Goethe, der ja ein großer Kenner allen Grauens, äh Graues war.
Mit diesem einmaligen Produkt können Sie sich, werte Leser, in einen echten Silberrücken verwandeln! Niemand wird Sie mehr auf Ihren Zigarettenkonsum, auf Ihre manisch anmutenden Höhensonnensitzungen oder schlicht auf Ihren straßenköterblonden Schopf ansprechen. Einzige Schwäche der Argumentation ist die Dauer der Behandlung, die nicht weiter spezifiziert wurde auf einen bestimmten Zeitraum. Es stellt sich nämlich die Frage, ob Sie die Haarwäsche mit einem Mal auf 60 Anwendungen bringen müssen und ob Sie nach den 60 erfolgten Haarwäschen damit aufhören müssen. Ich für meinen Teil vermute ja, dass sich hinter diesem Zurückhalten wichtiger Informationen ein weiteres Kalkül versteckt: Sollten Sie die Haarwäschen auf einmal ausführen, könnte es sein, dass Sie 1. sehr viel Shampoo benötigen und 2. nach erfolgter Behandlung eventuell auch noch das Mittel gegen Haarausfall kaufen, weil sich ihr Schädel in ein Feuchtbiotop verwandelt hat. Oder sollten Sie die Haarwäschen in den üblichen Haarwaschprozeduren über einen normalen Zeitraum absolvieren, von sagen wir 60 Tagen, und sich deshalb das Ergebnis nicht einstellen, kaufen Sie noch mehr von diesem Mittel. Alles in allem eine Win-Win-Situation.
Gratulieren wir also dem Laborchef Dr. Klenk für seine ausgeklügeltes Produkt (und hier noch die
beispielhafte Werbeanzeige aus der Presse)!
In Hannover trifft man sich seit 150 Jahren schon „unterm Schwanz“. Zumindest behauptet das der Zoo in seiner neuen
Werbekampagne. Dieser vielleicht anrüchig anmutende Ort, also unterm Schwanz, hält natürlich längst nicht, was er verspricht, denn mit diesem Ort ist das weitausladende Hinterteil eines
Reiterstandbildes gemeint, das direkt vor dem Eingang des Hauptbahnhofes steht.
Ein überdimensionierter Ernst August reitet auf seinem nicht minder stattlichen Pferd gemächlich in Richtung Innenstadt. Der Schwanz des Tieres hingegen wendet sich dem Bahnhof zu, gleich so als würde das antiquierte Fortbewegungsmittel Pferd einen Furz auf die neue Art des Reisens geben. Einen Furz lässt das Pferd aber nicht. Auch Pferdeäpfel gehören für diesen Gaul längst der Vergangenheit an, was die Treffpunktbenutzer unterm Schwanz, den die Hannoveraner ja seit 150 Jahren ansteuern, vor herunterfallenden Exkrementen bewahrt.
Der Zoo nun wieder dachte sich, dass mit einer Werbekampagne ganz im Sinne dieses Treffpunkts, unterm Schwanz, ja auch Tiere aus dem Zoo gemeint sein könnten. Angesichts sinkender Einnahmen wegen allzu schlechten Wetters, käme es den Betreibern gerade recht, wenn die Hannoveraner sich nicht unterm Schwanz am Hauptbahnhof träfen, sondern unterm Schwanz im Zoo.
Bildgeber in dieser merkwürdigen Metapher sind übrigens tatsächlich Zootiere, das heißt also, der Hannoveraner kann sich dann unterm Schwanz eines
Elefanten treffen oder eines
Zebras oder eines
Leoparden. Das ist selbstverständlich längst nicht so ungefährlich wie unterm Schwanz am Hauptbahnhof, sind das doch erstens trotzdem wilde Tiere, auch wenn sie im Zoo leben, und zweitens könnten diese Tiere tatsächlich einen Haufen machen, weshalb sich dieser Treffpunkt nur bedingt eignet, sollte man danach noch etwas vor haben.
Genau aus diesen Überlegungen heraus hat der Zoo zwei unschlagbare Tricks aus der Mottenkiste geholt: bei den Tieren, die im Erwachsenenalter tatsächlich gefährlich sein könnten, sind statt großer, womöglich fleischfressender Raubkatzen niedliche kleine Tierbabys aufgenommen worden. Nur beim Zebra, dem harmlosesten von den dreien, haben sie auf den zusätzlichen Niedlichkeitsfaktor verzichtet.
Der zweite Trick aber ist so perfide, dass ich schon eine ganze Weile suchen musste, um herauszufinden, wie die das überhaupt gemacht haben. Ich musste
wahnwitzige Suchanfragen in Google stellen, um den offensichtlichen Mangel im Zoobild aufzudecken, und gefühlte hundert Jahre später hatte ich dann endlich ein
Vergleichsbild gefunden. Wollen Sie noch wissen, was der Zoo gemacht hat? Ja? Die haben dem armen kleinen Elefanten einfach das Arschloch wegretuschiert, damit er niemandem auf den Kopp scheißen kann!
Am Wochenende fuhr ich mit dem Fahrrad durch Hannovers Innenstadt zur Arbeit. Es war Markttag aber zu dieser Uhrzeit sind normalerweise keine Stände mehr aufgebaut. Umso mehr staunte ich über den einen verlorenen Stand am Steintor, dort wo die Fußgängerzone beginnt und Radfahrer nur noch bedingt fahren dürfen. An dem Stand gab es einen Haufen Bücher und dahinter saßen zwei frierende Typen, von denen ich nicht mehr sah, als die Augenpartien. Der Rest verschwand unter Schal und Mütze. Die armen Jungs, dachte ich, bis ich, weil ich sehr auf die Fußgänger zu achten hatte, im Vorüberfahren einen Blick auf die Titelseite des Buches werfen konnte. Es war nur ein ganz kurzer Blick und mehr als den Nachnamen des Autors habe ich in der Kürze gar nicht erfassen können. Das reichte aber, um das „arme Jungs“ zurückzunehmen. Es war von Hubbard. Ich sah mich schnell nach allen Seiten um, denn am vorigen Samstag traf ich genau zu dieser Zeit an genau dieser Stelle ein paar weißgewandete Koranverschenker und für ein Aufeinandertreffen dieser beiden Gruppen hätte ich sogar meinen Arbeitsbeginn verschoben.
Ich fuhr mittlerweile am neuen Treffpunkt in der Innenstadt vorbei. Früher war das ja an der Kröpcke-Uhr. Heute trifft man sich vor dem Eingang von Primark. Zumindest stehen hier so viele Leute planlos herum und starren auf ihre Handys, dass ich nur hoffen kann, sie sind hier verabredet und nicht vielleicht obdachlos und tragen ihr gesamtes Hab und Gut in einer dieser großen braunen Tüten mit dem Primark-Logo herum. Nur ein paar Straßen weiter gab es plötzlich wieder einen dieser Stände, die man weder an diesem Ort noch zu dieser Zeit vermutet hätte. Der Wahlkampf ist in Niedersachsen längst vorüber, dennoch konnte ich bereits von weitem erkennen, dass es sich um einen Parteienstand handeln musste. Die Beschriftung des windschiefen Schirmchens ließen keine Zweifel aufkommen. Hier warb die Partei „Pro Deutschland“ auf verlorenem Posten mit kleinen Handzetteln, für die ich extra mein Tempo erhöhte, um nicht noch einen aufgedrückt zu bekommen. Mein Mitleid für diese kleine frierende Runde hielt sich in Grenzen. Vielmehr wünschte ich mir jetzt nichts sehnlicher als die Koranverschenker, die leider wieder nicht auftauchten.
Der letzte Stand an diesem Tag begegnete mir, kurz bevor ich auf den Opernplatz einbog. Die Koranjungs waren es aber nicht, die ich sah. Gewundert hätte mich das jetzt auch nicht mehr, wenn die plötzlich statt herumzulaufen hinter einer überdachten Theke eine Auslage bedienten. Bücher gab es allerdings auch hier in Massen, Gelbe Seiten.