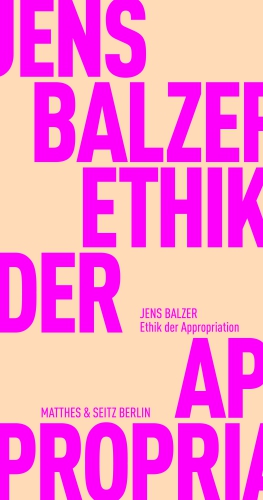Mensagespräche
Ich habe heute mein erstes von vielen Referaten gehalten. Es war nur eine Textvorstellung, eine Kleinigkeit. Wir waren zu dritt. Jeder von uns knapp 5 Seiten. Ein Spaziergang.
Ein Monster! Die Genese und Bedeutung des Lebensweltbegriffes. Letzte Woche Mittwoch meldete ich mich freiwillig. Zu Sonntag verabredeten wir drei, dass wir uns kurzschließen und uns gegebenenfalls am Montag treffen, wenn etwas unklar ist. Ich las am Sonntag den Text und verstand nichts. Das stimmte nicht. Ich verstand einiges aber ein Zusammenhang, geschweige denn eine Erklärung des Ganzen in eigenen Worten war mir einfach nicht möglich.
Dann schaltete ich ab. Ich wurde immer ärgerlicher. Ich bekam Hass auf den Dozenten, dem es offensichtlich darum ging, die Teilnehmerzahl in seinem Seminar möglichst klein zu halten – eine These übrigens, die sich gehalten hat. Ich bekam Hass auf den Autor, der die Frechheit besaß, Husserl zu zitieren, der ungefähr so etwas sagte wie, dass die Wissenschaft mit ihren Verfahren des Abstrahierens, Verdinglichens usw. schuld daran sei, dass der Lebensweltbegriff überhaupt erst „erfunden“ werden müsse. Die Wissenschaft sei zu weit von der Lebenswelt entfernt. Dieser Wissenschaftler hier übersetzte die „Klassiker“, also Husserl, Heidegger, Schütz usw., aber keineswegs in einen verständlichen Text. Stattdessen kam ein mit Fachchinesisch überfrachtetes Ungeheuer dabei heraus, dessen Erklärungen zu den Vokabeln, die ich nachschlagen musste, um Seiten länger waren, als mein bescheidenes Stückchen Text, das ich vorzustellen hatte.
Ich bekam Hass auf mich selbst, wie ich da so lässig sagte, ach, dann mache ich bei der ersten Gruppe noch mit, wo ich doch selbst so wenig zugehört hatte. Ich wusste doch überhaupt nicht, worum es ging, weil ich andere Dinge zu tun hatte in der
ersten Sitzung. Dann habe ich es hinter mir, dachte ich, genauso lässig. Am Montag lagen meine Nerven blank. Am Nachmittag hatte ich den Text bereits ein zweites und ein drittes Mal gelesen. Ich traf mich mit einer von meinen beiden Mitreferentinnen, wir sprachen das durch und kamen zu keinem Ergebnis, wünschten uns aber Glück. Und dann versuchte ich mich Montagnacht mit einer Verschriftlichung, einem ersten Versuch für mein Gestammel. Es wurde nichts, was zu erwarten war.
Um 23:00 Uhr tat ich dann das Vernünftigste, was mir dazu einfallen konnte. Ich rief Herr Putzig an, Soziologe, Freund und erste Adresse für ein kaltes Bier im Warmen. Ich schickte ihm den Text, sagte ihm, ich sei gegen halb zwölf da und er solle doch schon mal schauen. Herr Putzig scheute sich aber. Er druckste herum; und gab dann nach. Ein Bier! Nur eins!
Als ich gegen viertel vor Zwölf bei ihm war, hatte er tatsächlich in den Text geguckt. Wir unterhielten uns, wir forschten nach diesen kleinen Haken im Text, die Bojen in der Buchstabensuppe, da wollten wir rein, eine Bresche schlagen, uns festklammern, Sinneinheiten bilden, Absätze abhaken. Wir probierten einiges aus, wir erklärten uns gegenseitig die gelesenen Passagen, wir beteten unsern Jammer bei einem Bier runter und kamen auf ein paar kleine Ansätze. Die notierte ich mir.
Ich geriet dabei natürlich immer mehr aus der Fassung. Das lag nicht am Bier, auch wenn es mehr als eins gewesen war. Ich beschwerte mich über den Dozenten, über den Autor, über die ganze verschissene Wissenschaft, die es mir nicht recht machte. Und plötzlich holte Herr Putzig einen Zettel aus seinem Portemonnaie und gab ihn mir mit den Worten, da gucke er manchmal drauf. Da stand: Reg dich nicht so auf, Herr Putzig!
, fragte ich noch im Rahmen der Tür stehend in den Raum hinein. „Ja“, lautete die einstimmige Antwort, nicht ohne ein verhaltenes Lächeln auf einigen Gesichtern zu hinterlassen. Ist ja auch eine komische Frage, wenn man sich in einer todernsten, in sich gekehrten Atmosphäre wie einem Seminarraum kurz vor Beginn der ersten Sitzung eines Seminars einfindet. Ich musste trotzdem fragen, weil ich bei so manchem der in Vorlesungsverzeichnissen so angegebenen Räume meine Probleme hatte. Entweder fand die Veranstaltung ganz woanders statt oder wurde kurzfristig verlegt, weil der Raum zu klein oder zu groß war. Dann steht man da, kommt sowieso schon zu spät, setzt sich und bekommt nach 10 Minuten mit, dass hier gerade eine Vorlesung zu theoretischer Physik läuft, obwohl man doch eigentlich
allgemeine Psychologie hören wollte. Ist alles schon passiert.
Stimmung lautet der Seminartitel. So starte ich ab jetzt für das kommende Semester meine Woche. Immer montags um 10 geht es los, da ist Stimmung. Mit Stimmung verband ich bislang eigentlich immer eine gewisse Atmosphäre oder ein gewisses Gefühl. Ich kann darein versetzt werden oder mich ihr hingeben, ich kann es auch ablehnen oder bin sowieso schon gestimmt, so oder anders. Stimmungen sind fast nie freiwillig, weil sie von uns selbst und unseren Sinneseindrücken abhängen. Schaut man ins etymologische Wörterbuch wird man es so oder so ähnlich dort wiederfinden. Und darüber hinaus findet sich ein Hinweis auf die ursprüngliche Verwendung. Der Begriff kommt aus der Musik, man stimmt eine Gitarre zum Beispiel.
Was mir aber tatsächlich neu war, ist die Unschärfe und die Vielschichtigkeit der Bedeutungen, die das Wort Stimmung im Deutschen haben kann. „Neu“ ist dabei sicherlich nicht ganz richtig, ich habe es mir in diesem Zusammenhang nur noch nie vergegenwärtigt. Wir lasen dazu einen Text von H.G. von Arburg, der in der Einleitung eines Magazins, das sich ausschließlich dem Begriff der Stimmung widmete, von den Schwierigkeiten des Übersetzens des Begriffs Stimmung sprach. So ist im Französischen von zwei Begriffen die Rede, einmal angewandt auf Personen und einmal angewandt auf zum Beispiel Landschaften die Rede, humeur und atmosphère. Oder im Englischen: da gibt es dafür mood einerseits aber den musikalischen Aspekt spart das komplett aus. Andere Beispiele gab es leider nicht, aber interessieren würde es mich schon, ob in fremden Sprachen je nach Sachlage immer nur ein Wort benutzt wird oder auf mehrere zurückgegriffen werden muss. Vielleicht hat da ja jemand eine Idee.
Ich war überpünktlich. Die Dauer der Veranstaltung ist von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr ausgewiesen. Das bedeutet so viel wie, es geht um Viertel nach los und endet um Viertel vor. Ich betrat den Seminarraum um Punkt 10. Es sollte um Fallanalysen in Lebenswelten von Schülern gehen. Es waren kaum noch Plätze frei, bis auf die wenigen ganz vorn im U der Runde. Der Dozent ein junger Mann, vielleicht sogar jünger als ich, war ziemlich aufgeregt, hatte aber alle Sinne beisammen. Sozusagen war sein Lieblingswort, manchmal wunderte ich mich, dass er nicht aus Versehen einmal „sozusagen sozusagen“ sagte, aber ein Wort passte ihm dann doch immer dazwischen. Was sich anfangs noch als schleppend und unangenehme Ein-Mann-Show präsentierte, wechselte im Verlauf der Sitzung zu einer doch eher entspannten Konversationsrunde. Sehr angenehm.
Gleich zu Anfang der Sitzung erbat sich der Dozent beim Vorübergleiten der Anwesenheitslisten von irgendeinem Studenten eine Büroklammer, um die beiden losen Blätter aneinander zu heften. Da ich der letzte war, dem diese Chance zuteilwerden würde, verzichtete ich darauf in meinem sowieso hoffnungslos unaufgeräumten Rucksack nach einer solchen zu suchen. Mir gegenüber ging es aber sogleich zur Sache. Mehrere kramten in ihren Federetuis…, Moment, Federetuis? Ja, richtig. Unauffällig zählte ich die Teilnehmer und diejenigen, die ein Federetui besaßen und ich kam auf ein Verhältnis von fast 2:1. Also jede Zweite besaß ein Federetui. Ich sage mit Absicht, jede Zweite, nicht weil ich mich dem generischen Femininum verschrieben hätte, sondern weil es mit mir und dem Dozenten nur noch zwei weitere Männer im Raum gab, und wir hatten allesamt kein Federetui.
Wie bereits geschrieben, war meine Sitzposition äußerst ungünstig, nicht nur saß ich ganz weit vorn, außerdem auch direkt neben der Tür, eine Tür übrigens, die sich von außen nicht öffnen lässt, wenn man nicht schon mindestens einmal mit ihr gekämpft hat. Zwei Unterbrechungen gab es dann kurz nach Beginn, einmal wurde entnervt aufgegeben, ich konnte auch niemanden mehr entdecken und beim anderen Mal klopfte es und der Dozent sprang sofort auf und öffnete die Tür von innen; das geht übrigens problemlos, soviel also zu den Zulassungsbeschränkungen.
Noch ärgerlicher war aber, dass die Tür im Vestibür nicht richtig schloss, stattdessen hatte sie sich darauf verlegt, laut zu knarzen. Da hinter dieser Tür ein allseits beliebter Rauchplatz liegt, wurde die Tür ständig aufbewegt und dann kroch sie im Schneckentempo und Elefantenlautstärke wieder zurück.
Hinzu kam, dass der Dozent aus meiner Sicht mit mindestens der Hälfte des Kopfes hinter einem
Polylux verschwand. Das erinnerte mich an den gestrigen Kneipenabend mit
Trithemius, wo ich ihm beichtete, wie ich meinem ehemaligen Geographielehrer so manchen Streich gespielt hatte. Heute habe ich deshalb ein schlechtes Gewissen, früher war ich da abgehärteter. Mein Lehrer hatte ein Glasauge, ich saß ihm direkt gegenüber, nur in der letzten Reihe. Vor mir saßen auch keine kleinen Leute. Wenn er mich direkt ansprach, was häufiger vorkam, weil ich Geographie immer sehr gemocht habe, wechselte ich hin und wieder zwischen der rechten und der linken Seite, um an den vor mir Sitzenden vorbei zu sehen. Für ihn war das natürlich nicht so leicht wie für mich, weil er ja mit dem einen Auge nicht sehen konnte, und so wurde eine kleine Bewegung von mir zu einer maximalen Streuung am Lehrertisch. Wie ein Schunkelmännchen am Biertisch bewegte sich sein Oberkörper hin und her, seine Beine waren dabei um die Beine des Stuhls geschlungen, als ob er fürchten musste gleich abzuheben. Dabei war er immer so bei der Sache, dass ihm gar nicht auffiel, wie komisch das war, jedenfalls hatte ich weiterhin gute Noten.
Und so verbrachte ich meist schweigend, zählend oder in Gedanken versunken den Großteil des Seminars. Als die Stunde um war, verließ ich dann den Klassenraum und kurz darauf das Gebäude, nicht ohne der Tür im Flür einen missbilligenden Blick zuzuwerfen.
Meine Tochter bekommt seit geraumer Zeit einen Brei zu Mittag vorgesetzt. Den isst sie je nach Inhalt und Befinden entweder vollständig auf oder nur zum Teil, worüber ich mir selten große Gedanken mache, denn satt wird sie, das sehe ich ihr an. Nun passiert es jedoch hin und wieder, dass sich zusätzlich zu dem pürierten Gemüse auch ein Zusatz im Brei befindet. Das ist eine Paste die aus pürierter Hähnchenbrust besteht und von uns, der wir sonst den Brei komplett selbst herstellen, hinzugekauft und untergemengt wird. Egal welche Art Brei, und mag das Gemüse noch so exotisch sein, egal ob Pastinake, Süßkartoffel oder schlicht Möhren, sie isst ihn dann auf. Diese kleine Zutat, die pürierte Hähnchenbrust scheint dafür verantwortlich.
Auffallend in diesem Zusammenhang ist die offensichtlich sehr geringe Menge, die auf den Gesamtgeschmack wirkt. So ähnlich stellen wir das auch fest, wenn wir einen Longdrink bestellen, der ja zum größten Teil aus „Brause“ besteht und nur einen kleinen Teil, Gin, Wodka oder was weiß ich enthält. Trotzdem wird der Gin in „Gin Tonic“ als erstes, geschmackgebendes Element genannt und erst darauf folgt die Tonic. Auch bei der Wahl des Artikels, Sie haben es sicher gemerkt, spielt sich hier etwas Merkwürdiges ab. Das kann auch einfach an mir liegen, ich vermute aber, dass man sich zumindest drüber streiten könnte, ob es die Tonic aber der Gin Tonic heißt. Bei Komposita im Deutschen bestimmt nämlich eigentlich das zweit- bzw. letztgenannte Wort, das Geschlecht.
Sei es, wie es sei. Was sollte ich von einem kommentierten Vorlesungsverzeichnis des Deutschen Seminars halten, wenn sich darin nur eine einzige Veranstaltung findet, die als Vorlesung ausgewiesen ist und alle übrigen – mehr als 80 an der Zahl – aber Seminare sind? Sollte diese eine Veranstaltung dann nicht auch über eine „besondere Würze“ oder Note verfügen und nicht wie vorgefunden lediglich eine Einleitung in die Literaturwissenschaft geben?
Ich habe das schon erlebt, diese „besondere Würze“, und nicht zu knapp. Nicht selten waren Trithemius und ich beide zu diesen Veranstaltungen gegangen und haben, nicht nur in den Gefilden der Literaturwissenschaft, sondern auch über den „Tellerrand“ hinaus blicken dürfen. Ich habe darüber sogar
schon berichtet. Das finde ich persönlich ein wenig schade, denn der Titel „Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis“ verspricht zwar keine spezielle Note, lässt mich und meine Gewohnheit aber daran denken.
Es ist wieder soweit. Das neue Semester beginnt. Heute wurden die letzten Veranstaltungen des Deutschen Seminars freigeschaltet. Punkt 10 Uhr hieß es deshalb für mich, am Rechner zu sitzen, den Aktualisierungsbutton im richtigen Moment zu drücken, die Leitungsgeschwindigkeit zu verfluchen und abzuwarten. Ich bin in genau eine Veranstaltung hineingekommen heute. Auf den anderen 3 Veranstaltungen stehe ich auf Wartelistenplätzen 3, 11 und 36, denn wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: nur wenige Minuten nach offiziellem Freischalttermin kommt man nur noch auf Wartelistenplatz 36!
Ich gebe zu, diese Veranstaltung habe ich nicht in einem extra Tab meines Browserfensters geöffnet. Ich habe sie mir erst herausgesucht, als abzusehen war, dass ich bei den anderen auf Wartelistenposition einsteige. Das dauert natürlich extra lange, weil es drei verfluchte Seitenaufbauten benötigt, um ein Seminar zu auszuwählen: „Veranstaltung suchen“, „Namen eingeben“, „Auswählen“. Dann folgt noch ein weiterer Schritt, bei dem ich mich in die Veranstaltung einzutragen habe. Minutenlanges Warten und ständiges Herumblättern in den jeweiligen Tabs und Fenstern.
Seit gestern lese ich „Der Schaum der Tage“ von Boris Vian und auf Seite 66 meiner Zweitausendeinser Ausgabe sagt Chick zu Colin: „Die Erwartung ist ein Präludium in Moll.“ Ich hatte mir diesen Satz unterstrichen, obwohl er eigentlich nicht meinen Prinzipien entspricht, ich erwarte lieber nichts, dann überrascht mich auch nichts. Nach meiner heutigen Erfahrung weiß ich auch wieder, warum ich mich vor langer Zeit darauf verständigt habe. Der Satz ist aber trotzdem schön.
Das Herz einer guten Mensa ist nicht der Speisesaal, sondern die Cafeteria. Dort trifft man sich im Anschluss und genießt die verbleibende freie Zeit der Mittagspause. Hier beginnt die Verdauung, unterstützt vom Lebenssaft einer ganz besonderen zivilisatorischen Errungenschaft, dem Kaffee, latte macchiato oder Espresso. Nimmt man einer Mensa diesen Ort, so ist sie ihres wichtigsten Bestandteils beraubt.
In unserer Mensa hat die Cafeteria seit geraumer Zeit geschlossen. In naher Zukunft soll natürlich Ersatz geschaffen werden, ein wenig kleiner aber immerhin. Bis dahin stehen uns etliche nah gelegene Alternativen zur Verfügung. Aber seien wir mal ehrlich, mehr als eine Alternative ist keine, denn daraus ergibt sich das Dilemma der Wahl. Ähnlich wie nach einer beendeten Beziehung, wenn man sich anhören darf, dass andere Mütter ja auch schöne Töchter hätten, geht es uns, wenn wir dann vor der Mensa stehen und wir den Kaffee brauchen. So einfach ist das alles nicht. Dann stehen wir, übrigens nicht zum ersten Mal, vor der Mensa und fragen uns, wohin. Und dann fallen solche Sätze wie: „Manchmal frage ich mich ehrlich, wie es Hannibal damals mit seinen Elefanten über die Alpen geschafft hat. Wir stehen hier rum und kriegen es nicht mal zustande, uns für eine Cafeteria zu entscheiden.“
Wir entscheiden uns dann doch noch für die Cafeteria im Welfenschloss, ein Gehweg von 5 Minuten. Es ist 14:06 Uhr, als wir die Cafeteria erreichen, die Cafeteria schließt um 14:00 Uhr.
Im Rahmen eines Seminars, das gestern seinen Abschluss fand, haben wir uns intensiv mit dem Konstrukt der Intelligenz beschäftigt und sind in der abschließenden Diskussion zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht unbedingt viel darauf zu geben ist, mindestens jedoch gesunde Skepsis an den Tag gelegt werden sollte, wenn von der Intelligenz oder dem Intelligenzquotienten die Rede ist. Im Laufe des Seminars haben wir unterschiedliche Modelle der Intelligenzberechnung durchgenommen, einen Faktor g, also eine allgemeine Intelligenz, hatten viele dieser Modelle gemeinsam und auch die Unterscheidung in fluide, also Problemlösefähigkeit und logisches Denken, und kristalline Intelligenz, explizites Wissen, war vielen Modellen eigen.
Eine Frage, die allerdings nicht beantwortet werden konnte, hat mich während des Seminars immer wieder beschäftigt. Wie verhält sich die Akzeptanz des Wertes der eigenen Intelligenz zum gemessenen Ergebnis? Meine Hypothese dazu lautet, dass sie sich ebenso verhält wie das Aufkommen des IQ selbst, nämlich entlang einer Gaußkurve. Das heißt genauer, dass die Akzeptanz zum Ergebnis im Intelligenztest nach gemessenem IQ in der Spanne von 85 bis 115, also von einer Standardabweichung zu beiden Seiten der 100, am höchsten ist und je nach Höhe des gemessenen Wertes zu beiden Seiten hin abfällt. Konkreter würde das für die Intelligenzmessung bedeuten, dass insbesondere sehr niedrig ausfallende und sehr hoch ausgefallene Messergebnisse von den jeweiligen Probanden weniger akzeptiert werden, als Werte im Normalbereich.
Doch was bedeutet das? Auf dem Gebiet der differentiellen Psychologie stellt die Intelligenzforschung einen nicht kleinen Forschungszweig dar, der unter Umständen erheblich in das Leben Vieler eingreifen kann. Sei es nun der Einstellungstest bei einem Arbeitgeber oder die Vorschuluntersuchung oder ein Schullaufbahntest. All diese Ergebnisse können dazu führen, dass Lebenswege vorgezeichnet werden, die von den Betroffenen unterschiedlich aufgenommen werden können. Im Allgemeinen verlässt sich aber vor allem der Tester auf das Ergebnis und gibt dernach Empfehlungen für Job oder Schullaufbahn. Gekniffen sind die Getesteten, wenn das Ergebnis nicht das gewünschte, bzw. eher erhoffte Resultat liefert.
Zwei Extrembeispiele sollen das einmal näher erläutern: Vor nicht allzu langer Zeit geisterte der Fall des Marvin Wilson durch die Presse und führte nicht zuletzt wegen des bei ihm gemessenen IQs zu einem Aufschrei der Empörung. Wilson hatte einen IQ von 61, was in den USA als geistig behindert gilt. Somit ist die Schuldfähigkeit eingeschränkt. Trotzdem wurde Wilson hingerichtet, weil er in anderen Messungen einen IQ von 71 bzw. 75 erreichte. Wie gekniffen der Getestete in diesem Fall war, muss nicht näher erläutert werden.
In einem anderen Fall – auch dieser findet im Netz Verbreitung – geht es um eine New Yorker Stripperin, die angeblich einen sehr hohen IQ haben soll. Ich konnte das nicht genauer nachprüfen, ob es sich bei dieser Messung eher um eine Ente oder um ein tatsächlich stattgefundenes Ereignis handelte, muss es aber gar nicht, denn zwei Dinge werden dabei klar: sollte es sich um eine Ente handeln, scheint zumindest der Wunsch nach einer „Normalisierung“ erkennbar zu sein, also die Akzeptanz des Messergebnisses nimmt auch bei hohen IQs ab. Oder, sollte es tatsächlich wahr sein, bestätigt es meine Hypothese zumindest insofern, als dass ein hohes Ergebnis nicht automatisch zu den bestmöglichen Lebensentwürfen führt.
In beiden Fällen, wie auch in vielen anderen sind es jeweils nur die Tester, bzw. die Beobachter, die etwas davon zu haben scheinen, den Getesteten geht es entweder nichts an oder es ist ihnen egal. Die anfänglich beschriebene „gesunde Skepsis“ reicht bei weitem nicht aus, wäre mein Ergebnis dieser Überlegungen. Offenes Misstrauen jeglicher Art dieser Tests, den Entwicklern und Anwendern gegenüber wäre wohl eher angebracht.
Die Sitzung vom 20.06.2013 im Seminar „Zur sozialisatorischen und pädagogischen Bedeu-tung des Spiels“ widmete sich nicht der üblichen „Klassikerexegese“, sondern betrachtete stattdessen ein besonderes Phänomen der Schulbuchgestaltung. Schon zu Beginn der Sitzung wurde von H. K., der die Sitzung leitete, klargemacht, in welchem Zusam-menhang sein vorgestelltes Thema zum Kontext des Seminars gesehen werden sollte. Durch eine Seminararbeit zur Bebilderung von Schulbüchern, die er im Rahmen eines anderen Seminars anfertigt, kam ihm der Gedanke, dass Sportmetaphern in den Bebilderungen von Schulbüchern einen überproportional großen Stellenwert einnehmen. Um die pädagogische Bedeutung des Spiels – in seinem hier vorgestellten Fall des sportlichen Wettkampfs – herauszuarbeiten, hatte er für uns als Beispiel ein Deutschbuch der 5. Klasse aus dem Verlag Cornelsen aufbereitet und mehrere Abbildungen aus dem Themenkomplex „Arbeitstechniken“ zur Verfügung gestellt. Dieser Teilbereich der Arbeitstechniken widmete sich dem Thema „Hausaufgaben organisieren“. H. K. betonte, dass es ihm nicht schwer gefallen sei, einerseits Abbildungen generell und andererseits Abbildungen zu finden, die seine These vom übermäßigen Gebrauch von Metaphern des Sports unterstützen.
Problematisch erschien sowohl dem Plenum als auch dem Dozenten, dass Abbildungen in Schulbüchern dadurch nicht einer gewissen Verlogenheit entbehren, die sich – überspitzt formuliert – auf das gesamte System Schule übertragen ließen. In einem kurzen Exkurs seitens Herrn Wernet wurde dazu sinngemäß die Antrittsrede eines Schuldirektors zitiert, dem es oblag, eine Klasse von neu eingeschulten Kindern auf den Schulalltag vorzubereiten. In dieser Rede wurde – ebenfalls überspitzt formuliert – nicht gesagt, dass Kuscheltiere nur in der ersten Woche erlaubt seien, die Schülerinnen und Schüler vor allem das Stillsitzen und Nur-Reden-wenn-sie-gefragt-werden zu lernen haben, sondern, dass sie neue und alte Freunde um sich hätten, neue Herausforderungen auf sie warten würden, der Ernst des Lebens begänne und noch weitere unscharfe Formulierungen. Sowohl die Einführung in den neuen Lebensabschnitt Schule als auch die Bebilderung von Schulbüchern hätten demnach etwas „verlogenes, zweifelhaftes“, im Mindesten jedoch wären sie „wirklichkeitsfern“ zu nennen.
Ich weiche in den folgenden Darstellungen vom chronologischen Ablauf der Ereignisse ab, da sich die freie Interpretation der Abbildungen durch das Plenum während des Seminars nicht ohne eine gleichzeitige Darstellung der Bilder bewerkstelligen ließe. Daher beginne ich mit einer möglichst wertfreien Darstellung des Gesehenen und erst darauf folgen die markanten Punkte in der Diskussion. Die zur Abbildung gehörenden Formulierungen wer-den nur dann in einen Kontext gestellt, wenn es hinsichtlich der Evidenz der Interpretation notwendig erscheint.
Bildanalyse Bild 1
Bild 1 zeigt einen Jungen, der offensichtlich in den Vorbereitungen steckt, einen Start auf einer Kurzlaufstrecke vorzunehmen. Außer dem Jungen ist nur noch ein Startblock darge-stellt. Der Junge wendet dem Betrachter zwar sein Gesicht zu, der Blick jedoch ist nicht klar einer bestimmten Richtung zuzuordnen. Er befindet sich in der Hocke und steckt mit einem Bein bereits im Startblock, auf dem eine 1 abgedruckt ist.
Die abgebildete 1 auf dem Startblock bot sogleich eine Vielzahl an Interpretationsmöglich-keiten, die letztendlich jedoch alle auf eine Platzierung im Rennen hindeuteten. Hielte man sich nah am Text, so ließe die Abbildung den Schluss zu, dass eine gute Vorbereitung automatisch zu einer guten Platzierung führe. Eine gemäßigtere Interpretation dagegen gestand der 1 lediglich die Funktion einer Startposition zu, im Sinne von mehreren Startbahnen, die durchnummeriert werden und bei 1 beginnen. Die 1 (übertragen auf den schulischen Kontext) als Benotung zu sehen, konnte sich demgegenüber nicht durchsetzen. Grundsätzlich ist aber der fast alles dominierende Wettkampfgedanke festzuhalten, außerdem die Verhaltens- und Spielregeln, die zu beachten sind und die „Illusion“ eines guten Ergebnisses bei guter Vorbereitung. Auf der anderen Seite wurde mehrfach vom Plenum darauf hingewiesen, dass die Abbildung aufgrund ihrer fehlerbehafteten Darstellung geradezu dazu einlädt, missgedeutet zu werden. Dies äußerte sich einerseits bereits bei der abgebildeten 1, weil sich eine Startposition – sollte diese Deutung angenommen werden – auf der Bahn befindet und nicht auf dem Startblock, und andererseits der Startblock selbst nur „rudimentäre“ Merkmale eines solchen besaß: es gab nur die Möglichkeit, einen Fuß einzustellen, der normalerweise aus zwei Fußstützen bestehende Startblock war nicht vollständig dargestellt.
Der allgemeinen Dominanz des Wettkampfgedankens ließ sich dann noch entgegenhalten, dass der Junge in seinem Startblock nach hinten schaut, also noch nicht als im Start befindlich dargestellt wird. Er vergewissert sich der richtigen Einstellung des Startblockes, dies war allgemeiner Konsens in der Diskussion. Im Hinblick auf die Wortwahl im Text tritt der Wettkampfgedanke wiederum sehr in den Fokus. Die Formulierung „präzise Einstellen“ deutet auf die seitens der Verfasser gewünschte Sorgfalt der Hausaufgabenvorbereitungen hin. Die Formulierung „Hindernisse aus dem Weg räumen“ allerdings erzeugt kein vernünftiges Bild im Kopf des Betrachters, weil ein Läufer zwar durchaus seinen Startblock präzise einstellt, sich im Allgemeinen aber nicht darum zu kümmern hat, dass seine Laufstrecke frei von Hindernissen ist. Sowohl Text als auch Darstellung vermitteln daher den Eindruck, dass die Verfasser selbst nicht ausreichend vorbereitet gewesen waren, als sie den Vergleich der Hausaufgabenvorbereitung mit den Vorbereitungen auf einen Kurzstreckenlauf anstreng-ten.
Bildanalyse Bild 2
In diesem Bild wird eine Laufstrecke gezeigt. Diese wird durch ein Schild, auf dem „Start“ steht, in ihrem Anfang markiert, verläuft dann in Schlängellinien irgendwohin und ist mit unterschiedlich hohen Bücherstapeln belegt, auf denen jeweils „Portion 1“, „Portion 2“ usw. abgedruckt ist. Am Anfang der Strecke hockt ein Junge in der „üblichen“ Starterpose. Hier fehlt ein Startblock und außerdem ist der Junge nicht adäquat gekleidet: er trägt eine lange Hose und ein Shirt, ist aber nicht mit Schuhen, sondern lediglich mit Socken bekleidet.
Auch in dieser Darstellung kommt das Wettkampfmotiv zum Tragen, hier wird allerdings zusätzlich deutlich, dass der Läufer mit Anstrengungen konfrontiert wird, denen er scheinbar nicht ausweichen kann. Die Bücherstapel wurden vom Plenum überwiegend als Hürden gedeutet und deren unterschiedliche Höhe, als auch der Schriftzug „Portion“ deuteten darauf hin, dass die Bücherstapel als unterschiedlich einzuteilendes Arbeitspensum zu gelten haben. Der Schriftzug „Portion“ rief auch eine Assoziation mit Mahlzeiten bzw. dem Essen hervor, dem wurde aber nicht weiter nachgegangen. Die Bücherstapel wurden jedoch nicht nur als Hürden in einem Wettkampf interpretiert, sondern auch als Hindernisse allgemein, was im Schulkontext einen fragwürdigen Beigeschmack bekommt. Bücher als Hindernisse darzustellen kann nicht dazu beitragen, Schülerinnen und Schüler zum Lernen zu motivieren, die anfangs formulierte These der Verlogenheit und Wirklichkeitsferne bekommt hier neues Gewicht. Tatsächlich könnte man dem Gedanken verfallen, dass die hier gewählte Darstellung unfreiwillig ehrlicher war, als es sich die Verfasser gewünscht haben könnten.
Anstoß erregten auch die fehlenden Schuhe. Nach Meinung einiger aus dem Plenum sollte dies auf den Umstand hindeuten, dass es sich um eine Tätigkeit im häuslichen Rahmen handeln soll (Hausaufgaben). Von Herrn Wernet wurde diesbezüglich eingeworfen, dass es generell fraglich sei, wie sich die Schule in den privaten Rahmen von Schülerinnen und Schülern einmischt.
Bildanalyse Bild 3 und 4
Beide Illustrationen wurden aufgrund mangelnder Zeit nur kurz angerissen. Bild 3 zeigt ein leeres Zimmer und diente als Untergrund für die rechts davon abgebildeten Möbel, die schablonenartig im Zimmer angeordnet werden sollten, um eine „angenehme Arbeitsat-mosphäre“ zu schaffen. Bild 4 zeigt eine 24stündige Uhr, deren Verlauf die Tageszeit dar-stellen soll. Die Verfasser gaben hier drei Phasen vor, die jeweils mit einem Fragezeichen belegt sind und die Zeit darstellen sollen, die für Hausaufgaben genutzt werden soll.
Auffallend an beiden Abbildungen war der zuvor bereits erwähnte Eingriff in die Privatsphäre der Schülerinnen und Schüler. Nicht nur, dass hier vorgeschrieben wurde, wie das eigene Zimmer einzurichten sei, traf dabei auf Unverständnis. Mit keinem Wort ist zum Beispiel erwähnt worden, dass es sich dabei um ein Kinderzimmer handeln soll, vielmehr war durchgehend von einem Arbeitszimmer die Rede. Im Text dazu ging es demzufolge auch nicht um den Verbleib von Lieblings-CDs oder Comics, sondern um Arbeitsmaterialien und Schreibtischposition. Nicht geklärt wurde, wo sich die Comics denn befinden sollten.
Die Darstellung der 24stündigen Uhr sorgte grundsätzlich für Verwirrung, weil zuerst einmal nicht klar war, wie sie funktioniert. Als sich im Plenum ein Konsens dazu bildete, wurde nur noch festgestellt, dass es sich bei den einzuteilenden Zeiten für die Hausaufgaben um Bereiche des Nachmittags handelt, was nach dem Eingriff in die Gestaltung des „Arbeitsraumes“ vor allem einen Eingriff in die „freie“ Zeiteinteilung der Schülerinnen und Schüler darstellte.
Insgesamt waren alle Abbildungen in der Technik der Ausführung, in ihrer Aussagekraft und im Verhältnis zum Text mehr als fragwürdig. Es schien, so formulierte es Herr Wernet, als wären den Illustratoren zufällig ein paar Bilder untergekommen, die unbedingt in das Buch gepflanzt werden sollten. Anstatt durch unmissverständliche und wahrheitsgetreue Abbildungen einen Text zu illustrieren, sind hier uninspirierte Stempel aufgedrückt worden, die an den Verfassern des Schulbuches und ihren Absichten zweifeln lassen.
In den folgenden drei Minuten, die übrigens wie im Fluge vergehen werden, komme ich auf ein Modell zu sprechen, dass uns in besagter Vorlesung, von der ich vorgestern berichtete, vorgestellt wurde. Überhaupt habe ich den Eindruck, dass so ziemlich alles, was uns vorgestellt wird, darauf abzielt, uns den Beruf des Pädagogen auszureden. Mindestens einen großen Intellektuellen zitieren die Dozenten pro Veranstaltung, der gesagt hätte, dass der Lehrerberuf ein unmöglicher wäre. Dies beschränkt sich glücklicherweise auf den Bereich der Erziehungswissenschaften, meine beiden anderen Fächer haben nichts gegen meinen Berufswunsch, zweifeln dafür aber umso mehr an meinen fachlichen Qualitäten; zu recht, ich habe von nichts eine Ahnung.
Kommen wir zu dem Modell. Dieses Modell beschäftigt sich mit der tatsächlichen Unterrichtszeit und wie sich diese im Laufe eines Schuljahres, einer Unterrichtswoche, -stunde oder gar auf wenige Minuten verringern kann. Würde man sich dazu eine Sanduhr vorstellen, und sie auf die Seite mit der Füllung nach oben drehen und urplötzlich kein Sand nach unten rieseln, so wäre vielleicht nur das Gesetz der Schwerkraft gebrochen oder die Sanduhr möglicherweise im Inneren feucht geworden. Viel wahrscheinlicher ist jedoch, dass Sand rieselt. Befassen wir uns noch kurz mit dem Unmöglichen: nach Treiber, so hieß der Modellvater, verhält es sich mit der nominalen Unterrichtszeit wie mit dem Inhalt jener sonderbaren Sanduhr. Es gibt sie zwar, denn sie ist die Zeit, der im Stundenplan vorgeschriebenen Anzahl von Unterrichtsstunden im Schuljahr. Allerdings kommt sie fast nie zustande. Krankheit, Projektwochen, Exkursionen verringern diese, rieseln sozusagen durch eine kleine Öffnung im Glas nach unten.
Nachdem wir das nun geklärt haben, wenden wir uns wieder der funktionieren Sanduhr zu. Die ersten Krumen landeten bereits auf dem Boden des unteren Glaskolbens, als die zweite Spezifikation uns ereilt: die tatsächliche Unterrichtszeit. Das ist die Zeit, die nach Abzug aller Unwägbarkeiten übrig bleibt. Zu dieser Zeit fand der Unterricht tatsächlich statt. Leider ist auch diese Zeit längst nicht das Maß der Dinge, denn auch die Unterrichtsstunde selbst muss noch gegliedert werden. Da wäre die curricular genutzte Unterrichtszeit. Das ist die Zeitspanne einer Unterrichtsstunde die für zielgerichtete Lehr- und Lernvorgänge genutzt werden kann. Alle haben ihre Plätze eingenommen, das Klassenbuch ist geführt und niemand ruft „
Ein Igel!“
Die Sanduhr ist jetzt wahrscheinlich schon zur Hälfte leer, wenn Sie eine neben sich stehen hätten. Und leider kommt diese Zeit auch nicht wieder zu Ihnen zurück. Leider ist es auch mit der curricular genutzten Unterrichtzeit noch nicht zu Ende, denn wie ich oben bereits schrieb: diese Zeit
kann für Lehr- und Lernvorgänge genutzt werden, muss sie aber nicht. Wie oft passiert es uns, dass wir einem Gegenüber durch Nicken und Stirnrunzeln signalisieren, dass wir bei der Sache sind, während in unserem Kopf eine ähnliche Leere herrscht wie am Kopf des oberen Glaskolbens der Sanduhr. Wahrscheinlich kennt jeder dieses Problem. Durch kontextnahes Fragen könne ich dies herausfinden, so der Dozent. Jedenfalls bleibt am Ende die aktive Lernzeit des einzelnen Schülers übrig, die Zeit, in der sich mit lernstoffrelevanten Tätigkeiten beschäftigt wird.
Tja, das war also das Unterrichtszeitmodell nach Treiber. Am Ende bleiben ein paar Krumen übrig in unserer Sanduhr und damit sollen wir zukünftigen Lehrer dann einen Text behandeln oder ein Gedicht interpretieren lassen; unmöglich würde ich sagen.
Ich musste zuerst noch einen Absatz in einem furchtbar absurden Roman zu Ende lesen, weil ich ja nicht mitten im Satz weiterlesen kann. Ich sah hinab auf die Seitenzahl, versuchte sie mir einzuprägen. Deshalb verstand ich leider nicht, was der Dozent sagte, als er seine Stimme gegen das Gemurmel erhob. Es stellte sich allerdings eine erhebliche Senkung des Lärmpegels ein, so dass ich mindestens annehmen konnte, er redete von derselben bzw. wollte mit seinem Vortrag beginnen.
Mein Buch verstaute ich im Rucksack und sah nach oben auf die weiße Wand. Dort in der Mitte hockte bereits der Auswurf eines Projektors und verströmte einen Hauch von Langeweile. „Konstruktion von Notenskalen“ hieß die Überschrift und der Dozent wollte soeben mit seinem Vortrag beginnen, als plötzlich ein Haarschopf im unteren Bildteil seinen Schatten warf. „Ein Igel!“ rief ich und zeigte nach vorn.