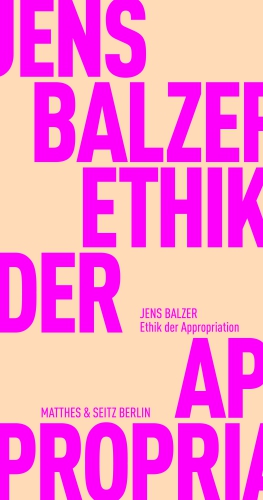Heute Morgen, kurz bevor ich das Haus verlassen wollte, nahm ich ein Buch aus meinem Regal. Ich weiß nicht warum ausgerechnet dieses, ich las darin. Es war ein schwarzer Einband, der Buchrücken zu dünn, um ihn zu beschriften und wüsste ich nicht, dass ich mich auf meine alphabetische Sortierung halbwegs verlassen kann, ich hätte niemals erahnen können, dass es sich um einen kleinen Band der Streichholzbriefe Umberto Ecos gehandelt hätte; Burkhardt Kröber, wie üblich, hat mir das Lesen erleichtert, indem er ins Deutsche übersetzt hat.
Nun beginnt dieses Buch damit, wie sich Eco über einen Glossenschreiber, bzw. die Glosse selbst, auslässt. Nicht unfein, durchaus als könne man teilen, was sowohl Eco als auch der Glossenschreiber gemeint haben. Mich interessierte daran auch nicht die Gimmickisierung (so nenne ich das, so nannte das nicht Eco) des Buches, darum ging es nämlich in der Glosse (ein Plastikbuch mit aufblasbarem Kissen, was man zum Schwimmen benutzen kann), sondern, wie Eco, um das Buch und seine Herstellung. Eco war fasziniert von dem Gedanken, welche Freude es machen könnte, ein Buch komplett auf Plastik zu drucken, aus Plastik bestehen zu lassen, man müsste Randnotizen einfügen können, das war noch so eine Bedingung. Und Eco hatte natürlich im Sinn, für die Ewigkeit zu konservieren; wie konnte es anders sein, er hatte auch sogleich ein Werk parat, dass er so festgehalten wissen wollte: Die Göttliche Komödie.
Ich hatte darüber hinaus noch die Idee, dieses Buch aus Recyclingmaterial herstellen zu lassen, mit eben jenen Eigenschaften, die Eco so vorschwebten. Nur ist mir Die Göttliche Komödie ehrlich gesagt zu sperrig, um sie auf Plastik zu drucken, daher wollte ich Euch, liebe Leser, fragen, welches Buch sollte gedruckt werden? Welches Buch hat denn die Qualitäten, nicht nur auf Plastik gedruckt zu werden und für die Ewigkeit zu halten (vielleicht irgendwann einmal im Stillen Ozean mit dem großen Strom des Plastikmülls zu schwimmen), sondern welches Buch wird auch gerne gelesen (nichts für ungut, an diejenigen, die gern Die göttliche Komödie lesen, ich habe mich eher durchkämpfen müssen und bin daran gescheitert)?
Ich möchte mit diesem Beitrag nicht weniger als eine neue Kategorie in meinem Blogkosmos einführen. Wie oft ich mich unflätig, ungehobelt, unpassend, also einfach unschön über Sachverhalte äußern werde, kann ich noch gar nicht sagen, es soll aber öfter vorkommen. Viel Spaß!
Lange genug hat es gedauert, dass der neue Hochbahnsteig vor dem Hauptgebäude der Leibniz-Universität, dem Welfenschloss, eingeweiht werden konnte. Doch pünktlich zum Semesterbeginn sind die Bauarbeiten abgeschlossen, und auf den weiträumig niedergetrampelten Rasen – man musste ja nicht selten Ausweichpfade einschlagen, um Baumaterial, -maschinen und -personal auszuweichen, das unvermittelt vor Einem auftauchte, für länger oder kürzer bereits festgetretenes Weggut versperrte und an Stellen, die nun weniger durch Fußgänger oder Radfahrer frequentiert wurden, die konsequente Grasabnutzung weiterführte – legt sich das fallende Laub der Linden wie eine Decke des Vergessens. Die Schuhe der Erstsemester, die in Erwartung einer feuchtfröhlichen Studiumseinführung auf dem Platz vor dem Schloss und weit darüber hinaus herumstehen, treten jetzt gerade den restlichen Rasen nieder, als wären sie die Genderbeauftragten der Schlosswiese, die besorgt festgestellt hatten, dass es noch Bereiche gab, wo das Gras grüner war als anderswo.
Aber was rege ich mich hier über den Rasen auf? Die heilige Kuh des Straßenverkehrs, der Fußgänger, der mir hier so unangenehm ins Auge sprang, wurde an gleicher Stelle auf das niederträchtigste diffamiert. Es reicht den hohen Herren der Stadtplanung nämlich nicht, die Gegend mit einem Hochbahnsteig zu verschandeln, sie sorgten darüber hinaus auch noch für eine Neuregelung des Verkehrs an dieser Stelle. Wo vorher zwei unscheinbare Zebrastreifen ihr Dasein fristeten und dem dahineilenden Studenten – entweder weil er zu spät zur Vorlesung kam oder weil er die Bahn nicht verpassen wollte – die Möglichkeit gab, sich unkonventionell mit dem Autofahrer zu einigen, dass er, der Fußgänger, im Recht sei, muss jetzt einen Schalter betätigen und eine Sparampel auslösen, die nur 2 Farben kennt.
Überhaupt ist blau – die beherrschende Farbe des Zebrastreifenhinweisschildes – aus verkehrstechnischer Sicht ein aussterbendes Gut auf Innerortens Straßen. Es wird zunehmend ersetzt durch Warnfarben, wahlweise komplett rot oder wenigstens mit rotem Rand. Die blauen Verkehrsschilder sind jetzt auf die Autobahnen umgezogen und künden dort von längst fälligen Abfahrten in einem Jahrhundertstau. Den Zebrastreifen, der übrigens in diesem Jahr, wahrscheinlich im März, seinen 60jährigen Geburtstag in Deutschland feierte, werden unsere Kinder vielleicht nur noch aus alten Kinderbüchern kennenlernen oder die Gefährlichkeit beim Überqueren desselben im Ausland erfahren. Auf Deutschlands Straßen hat man jedenfalls lange genug auf ihm herumgetrampelt, so ist mein Eindruck.
Doch warum rege ich mich denn über den verschwundenen Zebrastreifen auf? Weil diese Maßnahme den Fußgänger im Allgemeinen zu gängeln versucht, indem sie ihn zwingt, innenzuhalten und statt nur nach links und rechts zu schauen, vielleicht Blickkontakt mit einem heraneilenden Fahrzeughalter herzustellen, auch noch von ihm verlangt, sich einer Ampelschaltung unterzuordnen. Ich wäre längst nicht so entsetzt darüber, wenn es sich um eine Allerweltskreuzung handelte. Aber nein, dies ist eine ganz besondere Ampel. Hier entscheidet sich die Zukunft hunderter, wenn nicht tausender Studenten, ob sie sich auf dem Holzweg befinden oder mit voller Kraft voraus ins Berufsleben durchstarten können. Hier laufen die vereinigten Schicksale der Intelligenz von morgen zusammen, geben sich ein kurzes Stelldichein am Straßenrand, bevor sie dann in Richtung Straßenbahn oder Hörsaal verschwinden. Und wo doch der Student gemeinhin schon durch mäßig in Gang gesetzte Reformen gegängelt wird, er sich zusehends in einem Alltag wiederfindet, der absolut nichts mit „feuchtfröhlich“, sondern viel mehr mit der allseits verhassten Institution Schule gemein hat, da drückt ihm der Stadtplaner ein rotes Männchen aufs Auge, dem er sich vor Betreten der Universität ausgesetzt sieht. Rot, eine Warnfarbe allererster Güte! So, als wollte die Ampel bereits vom Studium abraten: „Geh da bloß nicht hin, die Zeit ist vergeudet!“ flüstert sie dem Studenten zu, der sich wegen einer Fristverlängerung mit dem Prüfungsamt auseinandersetzen muss, das hat seinen Sitz auch im Welfenschloss.
Deswegen rege ich mich auf. Und nicht nur deswegen. Sind Sie oder jemand anderes schon einmal mit einem Fahrrad an einer Fußgängerampel zum Stehen gekommen? Bestimmt. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass es in den meisten Fällen nötig ist, abzusteigen? Dass Sie dann den Gleichen Stellplatz verbrauchen, wie vier Fußgänger? Kennen Sie viele Studenten mit einem eigenen Auto? Die Parkplatzsituation ist ein ganz anderes Blatt, darauf möchte ich hier gar nicht eingehen. Worauf es mir ankam, war die Menge an Fußgängern und Radfahrern, die gemeinhin einen Weg frequentieren, der von der Universität weg- oder zu ihr hinführt. Diese Massen stehen eingepfercht zwischen Metallgittern, die ihnen vorschreiben, nur der minimalen Öffnung zu folgen, die zu der roten Ampel führt. Stellen Sie sich das Geschubse und Gedränge vor. Es ist völlig klar, dass wir der Massentierhaltung bereits völlig abgestumpft gegenüberstehen, wir werden ja selber so gehalten! Und am Ende des Ganges wartet die freundliche Dame aus dem Prüfungsamt und sagt: “Dafür sind Sie leider zu spät, eine Fristverlängerung ist jetzt nicht mehr möglich.“ Peng, Bolzenschussgerät.
Und wissen Sie, wie lang die sogenannte „Grünphase“ an dieser Fußgängerampel dauert? Es verlangt ja niemand, dass man dabei einen Grashalm beim Wachsen beobachten könne. Aber zumindest die andere Straßenseite sollte doch erreicht werden! Als Fußgänger mit mäßiger Geschwindigkeit, womöglich beim Gang nach Canossa, dem eigenen, dem letzten Versuch Abbitte zu leisten für eigenes Versäumen, da sollte doch vor dem Betreten der heiligen Hallen des Verwaltungsapparates der Universität, der befindet sich nämlich fast komplett im Welfenschloss, ein Stoßseufzer möglich sein, ein tiefes Einatmen, ein „ich nehme all meinen Mut zusammen“! Aber nein, dem Stadtplaner ist das völlig fremd. Der hat ja selber noch studiert, als Heinrich IV. fast von einem Fuhrwerk erfasst worden wäre, damals beim Besteigen des Hügels. Es geht hier ja auch gar nicht um Investitur, sondern um Immatrikulation, da ist man dem Wohl und Wehe ganz anderer Entitäten ausgesetzt. Unfehlbar, natürlich, geduldig muss man da sein, aber doch bitte schön nicht an der Ampel!
Sie verstehen den Widerspruch? Sie haben genug? Eines habe ich noch: Duisburg. Stellen Sie sich einmal vor, an der Ampel wird wegen technischer Probleme nicht auf Grün umgeschaltet. Die Straßenbahn klingelt im Rücken, die Fußgängermassen knuffen und puffen, eine oder mehrere Fahrradklingeln ertönen, direkt daneben hupt ein Auto böse und in dem ein oder anderen Studenten pocht ein Herz so laut, dass es an den Presslufthammer längst vergangener Zeiten erinnert, als hier noch eine friedliche Baustelle vor sich hinschlummerte. Wen würde es da wundern, wenn sich hier nicht eine Massenpanik entwickeln könnte. Diesmal ohne Musik, keine Feier, kein vermeintlich schöner Anlass, sondern eine schlichtweg hässliche Szene wäre das. „Gemetzel am Scheideweg“, ich sehe schon die Schlagzeile in der Bild. „Not-Zelte vor dem Welfenschloss, Rettungswagen, Sanitäter, Seelsorger im Einsatz, und die Verantwortlichen hüllen sich in Schweigen!“
Ich für meinen Teil werde diesen Überweg in Zukunft meiden, zu viel Beton, zu viele Schranken; in den Köpfen und auf den Wegen. Da bleibe ich doch besser gleich zu Hause und höre mir die Melodie in der Warteschleife der universitären Hotline für geplagte Studenten an. Das macht zwar müde, bringt mich aber wenigstens nicht um.
Aus der knappen Antwort auf eine Mail, in der es um hier nicht weiter Relevantes ging und deren Empfänger ich war, mich also demzufolge zu antworten genötigt sah, entwickelte sich eine kleine Odyssee durch den großen Garten der Floskelgewächse und ihren Hegern und Pflegern. Um auf eine nicht weniger knapp formulierte Frage zu antworten, nahm ich hilfesuchend, hilfefindend die Dienste folgender Floskel in Anspruch: „Nicht dass ich wüßte.“ Es nicht unbedingt meine Art, in Halbsätzen zu antworten, allerdings erschloss sich mir nicht, weshalb ich die gestellte Frage in der Antwort wiederholen müsste und ließ sie deshalb weg. Kein Problem, denke ich, wenn nicht mehrere Sachen gefragt werden und ein eindeutiger Bezug herzustellen ist.
Ins erste Stocken geriet ich deshalb, weil mir das „Nicht“ nicht aussagestark genug erschien, ihm eine Konjunktion mit doppeltem „s“ anzuhängen. Es war ein ganz kurzes Stocken, ich schwöre es. Auf das erste Stocken folgte sogleich ein zweites, das mich erneut innehalten ließ: „ß“ in wüßte“? Natürlich nicht, nur eine kleine Dissonanz im Gepräge. So etwas lässt sich schnell reparieren. Doch dann, dann traf es mich wie ein Donnerschlag. Ich war ratlos, benötigte einen neuen Tab und begann mit der Recherche. Ich begann in die Googlesuchzeile einzutippen: „nicht dass…“ und wurde prompt vervollständigt auf: „nicht dass Rotlichtmilieu“, haha kleiner Witz am Rande, nein, es war: „nicht dass ich wüsste komma“. Komma? Hatte ich ein Komma vergessen? War mir hier ein gehöriger Schnitzer unterlaufen, indem ich auf mein liebstes Satzzeichen verzichtet hatte?
Das war mir noch nie passiert. In der Schule habe ich immer, wenn ich mir um den Einsatz eines Kommas nicht sicher war, einen klitzekleinen Strich gemacht, den man durchaus übersehen könnte, wenn er dort nicht hingehört, den man aber wahrnimmt, wenn es so sein muss. Noch heute bin ich Verfechter vieler Kommas. Ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, ein „weil“ mit Kommas zu umzäunen, wenn darauf ein Hauptsatz folgte, weil, die Pause im mündlichen Vortrag ( der Hauptsatz, eingeleitet von "weil", ist im Mündlichen schon längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen ) kann nur so ihre volle Wirkung im Lesefluss erhalten!
Ungläubig rief ich die Einträge auf und wurde sogleich beruhigt, es handelt sich nur dann um ein notwendiges Komma, wenn eine Ellipse vorliegt, aus dem „nicht“ ein ganzer Satz gemacht werden könne à la „Es ist nicht so, dass es mich behindert, es verlangsamt mich nur.“ Es verlangsamte mein Schreiben tatsächlich soweit, dass ich, wenn ich den ganzen Sachverhalt ausgeschrieben hätte, oder auf die Floskel verzichtet hätte, wesentlich schneller fertig geworden wäre. Wahrscheinlich wäre dann kein „Halbsatz“ entstanden, wie er im Mündlichen durchaus üblich, im Schriftlichen jedoch nicht üblich ist. Ich hätte in korrektem Deutsch eine sinnvolle, verständliche Antwort abgegeben. Ich hätte mir nicht den Kopf zerbrechen müssen, ob ein „davon“ im Satz „Nicht, dass ich davon wüsste“ ein Komma evoziert, weil ich mich auf die schiefe Bahn der Elliptik eingelassen hätte. Ich wäre eilends zur nächsten Email gehuscht, um auch dort knapp und präzise zu antworten. Dieser Text wäre nicht entstanden.
Die schöne Zeit, vertan für eine Floskel. Wenn Sie also demnächst auf eine E-Mail antworten, hüten Sie sich vor dem Einsatz von Floskeln, es könnte Ihr Leben verkürzen.
Wieder einmal muss ich mit einem alten Vorurteil aufräumen und der deutschen Sprache ein streng gehütetes Geheimnis entreißen. Allerdings muss ich, wie so oft, darauf verzichten, einen Schuldigen zu benennen, denn die Geschichte der Sprachen reicht schon länger zurück als mein etymologisches Wörterbuch überhaupt erfassen kann. Im Zuge der Sortierung des Wissens über die Sprache im Allgemeinen und des Deutschen im Besonderen ist es dann auch nicht weiter verwunderlich, wenn bestimmte Phänomene, obschon ziemlich offensichtlich, einfach „unter den Teppich“ gekehrt werden können. Sieger schreiben ja bekanntlich die Geschichte.
Worum es mir diesmal geht, ist das allseits beliebte Wort Meinung. Die Meinung, die sich dem Duden nach, aus dem Wort meinen entwickelte und auf das ahd. meinan zurückgeht, hat im Gegensatz zu den meisten Vokabeln des Deutschen – und hier sei angemerkt: aus mir völlig unverständlichen Gründen – beiden Lautverschiebungen getrotzt. Natürlich ist das engl. mean mit dem Wort meinen verwandt und auch das kelt. mían ist laut etymologischem Wörterbuch eine der Wurzeln, allerdings wird mit dieser offensichtlichen Herkunftstheorie nur verschleiert, was im Verborgenen bleiben soll: die Verwandtschaft mit dem Possessivpronomen mein. Das Possessivpronomen ist im Deutschen sowieso eins der am strengsten gehüteten Geheimnisse. Nichts ist so schwer zu ermitteln wie die Herkunft von mein. Weder unter dem Begriffsfamilie der Possessiva nebst seinen kompositorischen Partnern noch unter den Personalpronomen wie zum Beispiel unter ich finden sich Hinweise auf seine Herkunft.
Warum ist das so? Ganz einfach: Besitz ist schon immer ein knappes Gut gewesen und seit dem Aufkommen erster gutsaufwertender, gewinnbringender Bestrebungen, ist eine kleine, tonangebende Menge von Leuten – ich vermeide hier bewusst die von Theoretikern des Kapitalismus beanspruchten Vokabeln, weil der Kapitalismus viel älter ist, als seine Definition – nicht nur an dem Verteilen des Besitzes verantwortlich, sondern darüber hinaus auch mächtig genug, das Wissen um seinen Ursprung zu verschleiern. Das mein aus Meinung meint eben nicht meinen Besitz, es meint unseren Anspruch auf Besitz, der sich schlichtweg, über Jahrtausende hinweg, nur in unseren Köpfen abspielte. Wir durften nämlich alles denken, aber längst nicht alles sagen. Heute sind wir, nachdem die Tölpel der Revolutionen seit 1789 kontinuierlich über den Tisch gezogen worden sind, glückliche Besitzer des Rechts der freien Meinung in unseren Gedanken und in der sprachlichen Äußerung, was uns, ehrlich gesagt, nicht viel weiter gebracht hat, als dass jetzt alles durcheinander quasselt und unsere Meinung zwar nicht mehr bestraft werden kann aber weiterhin keine Beachtung findet.
Mit dem Aufkommen der freien Meinungsäußerung wurde das Volk also ein weiteres Mal entmündigt. An gewinnbringendem Besitz weiterhin größtenteils unbeteiligt, wurde die Meinung zuerst entpossessiviert – man beachte zum Beispiel die vielzitierte Redensart unseres Altbundeskanzlers: „Was interessiert mich mein Geschwätz(!) von Gestern?“ – und später auch noch marginalisiert ( Außenminister Radoslaw Sikorski über die Wahl einer Spitze in Europarat und Europakommission in FAZ vom 03.09.2012: „Diese Person sollte gewählt werden - entweder vom Europaparlament oder vom europäischen Publikum(!).“ ). Und um dies auch schriftlich zu zementieren, wurde auf die Darstellung der Verwandtschaft von Meinung, bestehend aus meinen und dem Vorgangssuffix –ung, und dem Possessivpronomen mein gänzlich verzichtet.
Um nun beiden Prozessen, der Entpossessivierung und der Marginalisierung, entgegenzuwirken, ist es notwendig auf sprachlicher Ebene anzufangen und den „status quo“ wiederherzustellen. Mein Vorschlag lautet deshalb, sinnlose, marginalisierende, ja inflationäre Dopplungen wie „meine Meinung“ zu unterbinden, denn es stellt die einerseits immense Wichtigkeit des Gutes Meinung wieder her, und darüber hinaus, um auch der Entpossessivierung ein Schnippchen zu schlagen, die Meinung wieder zuordenbar zu machen, indem das Substantiv Meinung um die Substantive Deinung, Seinung, Ihrung usw. erweitert wird, die gleichbedeutend aber eindeutiger zuzuordnen sind. Ich fange gleich damit an und ende mit den Worten: Das ist Meinung! Ich bitte um Ihrung!
Frühstücksei. Das ist ein Wort, das kann mein Sohn noch nicht sagen. Er verlässt sich darauf, dass wir die letzte Silbe verstehen und ihm zu gegebener Zeit ein solches präsentieren. Die Zeit, zu der das passiert, ist immer sonntags. Und sobald wir beide vom Bäcker kommen und die Küche betreten haben, in der gerade ein Ei von meiner Frau abgepellt wird, ertönt der Ruf eines furchtbar seltsamen Vogels. Es klingt ein wenig nach den Möwen aus „Findet Nemo“, die stets und ständig „meins?“ rufen. Nur sein Ruf ist noch kürzer und bezieht sich direkt auf das dampfende weiße Ding, was gerade von der Küchenarbeitsplatte zum Frühstückstisch wandert: „Ei? Ei? Ei?“, dabei wird heftig mit dem Finger gezeigt und am Kinderstuhl geruckelt. „Jetzt setz mich doch, verdammt nochmal, endlich in den Sitz und gib mir das Ding da rüber!“ Das wäre mein Übersetzungsvorschlag für die lautstarke und gestenreiche Darbietung.
Ich wäre wahrscheinlich nicht der Vater unseres Sohnes, wenn ich nicht wüsste, dass ich als kleiner Junge nicht anders gewesen bin. Ich vermute, es gibt für jedes Kind in einem bestimmten Alter eine bestimmte Köstlichkeit, die alles zuvor Gelernte vergessen lässt und unter Aufbietung allen Vokabulars, aller Gestik und Mimik, und alles total durcheinander, einen Wunsch – nein, einen Willen! – formulieren lässt, den Eltern offensichtlich trotz aller sonstigen Verständigungsprobleme eindeutig identifizieren können.
„Ei?“, das kennen auch meine Eltern noch. Ich war ein Frühstückseiliebhaber besonderer Art. Ich war zuerst kein Gourmet in Sachen Frühstücksei, ich verschlang sie alle. „Alle?“, ruft mein Sohn Fiete dann, wenn ich ihm verständlich gemacht habe, dass er sein Ei restlos verputzt hat. Und dann schaut er auf mein Frühstücksei, zeigt darauf und ruft wieder: „Ei? Ei? Ei?“ Gestern habe ich mein Ei hinter einer Phalanx aus Kaffeetasse, Zuckerstreuer und Marmeladenglas versteckt, mein antifietestischer Schutzwall, das stimmte Fiete etwas ratlos, brachte ihn aber immerhin dazu, noch etwas anderes zu essen, außer die Eier von allen anderen, die am Frühstückstisch saßen. Meins war außer Sicht und das meiner Frau ist sowieso bereits nach Verzehr von zwei Brötchenhälften passé.
Früher verschlang ich mein Ei auch deshalb, weil ich zwei Geschwister habe. Ich verschlang einfach alles in wahnsinniger Geschwindigkeit. Gab es einen Nachschlag, so war ich mit meinem ersten Teller bereits fertig, bevor meine Mutter allen anderen aufgetan hatte. Das ging mit den meisten Dingen so, bis heute. Viel und schnell. Nur beim Ei, da wandelte sich mein Verhalten irgendwann als kleines Kind.
Ich war bereits so alt, dass ich wusste, wie man einen Löffel bedient, ich konnte mir mein Brötchen selbst schmieren – Butter, Salz und Pfeffer, etwas anderes esse ich heute noch nicht zum Ei – und ich habe irgendwann begriffen, dass es nur eine ganz bestimmte Zeit des Eiüberflusses gibt, nämlich Ostern, und ich mich sonst mit nur einem Ei zufriedengeben muss. Als ich das begriffen hatte, wandelte sich mein Verhältnis zum Frühstücksei grundlegend. Ich aß plötzlich mit Bedacht. Ein klitzekleiner Löffel portionierte das Ei zu immer kleineren Happen, die parallel zum Biss vom Brötchen in die Luke geschoben wurden. Ich konnte so bis zu drei Brötchen, also 6 Hälften, mit nur einem Ei essen. Grundlegend hat sich mein Essverhalten demnach nicht geändert, was meinen Vater also weiterhin den Kopf schütteln ließ, nur mit dem Ei ging ich plötzlich anders um.
Wenn Fiete, unser Sohn, demnächst eine Schwester bekommt, und diese nach geraumer Zeit ein eigenes Ei zum Frühstück – also in ca. 2 Jahren wahrscheinlich – wird er sich sein Brötchen selbst schmieren können. Dann wird er einen Eierbecher bekommen, das gleiche Format übrigens, wie die Eierbecher, die meine Eltern früher besaßen und wir heute noch besitzen – ich schätze fast jeder Haushalt der DDR verfügte über diesen Eierbechertyp der
„tausend kleinen Dinge“, ein Gockel aus Plaste, einfarbig gelb, rot, blau oder grün – und er wird sich sein ganz persönliches Ei einteilen können, wie er will, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Mit Verwunderung stellte Trithemius fest, dass er sich nicht erklären könne, wie ein Hemd in dieser Größe wohl aussähe: XXXXL. Das Hemd in seiner Größe kostete seinerzeit wesentlich mehr, als ein Hemd in dieser Größe kurz vor der Schließung des Geschäfts. Geschlossen ist es jetzt deshalb, weil renoviert wird. Neue Fenster, neue Oberlichter, wahrscheinlich auch ein völlig neues Innenleben wurde in dem Laden neben unserem Kaffeestübchen konzipiert und jetzt befindet sich eine Schreinerfirma in der Ausführung der Pläne.
XXXXL. Stünde jedes dieser iXe für einen Arbeitsschritt, so könnte man sich ein ungefähres Bild von einem Unterfangen wie dem Umbau eines Ladengeschäfts machen. Läse man den
aktuellen Text von Trithemius, würde man sich bewusst machen können, welche Arbeitsschritte nötig waren und heute nötig sind, um einen Text „auf Papier“ zu bringen. Wir bringen aber heute kaum noch etwas zu Papier. Der Text entsteht an einem Computer, an dem eine Tastatur hängt, auf dem eine Standardtastatur abgedruckt ist, die es uns ermöglicht, in einheitlicher Schriftgröße vor uns hin zu tippen. Wir haben unser Arbeitsmittel vertauscht – manchmal. Wir haben dem Prozess des Schreibens viele kleine Prozesse beigefügt. Wo vorher eine Papiermühle, ein Bleistiftmacher vonnöten war, nebst Lehrer, der einem das Schreiben beibrachte, zuletzt einen Schreiber und eventuell einen Leser als Letzten in der Kette eines Prozesses, der nichts weiter wollte, als mitzuteilen, sind es heute viel mehr iXe, die dazu nötig sind, um nichts mehr als das Gleiche zu erreichen: mitzuteilen. Wir benötigen dazu weiterhin all diese Dinge, sollten wir, wie ich zum Beispiel, nach wie vor ein Notizbuch mit uns führen. Wir benötigen aber auch die Industrie zur Herstellung von Tastaturen, Prozessoren, Monitoren, Computermäusen und nicht zuletzt auch die Programmierer, die dafür sorgen, dass unsere Eingabe auch dem entspricht, was wir wollen: eine von Vielen lesbare Mitteilung.
Wir unterhielten uns aber nicht nur über die Mittel zur Ausführung des Schreibprozesses, sondern auch darüber, was mit uns dabei passiert. Früher benötigten wir dazu eine Kerze oder nicht, je nach Tagesfortschritt, einen Arm, eine funktionierende Hand und ein Auge, meistens zwei, und natürlich das ein oder andere Hirnareal, welches, angeregt durch unser Tun, Synapsen zum Arbeiten brachte. Natürlich könnte diese hohe Form der Konzentration auf einen so schlichten Vorgang wie dem Abfassen einer Nachricht ein Gut sein, dass wir in heutiger Zeit vermissen. Gerade weil es aber Leute gibt ( den
hier zum Beispiel ), die das in aberwitzigen Studien, ganzen Buchreihen, ach was sage ich: ganzen Bibliotheken, zu beweisen versuchen, kommt der vernünftige Mensch nicht um die Frage herum: Ist das jetzt gut oder schlecht?
Nicht weniger Konzentration ist übrigens nötig, um als ungeübter oder geübter ( eigentlich ist das sogar völlig egal ) Tastenklimperer den Fortschritt des Textes sicherzustellen, seine Botschaft klar und unmissverständlich herauszuarbeiten, als es beim Schreiben von Hand nötig ist. Man denke nur, an die vielen Blicke, die es erfordert, Einheit zwischen Gedachtem und Geschriebenem herzustellen, eventuelle Rechtschreibfehler oder Tippfehler auszumerzen. Man bedenke nur die Komplexität der Bewegung einer Extremität beim handschriftlichen Abfassen und dem computergestützten Schreiben, bei dem womöglich zwei Arme zu steuern sind. Auch hier sind also ein paar iXe hinzugekommen, deren einzige messbaren Konstanten Hirnareale darstellen, die wir glauben komplett erforscht zu haben und die scheinbar in ihrer Aktivität leiden, wenn wir von dem Einen lassen und das Andere bevorzugen. Deshalb sind Computer per se schlecht und die Handschrift ein Gut, das es zu pflegen gilt.
Was also alle Schreibprozesse gemeinsam haben, ist das sinnlose oder sinnvolle – je nach Betrachter – Aufblähen eines oder mehrerer Vorgänge, die nur einem Zweck dienen: sich mitzuteilen. Ich sagte zu Trithemius, dass der Herr, der draußen an einem der Tische saß, ein XXXXL-Hemd trug, weil er über einen Körperumfang verfügte, in dem wir beide gleichzeitig Platz hätten. Doch nur weil ich die Größe kenne/vermute, heißt das noch lange nicht, dass seine iXe aus einer schlechtlaufenden Schilddrüse herrühren oder er nicht in jeder Jackentasche ein Arsenal aus Schokoriegeln mit sich führt. Und zu beurteilen, was daran gut oder schlecht ist, das maße ich mir schon gar nicht an.
Als ich die fünf da so sitzen sah, war mir sofort klar, dass da irgendwas nicht stimmen konnte. Bester Laune, mit einem kleinen elektrischen Spielzeug ausgestattet, aus dem der Klang eines dunklen, vor Stroboskopen nur so wimmelnden Kellers erscholl, lungerten vier auf der Decke und eine saß am Wasser und schaute auf ihr Handy. In angeregter Unterhaltung spritzten die vier wie eine Horde Wassertropfen in einer Zentrifuge um sich selbst. Standen auf, setzten sich wieder, nahmen ungelenk und körperbetont Haltungen ein, die jedem Orthopäden ein Schauergewitter über den Rücken gejagt hätte; da wurden Beine übereinander geschlagen, und zurück, ausgetreckt, abgeknickt, Wirbel verbogen und Hälse gerenkt.
Über allem schwebte eine Affektiertheit, eine kleine angelegentliche Künstlichkeit aus Sonnenbrillenblick und Schnatterwahn, die ich zu unterbrechen bereit war. Zuerst holte ich ein paar Holzklappstühle und lauschte von Ferne. Dann ging ich direkt hin und erbat mir, dass die „Fremdgetränke“ wenigstens im Rucksack zu verschwinden hätten, schließlich wollten wir hier am Strandleben unseren „richtigen“ Gästen unsere Getränke verkaufen. Das sei ja überhaupt kein Problem, und überhaupt wussten sie ja auch gar nicht, dass wir heute auf hätten. Und in der Tat, es sah in diesem Moment so sehr nach Regen aus, dass ich geneigt war, den Arbeitstag noch vor seinem Beginn wieder abzusagen. Ich blieb; stellte den 5 Wasservampiren sogar noch einen Ascher hin, wofür sie sich wieder recht überschwänglich bedankten – wie zuvor schon über meine Nichtvertreibung aus ihrem Paradies. Ich hätte sie wahrscheinlich vertreiben müssen. Sie konsumierten nichts, hatten nur Wasserflaschen und ein geheimes Depot, um die ständige Marschierbereitschaft gewährleisten zu können, sie aßen nichts, jedenfalls nichts von uns und überhaupt war die abgespielte – leise – Musik und ihr Verhalten alles andere als normal. Aber sie taten keinem weh, keine Menschenseele war sonst zu sehen.
Als ich vor Jahren am
Adolf-Mittag-See einen Aushilfsjob als Bootjunge hatte, mussten wir, nachdem wir mit dem Aufbau des Vorplatzes ( wir stellten Gartenzwerge auf, Blumen mussten gegossen werden, es wurde geharkt usw. ) fertig und die Boote alle mit Riemen ausgestattet waren, eine Runde auf dem See fahren. Wir arbeiteten immer zu zweit, ein Kumpel und ich. Die Runde auf dem See – jeder in einem extra Boot – diente einzig und allein dem Zweck, dass alle umliegenden Zuschauer, Spaziergänger und sonstige Aufenthalter im Park, wo der See lag, wussten: jetzt ist der Bootsverleih geöffnet, kommt her und leiht euch ein Boot für eine Stunde! Rudert herum, wir helfen euch ins Boot und wieder hinaus, es gibt Schlager aus dem Radio und einen flotten Spruch vom Chef! Ihr wollt nur eine halbe Stunde? Klar, kein Problem, rudert seinetwegen nur 10 Minuten, kostet immer das Gleiche! Ist das nicht super? Und da soll ich die einzigen Zeugen für die Inbetriebnahme der Strandbar vertreiben? Die letzten Reste einer versprengten, verfeierten Nacht, eines ganzen Wochenendes womöglich? Nee, das mache ich nicht. Und dann kam einer von denen hoch zu uns an den Tresen, riss sich sichtlich zusammen und beschloss, einen Kaffee zu bestellen. Bekam er auch. Eine schwarze, heiße Brühe in einer weißen Tasse. Sein unsteter Blick, seine zwei Kaffeetassen, die er im Gesicht trug, brauchten wohl eine Auffrischung.
Als wir, nachdem doch tatsächlich noch 6 Gäste kamen, endlich schließen wollten, saßen die fünf immer noch da. Sie zappelten und rauschten, als gehörten sie zum Blätterwerk der Birke, unter der sie saßen. Wie wir uns begrüßt hatten, so gingen wir wieder und überließen den aufgeregten Strandwachen das Feld. Das war’s wohl mit der Saison, dieses Jahr. Keine Schicht mehr für mich. Bald wird alles abgebaut, eingelagert und auf den Frühling verwiesen, der wohl zu kommen scheint, irgendwann.
Morgens zu duschen ist eine verquere Angelegenheit, verquer, weil dieses Ritual den Zweck zu haben scheint, den Dreck des Schlafes abzuwaschen. Angelegenheit, weil es nicht ohne einen selbst stattfinden kann: es geht eben etwas an. Morgens aus dem Bett zu steigen, die Dusche zu suchen, frische Klamotten daneben legen, den Wasserhahn anstellen, warten bis es warm wird.
Halt, was ist das jetzt schon wieder? Da kriecht dir ein eiskalter Strahl ins Gesicht, obwohl du noch gar nicht unter der Dusche stehst. Ins Auge womöglich und dir wird bewusst, welcher Teil der Dusche beim Saubermachen ausgelassen wurde. Die zugekalkten Löcher der Dusche, die sich wie deine eigenen Augen um sechs Uhr morgens nur mühsam öffnen und quer gucken, statt ihrer gerichteten Tätigkeit nachzugehen, sie schießen ins Bad, ins Kraut, Tropfen herab, rieseln herunter und quälen mit Eiseskälte. Der Arm geht nur langsam zum Brausekopf, dreht ihn.
Besser jetzt. Ich steige unter die Dusche, verrichte allerlei Dinge dort und komme wieder hervor, triefend nass und immer noch nicht wach. Das Handtuch trocknet, die Wäsche wärmt hoffentlich gleich. Die Socken – im Stehen angezogen – erinnern mich daran, dass ich nachzulassen scheine. Der geöffnete Sockenkopf, von gespreizten Fingern offen gehalten, zieht sich nicht mehr von selbst über den Fuß. Das angezogene Knie hoffte in seiner morgendlichen Schwäche auf Hilfe von den unbenutzten Fingern der Hände, die – einerseits den Strumpf offen halten und andererseits an den Zehen zu ziehen beginnen, um die Entfernung zwischen Sockenkopf und Zeh zu reduzieren. Das Knie bekommt diese Hilfe ein ums andere Mal, verstolpert und versteinert steig ich in die Socken, die Hose folgt.
Erhebung, kein erhebendes Gefühl beschleicht einen, wenn die Senkrechte gewonnen wird, ein Blick in den Spiegel und raus aus dem Bad, ein viel zu heller Ort; für jede Zeit.