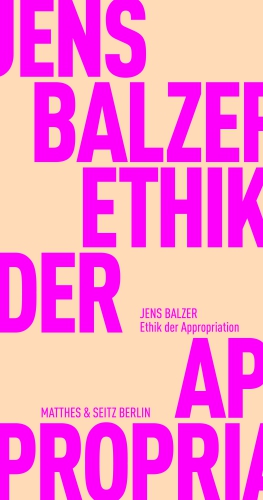Einen Magnethelm findet man nicht auf dem Schrottplatz. Was für Gründe das hat, kann ich leider nicht sagen. Genauso wenig möchte ich hier davon sprechen, wozu so ein Magnethelm überhaupt taugt. Eine simple Suche bei Google kann hier schon so viele unterschiedliche Ergebnisse zeitigen, dass einem angst und bange wird. Stellen wir also einfach fest, Sie brauchen einen Magnethelm und wissen nicht, woher das Utensil kommen soll. Dabei möchte ich Abhilfe schaffen:
Sie nehmen einen Metalldetektor und fahren die Wände der eigenen Wohnung ab. Meistens finden sich in senkrechter Anordnung sogenannte Magnetlinien, die es, nachdem sie vom Detektor gefunden wurden, zu markieren gilt. Ein wasserfester Filzschreiber sollte deshalb bereit liegen, mit dem Sie in einem Abstand von ca. 2 cm zum gefundenen Objekt jeweils rechts und links eine Linie einzeichnen. Mit einer Mauernutfräse, die man sich in jedem größeren Baumarkt günstig ausleihen kann, werden die so markierten Wände aufgeschlitzt. In der von Putz befreiten Rille offenbart sich ein hoffentlich intakter Kupferdraht in Plastikummantelung. Diesen entnehmen Sie und befreien ihn von seiner Hülle. Den Draht wickeln Sie um ein Straußenei, bis die obere Hälfte komplett von Draht bedeckt ist. Das Straußenei haben Sie natürlich vorher in einem Schraubstock arretiert. Als Bommel empfehle ich, aus den Plastikresten einen Klumpen zu formen, notfalls unter Einsatz geringer Hitze. Das Praktische ist, die Plastikreste müssen nicht extra besorgt werden, die fallen sowieso an.
Mit dem fertigen Helm gehen Sie dann zum Nachbarn ihres Vertrauens. Vielleicht empfiehlt es sich, eher nicht zum Nachbarn Ihres Vertrauens zu gehen, weil dieser aufgrund des guten Verhältnisses zu Ihnen längst über Ihre Pläne informiert ist und selber gerade einen solchen Helm bastelt. Gehen Sie also besser zu jemanden, den Sie eher nicht so gut leiden können. Dort kann der Helm an das hoffentlich noch intakte Stromnetz angeschlossen werden. Der Helm hat volle Funktionalität erreicht, sobald die Plastikbommel zu schmelzen beginnt und an den Seiten der Kopfbedeckung herunterläuft. Die hierbei zu beobachtende Verschlackung und auch die gewaltige Stromrechnung am Ende des Quartals sind für Sie übrigens nicht mehr von Belang, Ihr Nachbar kann sich aber ein paar wertvolle Notizen dazu machen.
P.S. Achso, das hätte ich fast vergessen, ein Straußenei kann man günstig bei Amazon bestellen.
Leider war ich heute Morgen auf der "falschen" Straßenseite unterwegs, denn mir bot sich ein wirklich grotesker Anblick. Eigentlich bot sich mir dieser Anblick gerade deswegen, weil ich auf der falschen Straßenseite unterwegs war, weshalb ich mich durchaus fragen könnte, was denn nun eigentlich zuerst da war. Und drehte sich diese Episode nicht so herrlich um sich selbst, wäre sie auch keine Erwähnung wert gewesen, aber ich sollte nun wirklich davon anfangen, sonst ist nachher alles schon verraten, bevor ich überhaupt dazu kommen konnte, sie zu erzählen.
Ich ging also heute Morgen gegen kurz vor 8 aus dem Haus und mir bot sich ein völlig normales Bild. Mein Sohn, dessentwegen ich überhaupt das Haus verließ – er wurde von mir zur Kita chauffiert – sang ein mit der allseits bekannten Melodie unterlegtes, lautes „Tatütata“ und ich, in Erwartung einer Sirene, spitze die Ohren. Die Augen hätte ich richten sollen, denn sein Ton galt einem stummen Martinshorn, einem ausgeschalteten Blaulicht auf dem Dach eines T4 auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Das Polizeiauto stand direkt in der Ausfahrt einer Kreuzung, versperrte sowohl den abgesenkten Bordstein des Fußweges als auch die Einmündung der Straße. Mit dem Kinderwagen, wäre ich auf dieser Straßenseite unterwegs gewesen, hätte ich einen großen Umweg in Kauf nehmen müssen, um daran vorbei zu manövrieren. Da ich aber auf der „richtigen“ Straßenseite ging, war alles kein Problem. Schaulustig besah ich mir also das Treiben der beiden Beamten. Eine Polizistin saß mit einem Gerät bewaffnet auf dem Beifahrersitz und tippte darauf herum, während ihr Kollege in der offenen Tür stand und seine Hand bereithielt. Sogleich entsprang dem Gerät ein Zettel, dieser, vom Polizisten abgerissen, wanderte von der Hand getragen zur gegenüberliegenden Einmündung der eben beschriebenen Straße und wurde dort an einem roten Fahrzeug befestigt.
Das rote Fahrzeug nämlich, parkte so dicht an der Kreuzung, dass sowohl die Einfahrt in die Kreuzungseinmündung für andere Autos als auch die Benutzung des abgesenkten Bordsteins für Fußgänger maßgeblich erschwert wurde. Ich habe mich nicht getraut, einen Zettel aus meinem Notizbuch zu reißen und den beiden Polizisten ans Auto zu heften, weil sie die Straße und den Fußweg versperrten. Ob sie es mit Humor genommen hätten, das habe ich mich trotzdem gefragt.
Die Raumbelastung an unserer Uni hat sich dermaßen zugespitzt, dass ich eine Vorlesung zur Psychologie in einem Hörsaal der Mathematiker und Physiker besuchen muss. Das heißt, ich muss nicht, es gibt keine Anwesenheitsliste mehr ( also nach den ersten zwei Sitzungen ) und auf die Klausur könnte ich auch verzichten, wenn ich stattdessen anderswo eine Hausarbeit schreibe. Trotzdem bin ich am Dienstag wieder dort gewesen. War interessant, dazu später mehr.
Aus der Zumutung in der ersten Sitzung – wir waren ca. 200 Leute – ist eine erträgliche Anzahl von ca. 100 Studenten geworden. Das eigentliche Problem liegt ja auch nicht in der Anzahl der Studenten, es passen immerhin bis zu 300 in den Saal hinein. Nein, das Problem ist, dass der Raum über kein einziges Fenster, demzufolge über kein Tageslicht, keine Frischluft von draußen verfügt. Außerdem endet die Veranstaltung vor unserer Veranstaltung um Punkt 14:30 Uhr,
s.t. Man munkelt, dass die Veranstaltung vor dieser Veranstaltung, die bei einer Dauer von 1,5 h um 12.00 Uhr, s.t., beginnen würde, um 12:00 Uhr, s.t., endet. Weiterhin habe ich gehört, dass es noch zwei Veranstaltungen davor geben soll, bei denen der nahtlose Übergang exakt auf die gleiche Weise erfolgt wie bei der gemutmaßten und dem tatsächlichen Wechsel zu unserer Vorlesung. Was ich außerdem noch mit Gewissheit sagen kann: die auf unsere Vorlesung folgende Veranstaltung beginnt ebenfalls exakt um 16:00 Uhr, s.t. Man möchte vielleicht nicht aber man könnte sich aus dieser Schilderung ein ungefähres Bild vom Zustand der geruchlichen Belastung machen, es sind zwar andere Düfte aber für mehrere Stunden auf dem Mittelstreifen einer Schnellstraße zu verbringen hat ähnliche Wirkungen.
In der letzten Sitzung offenbarte sich ein weiteres Problem, keines was mich direkt betraf, aber es führte an anderer Stelle zu Verstimmungen. Der Inhalt der Vorlesung „Allgemeine Psychologie“, so die Vermutung, ist ein Abriss der Geschichte, ein Abriss in Methoden, kurz: ein kurzer Überblick über alle fachrelevanten Themen in der Psychologie. Was man nicht unbedingt vermutet, sind Ausflüge in die Physik, auch wenn der Hörsaal hauptsächlich für Veranstaltungen der Mathematiker, Ingenieure und Physiker genutzt wird. Es ging dabei auch nicht um ein simples Beispiel an irgendeiner nebensächlichen Stelle. Es ging um die keplerschen Gesetze. Um alle. Mehrere Folien (Powerpoint) lang, erstreckte sich dieser Ausflug, den Zusammenhang habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Dafür habe ich alle drei Gesetze verstanden. Ich weiß jetzt sogar, was eine
Parallaxe ist, und weshalb das die Beobachtung und Ableitung dieser Gesetze so schwer gemacht haben muss. Ein immenser Aufwand, kann ich nur sagen. Deshalb will ich jetzt auch einmal etwas formulieren, ganz im Sinne der Psychologie. Leider hat das keine allgemeine Gültigkeit, aber es liefert Hinweise auf bestimmte Korrelationen:
Umso mehr Studenten sich im Rahmen des Studiums in geschlossenen Räumen aufhalten, desto größer ist die Zahl derer, die plötzlich merken, dass sie in der falschen Veranstaltung sitzen.
Wenn dann in einem Raum, der größtenteils der Mathematik und Physik vorbehalten ist, eine Psychologievorlesung gehalten wird, in der es zu 50% um die keplerschen Gesetze geht, sitzen Zuspätkommer längst, bis sie gemerkt haben, dass sie hier falsch sind. Was im Kino schon nervt, ist im Hörsaal noch schlimmer, denn die Sitze sind nicht bequem und der Abstand zum Vordermann reicht aus, um jedem Friseur ohne Anstrengung ins Handwerk zu pfuschen. Man kann nicht einmal ein zufällig ausgefallenes Haar von den eigenen Aufzeichnungen pusten, ohne das der Vordermann oder die Vorderfrau davon Wind bekommt.
Da saß ich nun, neben, hinter und vor mir laufen die ganze Zeit verwirrte Studenten entlang, weil sie plötzlich merken, das Oppenheim kein Physiker ist, den sie bloß nicht kennen, sondern das Oppenheim der Chemiker, Philosoph und Privatgelehrte ist, der sich unter anderem auch mit der Gestaltpsychologie beschäftigte – der Physiker hießja Oppenheimer, diese Verbindung liegt demzufolge nahe. Es herrschte also ein allseitig heftiges Gedränge, das nicht bereits an der Tür, sondern erst am Sitzplatz entschieden wurde. Ich jedenfalls hatte meinen Spaß.
Diesmal durchaus ernsthaft, obwohl meine Rubrik "Wort für Wort" sonst nicht ohne Ironie auskommt, habe ich mich diesem Begriff gewidmet. Der Text ist ziemlich lang geworden, sicherlich ein Manko aber kürzer ging es wirklich nicht.
Man könnte meinen, die weißen Flecken auf der Landkarte sind dem Weiß im weitaufgerissenen Auge gewichen, betrachtet man die vielen Facetten, denen unser Auge in der Fremde ausgesetzt ist. Sandy, ein Wirbelsturm immensen Ausmaßes, tobte gerade über die Westküste der USA, hat zuvor bereits die Karibik verwüstet, Todesopfer gefordert, und doch oder gerade deswegen übt eine solche Naturgewalt genügend Faszination auf uns Menschen aus, Berichten in Funk, Fernsehen und Internet gebannt zu folgen. Reporter im Auge des Sturms, Liveschaltungen, Webcams sind nur ein paar der Beispiele, wie wir uns die Katastrophe ins Wohnzimmer holen; Eindrücke in Echtzeit. Menschen pilgern in Scharen zu einem Ozeanriesen, der schlagseitig vor der italienischen Küste liegt, wo ebenfalls Menschen gestorben sind. In strahlungssicheren Anzügen stapfen Menschen über verseuchten Boden, um sich ein Bild zu machen von einer Gewalt, die Menschen entfesselt haben aber nicht kontrollieren konnten, noch immer nicht.
Doch was hat das alles mit dem Tourismus zu tun, könnte man da fragen? Und ist diese Form des Extremtourismus – was für mich persönlich die wichtigere Frage darstellt – ein heutiges Phänomen, das zu Recht oder zu Unrecht Empörung auslöst? Und welchen Anteil hat die zunehmende globale Vernetzung daran?
Tour, seit dem 17. Jh. in der deutschen Sprache belegt, leitet sich ab aus dem Französischen. Auch im Englischen findet sich ein solcher Begriff, doch die Ableitung aus dem Französischen liegt näher, denn zur Zeit des Sonnenkönigs, als an Höfen in ganz Europa französisch gesprochen wurde, wird neben dem Wort selbst auch die Bedeutung unverändert importiert und setzt sich deshalb von einem heutzutage gleichbedeutenden Wort ab, dass zu dieser Zeit längst nicht das Gleiche aussagte: die Reise. Während nämlich die Reise durchaus als Überwindung einer Entfernung gesehen werden kann, ohne dass der Reisende die gleiche Strecke auch wieder zurück unternimmt, ist im Wort Tour, aus dem der Begriff Tourismus hervorgegangen ist, durchaus eine Wiederkehr an den Ausgangsort angelegt. Die Wurzeln von Tour liegen nämlich im Griechischen tornus (heute noch bekannt und verwandt mit dem Turnus), was so viel wie Dreheisen bedeutete und ein Eisen beschreibt, dass sich auf einer Kreisbahn um einen Punkt, eine Achse o.ä. fortbewegt. Der Zweck einer solchen Unternehmung, also einer Tour im 17. Jh., lag in der Zerstreuung, so stelle ich mir das vor, und deshalb ist die Verbindung zum französischen Hof auch naheliegender denn zum englischen Pendant. Der Tourismus als Begriff der Reise, mitnichten gefahrlos, daran hatte der Engländer aber wahrscheinlich keinen unmaßgeblichen Einfluss. So gibt es Zeugnisse von Rheintourismus durch adlige Engländer, die sich bewusst auf den Weg machten, um sich auf die Spuren der Burgenromantik zu begeben, und es gibt ebenfalls bereits im 19. Jh. den Alpentourismus, der ebenfalls von Engländern unternommen wurde. Daran können sogleich zwei Facetten des Tourismus, sogar des Heutigen, in Augenschein genommen werden, die eine Antwort auf die Frage der Intention geben. Zum einen ist es die Erweiterung des geistigen Horizonts, genauer das Nacherleben von Empfindung vor Ort wie sie zuvor in Büchern und anderen Medien wahrgenommen wurde. Und zum anderen die bewusste Exposition einer Gefahr für Leib und Leben, sozusagen die Grenzerfahrung. Natürlich darf hier keine strikte Trennung erfolgen, denn es kann sowohl nur eins von beidem als auch beides zusammen Grund für eine „Tour“ sein.
Der Tourismus an sich umfasst ja auch längst nicht mehr nur den Bereich, der den Reisenden direkt betrifft, sondern auch Maßnahmen, die diese Reise erst ermöglichen, zum Beispiel Gasthäuser, Reiseführer oder Menschen, die die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellen und an Ort und Stelle bereit stehen. Aus dieser anfangs sicherlich eher spärlichen Peripherie um den Tourismusbegriff ist im Laufe des 20. Jh. eine ganze Industrie gewachsen. Längst ist diese Industrie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und es entstanden Orte, Sehenswürdigkeiten die allein zum Zwecke der Ansicht und des Besuchs errichtet worden sind, die auf Touristen abzielen.
Es gibt aber auch – und das rekuriert wieder auf die zuvor genannten Intentionen – einen Tourismus, der so gar nichts mit dem gemein hat, was sich der Mensch unter dem Tourismusbegriff vorstellt und auf den ersten Blick wenig damit zu haben scheint. Im Alpentourismus der Engländer klang es bereits an, es geht um die Grenzerfahrung. Auch hier muss unterschieden werden, denn Grenzerfahrung ist nicht gleich Grenzerfahrung. Während nämlich das Besteigen des Mont Blanc durchaus als Höchstleistung gelten kann und ein nicht unbeträchtliches Gefahrenpotential für die eigene „heile Haut“ darstellt, kam es bereits früh – die Rede ist vom Ende des 17. und Anfang des 18. Jh. – zu einem weiteren Grenzgang, bei dem die persönliche Gefahr nicht höher war, als beim Überqueren einer Straße. In der Literatur ist diese Art des „Tourismus“ durch nicht wenige Zeugnisse belegt. Zum Beispiel kam man als wohlsituierter Besucher Londons Ende des 18. Jh. nicht um den Besuch Bedlams herum, einer Irrenanstalt, die sich sogar darauf eingerichtet hatte, Besucher zu empfangen und dafür Geld zu nehmen. In anderem Zusammenhang schrieb auch Kleist darüber, ebenso Klingemann oder Musil. Geprägt haben den Begriff des „Irrenhaustourismus“ Reuchlein und Košenina. Vor allem Letzterer ist mir in dieser Thematik im Gedächtnis geblieben, weil seine Erklärung und Einordnung in Anbetracht des aufgeklärten und nach Aufklärung strebenden Menschen, der sich in dieser Zeit selbst in den Mittelpunkt stellt und nicht nur das Normale, den Durchschnitt erfassen will, sondern gerade am Extrem interessiert ist, eine schlüssige Erklärung für die Beweggründe liefert.
Der Neuentdeckung des Menschen könnte sich also nahtlos die Neuentdeckung des Extremereignisses anschließen, wenn sich nicht beides im Tourismusbegriff der Gegenwart bereits gefunden und die Vermischung nicht schon viel früher stattgefunden hätte. Einen Irrenhaustourismus, sofern man nicht Angehörige besucht, gibt es heute nicht mehr, aus gut verständlichen Gründen. Was es aber weiterhin gibt, ist der Katastrophentourimus. Denn während die letzten 2 Jahrhunderte genügend Aufschluss über das Seelenleben des Menschen gegeben haben und auch die Rücksicht der Interessen aller Menschen solche Reisen verbieten, hat die Katastrophe, in welcher Form auch immer sie vorliegt, nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Selbst ein Urteil darüber, wie es sicherlich dazu beigetragen hat, dass es den Irrenhaustourismus heute nicht mehr gibt, haben Menschen bereits recht früh darüber angestellt. Karl Kraus reagierte bereits 1921 auf die in seinen Augen wohl geschmacklose Anzeige der Basler Zeitung, Menschen an die Schlachtstätte Verdun zu führen und dabei Kost und Logis anzubieten. 117 Franken sollte seinerzeit die völlig „ungefährliche Tour“ kosten. Wenn es einen Ort der Varusschlacht gäbe – und nicht 4 oder 5 vermeintliche – würde dies niemanden bestürzen, wenn plötzlich alle Welt dort hinginge. Die Zahl der Besucher insgesamt ging in New York natürlich zurück nach 9/11, aber die Stadt wurde um eine makabre Attraktion reicher, die höchstwahrscheinlich den am häufigsten besuchten Ort in der Großmetropole darstellte in den darauf folgenden Jahren.
Umso länger die zeitliche Distanz zum Extremereignis liegt, desto geringer scheint auch der Grad Aufregung über den Touristen zu sein, der sich sein Reiseziel unter diesen Gesichtspunkten aussucht. Diese Beispiele unter dem Aspekt der schlichten Lust nach Sensation abzutun, könnte die kurzfristigen missbilligenden Reaktionen, wie sie oft in der Zeitung nachzulesen sind, plausibel machen. Auf längere Sicht betrachtet, liegt dem aber eher ein tiefes Unverständnis zugrunde, was von solchen Ereignissen ausgeht, sei es nun die Naturgewalt, die wir in ihrer Gänze längst nicht verstehen oder ob wir Menschen es selbst sind, die mit ungeheuerlichen Taten solche Ereignisse entstehen lassen. Neu ist weder das Eine noch das Andere. Das einzig Neue daran ist, dass der Mensch durch den gesteigerten Informationsfluss viel schneller darauf reagieren kann, als er es vor 50 Jahren noch konnte. Auch gab es gerade in puncto Gefahr für das eigene Leben, kein adäquates Mittel, trotzdem am Ort des Geschehens zu sein. Abhilfe schaffen das Radio, das Fernsehen, das Internet, in dieser Reihenfolge nicht nur dem Auftreten nach, sondern auch am Grad der Intensivierung bzw. Unmittelbarkeit gemessen. Und auch die kurzfristigen Reaktionen darauf fallen einfach häufiger aus, nicht aber anders als schon vor 100 Jahren.
Ich bin heute zum ersten Mal auf der Schulenburger Landstraße mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Das ist eine stark befahrene Straße mit allerhand Gewerbeflächen und nur wenigen Wohnhäusern, wovon nicht wenige leer stehen. Diese Straße musste ich entlang fahren, weil ich einen Termin hatte, beim Zahnarzt, zur professionellen Zahnreinigung. Ähnlich wie diese Straße ist auch meine Mundhöhle ein stark befahrenes Areal. Meine Zunge, die sich bestens auskennt, mimt den Touristenführer und leitet alle Ankömmlinge gekonnt an Schlaglöchern, Erhebungen und sonstigen Hindernissen vorbei, direkt in die große Ausfallstraße nach Süden. Leider, und auch das hat meine Mundhöhle mit stark befahrenen Straßen gemein, bleibt häufig etwas liegen, füllt Zwischenräume, tritt sich fest, macht Fassaden grau und sorgt überhaupt für Abnutzung auf den Wegen.
Als ich beim Zahnarzt angelangte, bekam ich sogleich den üblichen Fragebogen überreicht, auf dem ich, unüblich, nichts anzukreuzen hatte, denn eine Spalte für die ganzen „Neins“ gab es nicht. Das einzige, was ganz genau geklärt werden sollte und deshalb mit Ja oder Nein zu beantworten, war die Frage, ob ich schwanger sei, ich kreuzte Nein an. Kurz darauf fand ich mich auf einem Leopardenfellbehandlungsstuhl wieder und wurde mit allerhand Tüchern belegt. Ein kleiner Becher mit rosa Flüssigkeit zum Ausspülen sollte später darüber hinwegtäuschen, wie unblutig das Ganze abgelaufen war, aber die Farbe war leider schlecht angemischt, so dass mein Eindruck von einem mittelgroßem Massaker auf der Fahrbahn nicht getäuscht werden konnte – wahrscheinlich ein Unfall durch rücksichtslose Fußgänger.
Zeit zum Nachdenken hatte ich übrigens ab Behandlungsbeginn keine mehr, vielmehr war ich damit beschäftigt, krampfartig nach Haltepunkten zu suchen und dem Schmerz im Mundraum und dem Piepen im Ohr so wenig Beachtung wie möglich zu schenken. Erst später, als die Grobheiten abgeschlossen waren, konnte ich wieder einen Gedanken fassen. Klar war dieser aber nicht, denn ich fragte mich als erstes, ob die behandelnde Zahnarzthelferin wohl Brillenputztücher gestellt bekommt oder diese, wenn sie nicht zur Verfügung gestellt wurden, von der Steuer absetzen konnte.
Nachdem sie mir dann während der abzuarbeitenden Feinheiten erklärt hatte, wie ich zu putzen habe und welche Bereiche besonders stark befahren werden, holte sie eine kleine Mundsperre heraus, auf die ich zu beißen hatte. Ein Lack wurde zum Schluss noch aufgetragen, guter alter Straßenbelag, der mir für eine Stunde jeglichen Verkehr in der Mundhöhle verbot, außer Anlieger natürlich, meine Zunge durfte also drinbleiben. Meine Zunge ist jetzt auch kein Touristenführer mehr, sondern selber fremd in der Mundhöhle und fährt deshalb erst mal alle Bereiche ab, um sich neu zu orientieren.
Einen meiner Zähne behandelte sie mit besonderer Nachsicht, denn er besteht, wie sie richtig festgestellt hatte, aus zwei schmalen Seitenwänden und einem riesengroßen Berg Beton in der Mitte. Sie sagte zu mir noch etwas von einer Krone, die da unbedingt drauf müsse, ich war mit meinen Gedanken aber gleich beim Hochbahnsteig, der zurzeit auf der
Schulenburger Landstraße gebaut wird und sagte nur kurz, na klar, wird gemacht. Was das wieder kostet!
Weit verbreitet, bis ins All,
wir senden auf allen Kanälen.
Liebstes Medium ist uns der Schall,
mit dem wir andere quälen.
Ein Botschafter! Das Verlangen wiegt schwer,
die Botschaft nicht Wort, sondern Wille:
Flaute im Segel auf der Töne Meer,
ein Exporteur der Stille.
inspired by neighbours & Anja
Das Wochenende ist umgebracht. Es folgt, wie meistens, ein Montag, der mit sinnloser Hetze beginnt, in Kaffee mündet und dem ersten, richtigen Einschalten des Computers seit Freitag. Kaffee. Folgt man der etymologischen Spur dieses Gemütserregers, so endet man beim
arab. qahwa, das laut Wörterbuch sowohl für Wein als auch für Kaffee stehen konnte. Daneben steht das
türk. kahve wohl ebenfalls Pate, denn die venezianischen Kaufleute brachten den Kaffee nach Italien im 16. und 17. Jh. Schaut man dem Wein auf seine etymologischen Wurzeln, so erreicht man, nachdem das
lat. vinum abgehakt wurde, den Pontus, bzw. Südkaukasus als Heimat der Weinkultur. Es gibt also einen Hinweis vom Kaffee zum Wein aber nicht umgekehrt. Dass es überhaupt einen Hinweis auf Wein gibt, wenn man Kaffee im etymologischen Wörterbuch nachschlägt, ist für sich genommen ja schon erstaunlich genug. Folgt man aber genau dieser Spur, stellt man nach geraumer Zeit der Recherche fest, dass sich bis auf wenige Gemeinsamkeiten kaum Hinweise finden lassen, die einen brauchbaren Zusammenhang zwischen beiden Getränken herstellen.
Vielleicht war die Erwähnung des Weines im Kaffeeartikel des etymologischen Wörterbuches ja nur Zufall? Vielleicht war es aber auch ein Überbleibsel aus längst vergessenen Tagen, als der Wein und auch der Kaffee noch als Begrüßungsgetränk gereicht wurde. Hinweise dafür ließen sich sogar finden. 1864 hieß es in einer
Zeitschrift dazu:
„Kaum 150 Jahre hatten ausgereicht, den Kaffee im ganzen Orient einzubürgern. Sogar Indien wurde schon sehr frühzeitig mit demselben bekannt. Bereits 1642 brachten die Holländer 83,540 Pfd. dorthin. Und noch heute steht dieses Getränk in der ganzen orientalischen Welt in hohem Ansehen. Es ist wie bei uns der Wein das Ehrengetränk, mit welchem man den Gast zu jeder Tageszeit bewirthet. Überhaupt vertritt der Kaffee bei den Muselmännern die Stelle des Weines, dessen Genuß der Koran aus ähnlichen Rücksichten verbietet wie Moses seinen Juden das Essen des Schweinefleisches…“
Über meine Recherche ist der Kaffee kalt geworden. Ich werde nicht darum herumkommen, ihn noch einmal aufzuwärmen. Diesmal lasse ich mich aber nicht vom kalten Kaffee der Etymologie ablenken und komme besser gleich zur Sache.