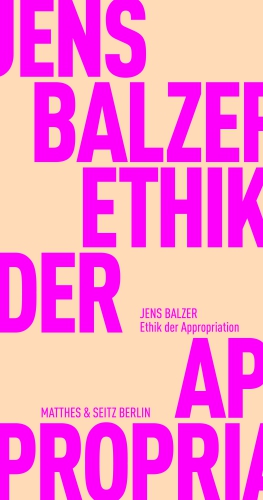Seit ein paar Tagen begegnet mir auf dem Weg nach Hause immer dieselbe alte Dame. Morgens gegen 8:00 Uhr verlasse ich mit meinem Sohn das Haus, er sitzt im Kinderwagen und erklärt mir, was er so alles sieht, und wenn wir dann die Kita erreicht haben, steigt er aus, er klingelt an der Eingangstür und wird dann von mir verabschiedet. Auf dem Rückweg – es kommt darauf an, wie zeitig vorher alles abgelaufen ist – treffe ich sie. Sie trägt eine grauhaarige, struppige Dauerwelle, ihr Gesicht ist von kleinen roten Äderchen gezeichnet und darin liegen, weit hinten, zwei klitzekleine, spitze, wache Augen. Ein dicker beigefarbener Mantel reicht ihr bis über die Beine, die nicht mehr stark genug sind, sie von allein zu halten, sie schiebt eine Gehhilfe vor sich her und unablässig schüttelt sie ihren Kopf.
Manchmal, wenn ich sehr spät aus der Kita komme, sehen wir uns vorn an der Limmerstraße, dort wo der Edeka bereits seine Tore geöffnet hat. Am Anfang dachte ich, sie wohnt in dem Altenheim, das direkt über dem Geschäft liegt. Aber wenn ich sehr früh aus der Kita komme, dann begegnen wir uns bereits an der Grundschule am Pfarrlandplatz, dort wo zu dieser Zeit gerade die letzten Eltern ihre kleinen Wunder in die Schule bringen. Dann wackelt sie resolut mit ihrem Gefährt durch die schmalen Gassen der parkenden Autos, umschifft Pfützen, schwatzende Eltern und Seitenspiegel. Aber es ist egal, wo wir uns treffen. Immer grüßt sie mich freundlich, als ob wir uns seit Jahren kennen.
Natürlich kenne ich sie. Ich kannte sie schon immer. Ob sie nun Frau Lampe hieß und die Mutter des mittlerweile selbst in die Jahre gekommenen Nachbarn meiner Eltern war und dort oben in der zweiten Etage des Reihenhauses mit Minka, ihrer Katze, lebte. Oder ob es Frau Kober war, die gegenüber von unserem Garten ihren Garten hatte, in dem ein herrlich großer Aprikosenbaum steht. Oder die alte Frau Obenauf, die so kurz nach der Wende als fast einzige in der Straße ein Telefon besaß, von dem aus ich einmal den Notarzt rufen musste. Oder die Eltern von Nachbarskindern, mit denen ich spielte. Immer grüßten sie. Bis ich irgendwann zuerst grüßte. Bis ich alt genug war, diesem Ritual etwas abzugewinnen und für mich beschloss, dass es ein Privileg der Jugend ist, zuerst grüßen zu dürfen. Nie wäre mir der Gedanke gekommen, grüßen zu müssen. Ich handelte und handele in dieser Sache immer als freier Mensch, der sich aussucht, wen er grüßt und wen nicht, und der eben immer zuerst grüßt, weil er jünger und schneller ist.
In unserer Straße wohnte auch eine Familie, die eine Tochter hatte. Ich kann mich nicht mehr an den Familiennamen erinnern aber in der Auffahrt stand später immer ein großer beigefarbener Opel Vectra. Ein Birnbaum musste diesem Gefährt weichen. Steffi war ein Jahr älter als ich. Einmal klingelten wir, die Kinder vom Dahlienweg, bei ihr, um sie zum Spielen in unserer Straße abzuholen. Sie durfte aber nicht raus. Seitdem habe ich ihren Vater nicht mehr gegrüßt. Immer wenn er an mir vorüber ging, was allerdings auch selten genug vorkam, weil dieser Bereich der Straße abseits unseres kleinen Zentrums lag, schaute ich ihn kurz an und ging dann grußlos an ihm vorbei. Das war meine Strafe für ihn, weil Steffi an diesem Tag nicht mit uns spielen durfte.
Als ich längst nicht mehr in Magdeburg wohnte, traf ich ihn irgendwann erneut und machte meinen Frieden mit ihm. Ich grüßte ihn wieder. Er wird das nicht verstanden haben, damals wie heute, er wird sich daran wahrscheinlich gar nicht erinnern. Wie er mich leicht konsterniert angesehen hatte, als sich unsere Wege grußlos kreuzten. Es ist auch das einzige Mal, an das ich mich erinnern kann, wo ich - heute würde ich sagen, aus einer Laune heraus – mir, der Entscheidung zu grüßen, absolut sicher war und trotzdem nicht gegrüßt hatte. Die Illusion, mit dem Gruß frei gewesen zu sein, hält sich noch immer.
In meinem jetzigen Wohnhaus leben außer unserem Jungen noch zwei weitere Kinder, die ich ebenfalls grüße, zuerst versteht sich. Sie schauen ähnlich konsterniert, wenn ich Hallo sage, wie der Vater damals, aber sie grüßen mich immer regelmäßiger zurück. Neulich haben sie sogar zuerst gegrüßt, als wir uns auf der Straße begegneten. Da war ich der Verwirrte, weil ich die beiden Kiddies gar nicht auf dem Schirm hatte, meine Gedanken waren woanders. Und als mich die alte Dame zum ersten Mal gegrüßt hatte, war ich in einer ähnlichen Stimmung. Ich war so perplex, dass ich darüber beinah nichts erwidert hätte. Ob sie das wahrgenommen hatte, weiß ich nicht, ich holte das schnell nach und grüßte hastig und leise in ihren Rücken. Ertappt hatten sie mich. Sie, die Kinder aus der Nachbarschaft und auch die alte Dame auf ihrer allmorgendlichen Mission.
Heute sah ich die Alte bereits von weitem. Unsere Wege sollten sich an besagter Grundschule kreuzen und sobald sie in Hörweite an mich heran gerollt war, hob ich zum Gruße an. Einen Guten Morgen wünschte ich ihr und war irgendwie stolz darauf. Sie grüßte natürlich zurück, verzog aber sonst keine Miene. Kein noch so kleiner Anflug von Ironie umspielte ihre Lippen, kein Aufblitzen in ihren kleinen schwarzen Augen ließ erkennen, dass sie nun erreicht hatte, was sie wollte. All das eben Geschriebene lief in einem farbigen Bilderbogen vor meinem geistigen Auge ab. Ich fühlte mich plötzlich so jung, wie schon lange nicht mehr. Ich wäre am liebsten links abgebogen und hätte meinen Ranzen schlenkernd, laut krakelend in die Schule rennen wollen, um eine lange Reihe kleiner f’s in mein Heft zu schreiben.
Ich habe den Brief von neulich immer noch nicht abgegeben. Plötzlich geht es wieder. Es herrscht Stille im Haus, und das obwohl die Nachbarn da sind. Mein Vermieter läuft mir über den Weg und ich denke mir, es gibt sogar drei Dinge, die mich tierisch nerven. Das sind ja nicht nur die Nachbarn. Da ist auch noch ein Wasserschaden aus dem Sommer - unbeglichen. Da ist auch ein viel zu kleiner Heizkörper in der Küche, der obendrein nicht richtig auf Touren kommt. Die hinteren Heizkörper kommen alle nicht richtig auf Touren, nicht einmal der hinter der Kommode im Flur, obwohl dieser Heizkörper ja vorne steht. Nur der im Wohnzimmer läuft richtig. 16,5 ° Celsius morgens in der Küche.
Und dann fahren wir heute nur so mit dem Rad herum und plötzlich steht ein Auto mitten im Weg. Die einzige Möglichkeit an dem Auto vorbei zu kommen, ist absteigen und drum herum schieben. Und das nur, weil diese Honks zu faul waren, auf dem meilenweit freien Parkplatz eine Stelle zu suchen, wo sie an beide Seiten des Wagens herankommen. Da stehen sie lieber vor dem abgesenkten Bordstein, um an den Winterreifen zu schrauben. Meine Frau schimpft vor sich hin und ich besehe mir die Herren Monteure genauer. Es sind unsere Nachbarn von über uns. Ich glaube, wir kommen einfach nicht zusammen.
Auf 4a lag ein abgetrennter Frauenkopf, dem bereits das Gesicht abbröckelte wie Putz von der Wand, nur das blonde Haarteil war immer noch perfekt drapiert, Haarfestiger vielleicht. Ich ging kleine Bögen, fast kreisförmig folgte ich dem rechteckigen Treppenhaus hinauf, dessen Mitte von einem Fahrstuhl gefüllt war, der hinter einer Fassade aus rot gestrichenem Beton nach unten brummte. Ich fuhr selten mit ihm. Von der Kantine im ersten Stock sind es nur zwei Etagen bis zur Requisite. Zwischenstopp. Und von dort aus sind es nur noch zwei Etagen bis zur Bühne.
Die Aufregung nahm mit jeder erklommenen Stufe zu. Kloß im Hals. Ein Ritter in voller Montur kam mir entgegen und löste gar nichts aus. Ich konnte nicht einmal grüßen, ich guckte nur blöde. Als ich die Tür zum Vorraum öffnete war dahinter gerade der Maskenbildner zu Gange. Er räumte einen Tisch beiseite und verließ kurz darauf den Bereich hinter der Bühne. Ich war allein. Eine kleine Ecke verstellt den Blick auf die Tür zur Bühne und auf den großen Requisitentisch, der links im kurzen Flur zum Bühnenaufgang abgestellt war. Ich ging darauf zu, vollführte die Drehung um die Ecke, ging noch einen Schritt und stand vor der ersten von zwei geschlossenen Türen, die den Vorraum von der Bühne abtrennen. Auf dem Requisitentisch stand ein Monitor, der das Geschehen auf der Bühne in Wort und Bild wiedergab. Von schräg unten hörte ich das dumpfe Dröhnen des Konzerts, das auf der Hauptbühne gerade in die Zugabe ging. Hier oben, direkt vor dem Monitor verblassten die Geräusche wieder, sobald ich mich dem Geschehen auf dem Bildschirm widmete. Meine Hände waren schweißnass. Gleich sollte es soweit sein. Vielleicht noch 5 Minuten.
Unschlüssig stand ich herum, kein Mensch war da. Ich öffnete vorsichtig die erste Tür, stellte mich zwischen beide Räume. Ich vernahm das Geschehen auf der Bühne nun in doppelter Ausfertigung. Das Original kam von rechts und der Durchschlag dröhnte vor mir aus dem Monitor, der weniger als einen Meter neben der Tür stand. Plötzlich setzte Spektakel auf der Bühne ein, ich erschrak heftig. Der Lautstärkepegel war für einen kurzen Moment enorm angeschwollen. Dopplereffekt, Interferenz hallten in meinem Bewusstsein nach. Ich schloss die Tür ebenso vorsichtig, wie ich sie geöffnet hatte. Vor dem Bildschirm lag eine Fernbedienung, ich regelte die Lautstärke herunter und begann, die Tür erneut zu öffnen. Ein feuchter Film lag bereits auf den Händen, ich wischte ihn am Ärmel ab. Als Kind hatte ich einmal einen Splitter im Zeigefinger, genau auf der Kuppe. Meine Mutter versuchte ihn mit einer Nadel zu entfernen und ängstlich beobachtete ich sie dabei. Sie hatte meinen Finger noch nicht mit der Nadel berührt, als ich bemerkte wie sich kleine Tropfen auf meiner Haut bildeten. Meine Mutter sah dies auch und staunte über meine Darbietung. Das kann ich heute noch.
Mit der schmierigen Hand strich ich mir eine Strähne aus dem Gesicht, klebte sie regelrecht hinter mein rechtes Ohr und fühlte dabei den Hammerschlag hinter der Schläfe. Ich brauchte keinen Haarfestiger. Noch 2 Minuten etwa, dann würde es losgehen. Die zuerst geöffnete Tür, sollte sie ganz geöffnet sein? Oder nur angelehnt? War der kleine dunkle Vorraum zur Bühne überhaupt groß genug, um alle aufzunehmen? Sah man nicht vielleicht das Licht der hellgrün getönten Neonröhren bereits durch die Türritzen auf die Bühne scheinen? Erschrocken ging ich in den großen Vorraum zurück und besah mir die Bühne aus der Kameraperspektive. Da war kein Lichtschein links unten. Gut. Ich ging zurück und bemerkte das Klebeband an den unteren Rändern der Tür. Noch eine Minute vielleicht.
Dem Treiben auf der Bühne konnte ich nicht folgen, musste ich glücklicherweise auch nicht. Mein Signal war der einsetzende Applaus. Ich stand herum, die Arme vor der Brust verschränkt, die Hände in klammen Ärmeln vergraben. Mein Schnaufen, ist das zu laut? Mein linkes Knie knackte mit ohrenbetäubendem Lärm. Plötzlich Stille auf der Bühne. Die ich unterbrochen hatte? Sie verflog mit der nächsten, vielleicht letzten Sentenz vor meinem Einsatz. Kein Applaus, Gelächter. Ein nächster Satz, noch einer. Musik, wieder Gelächter, Stimmengewirr. Und dann endlich: Applaus. Ich riss die zweite Tür, die seitlich auf die Bühne führt, auf, verlangsamte noch beim ersten Lichtschein, der von der Bühne auf mich fiel, meine Bewegung. Zu früh. Ich kibitzte durch den Spalt. Dann endlich hörte ich das Getrappel der Schauspieler. In großem Bogen öffnete ich die Tür, trat selber dahinter zurück in den Schatten und die Darsteller liefen an mir vorbei in den Vorraum. Sie sortierten sich in verabredeter Reihenfolge und trabten erneut auf die Bühne. Der Applaus ebbte nicht ab. Sie kamen zurück, tauschten wiederum die Positionen untereinander. „Toller Service!“, rief mir eine Schauspielerin lächelnd zu, ich lächelte zurück, sagte nichts. Was sollte ich auch sagen, mein Job war es, die Tür aufzuhalten.
Gestern Abend waren Trithemius und ich auf einer Lesung. Jörg las. Jörg ist ein Autor aus Celle und hatte seine Bücher in Fünferstapeln vor sich auf einer Box liegen. Ich bekam keinen Blick darauf, weil mein Sofaplatz nicht hart er- aber später hart umkämpft war. Als ich nach der Lesung ein Bier holen ging, kam ich zurück und schwupss war mein Platz an
Rasendreher gegangen, der nichts trank und somit den Platz erst frei machte, als er gehen wollte. So musste ich mit dem American Diners Sofa nebenan vorlieb nehmen und rückte in gefährliche Nähe einiger englischsprachiger Infiltratoren, die mir bereits während der Lesung durch zu lautes Flüstern aufgefallen waren. Das muss man erst mal hinbekommen, laut flüstern. Der eine höchst penetrante Flüsterer, einer der Engländer, der wahrscheinlich eher Amerikaner war, hielt sich beim Flüstern sogar die Hand vor den Mund und machte Krach, als hätte er auf dem Handrücken – er hielt sich genau den vor sein Organ – ein Megaphon installiert.
Eben dieser Engländer, der wahrscheinlich Australier war oder Ire, hatte auch eine Gitarre dabei und ein paar Songs auf Lager. Er beherrschte das Gitarrrespiel nur leidlich und die Stimme versank häufig in theatralischen Misstönen, so als würde ich versuchen, so zu singen wie Paul Potts. Um die Musik kamen wir nicht herum, obwohl das Mikro der Lesung dankenswerter Weise vom Veranstalter einkassiert worden war, wir saßen einfach nicht weit genug weg, um der musikalischen Darbietung zu entgehen. Der zweite Gitarrenspieler verstand sein Handwerk und beschränkte sich auf die Gitarre. Um ihn war es fast schade, denn mit einem Mikro an seiner Gitarre wäre das Ensemble erträglicher gewesen.
Gelesen wurden Kindheitsgeschichten. Der erste Block war dröge, um nicht zu sagen langweilig. Die Namen der Protagonisten klangen antiquiert, den Stories fehlte irgendwas. Wiederkehrendes Moment waren ein spitzenbewehrtes Taschentuch und Filme, die seinerzeit im Kino liefen, in Chronologie und Kindheitsdauer aber schlampig verarbeitet waren. So ging die Phase mit dem Eintritt in die Pubertät, also vielleicht ab dem 11. Lebensjahr zählend bis zum Erreichen des 16. Lebensjahres über mehr als 10 Jahre und erst im zweiten Block wurde klar, dass das Kino, in dem die Filme seinerzeit von den Protagonisten gesehen wurden, erst später als ihr ursprüngliches Erscheinen auf der Kinoleinwand gezeigt wurden, die eigentlich nicht einmal ein Kino war, sondern eine Kneipe mit Scheune, die für die jeweiligen Vorstellungen umgebaut wurde.
Im zweiten Teil erklang statt des Hochdeutschen plötzlich ein bayrischer Dialekt, die Geschichten bekamen etwas uriges, unmittelbares und obwohl die Namen immer noch antiquiert klangen, hatte plötzlich alles einen heimeligen Charakter. Die Kino- bzw. Filmgeschichte bekam ihre Auflösung und versöhnte auch mit den zuvor gehörten Geschichten. Die Atmosphäre lockerte sich, es wurde auch gelacht auf einmal und insgesamt muss ich sagen, wurde der Abend rund. Trithemius, dem nach dem ersten Block aufgefallen war, dass viele Sagewörter die Unmittelbarkeit der Dialoge verstellten, sagte dazu später nichts mehr, er war wohl ähnlich angetan wie ich. Mein dunkles Bier schmeckte plötzlich besser, der Engländer, oder vielleicht auch Schotte, war leise, weil sein Kompagnon sich andernorts niedergelassen hatte und mein geliebter Sofaplatz wurde mir so richtig bequem. Ich tat den Arm auf die achselhohe Lehne, streckte die Füße unter den Tisch aus und ließ mich mundartlich berieseln. Toll.
Danach bekam mein Sitzplatz leider einen anderen wärmenden Hintern zu spüren, der Engländer, der wahrscheinlich Neuseeländer war, begann zu singen und mein Bier war frisch gezapft schal geworden. Engländer trinken ja kein schales Bier, deshalb standen zwei wenig gefüllte Biere auf unserem Tisch herum und zankten um die längst vergangene Gunst ihrer Besitzer, die sich neu ausstaffiert hatten mit weißen Schaumkronen auf neuen Gläsern. Später standen die Biere nur noch so herum, dem betretenen Schweigen war zu entnehmen, dass niemand mehr kommt, um sie auszutrinken. Den Engländer, oder vielleicht auch Kanadier, haben sie dann wenig später ebenfalls abserviert, freundlich aber bestimmt und ohne ein Wort zu verlieren über die Darbietung. Es gab triftige Gründe das Kostenloskonzert abzubrechen. Die Bühne musste leer geräumt werden, für ein Sofa und der hinten in einer Ecke stehende Kickertisch wurde nach vorn gehievt und fachmännisch betriebsbereit gemacht. Rasendreher verließ uns und mein Sofaplatz gehörte wieder mir. Ich fläzte mich zurück in die Mulde, hob den Arm, legte ihn auf der Lehne ab und genoss den Rest des Abends.
Auf der Suche nach dem kleinen, feinen Unterschied, der gewitterten Nuance kann man sich machen, wenn man zum Beispiel dem Wein nicht abgeneigt ist. Dem Kenner offenbaren sich bereits beim Öffnen der Flasche, dem ersten entsprungenen Duft, beim kleinsten Nippen am Glas feinste Unterschiede, die auf Jahrgang, Hanglage und Sonnenstunden hindeuten lassen, von der Rebsorte ganz zu schweigen. Auch die deutsche Sprache bietet mancherlei Facette, die es dem Kenner erlaubt, sich von der "Spreu" des gewöhnlichen Benutzers zu trennen und mit dem richtig gebrauchten Detail eine Aussage erst eloquent zu machen. Um solch ein Detail soll es heute gehen: den gemeinen verneinenden Präfix bei Adjektiven.
Schon in dem Wort "gemein", das ich eben verwendete, steckt ein kleiner Hinweis darauf, dass es sich bei dem Präfix un- um ein einerseits höchst produktives Präfix handeln muss (ein Allgemeinplatz), andererseits aber auch, dass es nicht das einzige ist, welches verneinende Wirkung hat. Deshalb nehmen wir, um das Gegensatzpaar perfekt zu machen, das Präfix a- mit hinzu. Beide Präfixe verneinen Adjektive, un- jedoch ist weiter verbreitet und der Einsatz von a- als Präfix zumeist auf aus dem Lateinischen oder Griechischen entlehnte Adjektive beschränkt. "Typisch" zum Beispiel kommt aus dem Lateinischen und wird untypisch, wenn wir ein a- davor setzen, nämlich atypisch. Jetzt wird es kompliziert, hört man uns denken, die Augeninnenteile beschreiben Kreise und das einzige, was wir, die wir ja keine "Kenner" sind, entgegenzusetzen haben ist: "Ich trinke viel lieber Bier als Wein".
Damit ist jetzt Schluss, die Trauben müssen uns nicht mehr zu sauer sein! Aller gezielt gestreuter Desinformation im Netz zum Trotz, ist es mir nämlich gelungen, eine schlüssige Differenz bei der Verwendung von un- und a- als Präfix bei dem Adjektiv "typisch" auszumachen. Obwohl un- selbst bei "
typisch" produktiver ist – es liefert bei Google 57.000 Treffer, wohingegen "
atypisch" nur auf 40.000 Treffer kommt – stehen die gut recherchierten und wesentlich ausführlicheren Lösungen unter "
atypisch" und nicht unter "
untypisch“. Es gibt sogar
Fachleute, die für die Präfigierung mit un- oder a- keinen semantischen Unterschied festgestellt haben wollen, oder diesen nur "wenigen" Paaren zubilligen und dann auch nur ganz klitzeklein. Hören Sie nicht weiter darauf, das ist nur der Dünkel der Wissenschaft! Es gibt einen Unterschied, bei all diesen Paaren, nicht nur wie laut DUW (Deutsches Universalwörterbuch) bei areligiös (nicht religiös + außerhalb der Religion stehend) und unreligiös (nicht religiös).
Die Lösung sieht folgendermaßen aus. Ich beziehe mich dabei auf ein Beispiel, das direkt aus dem Leben gegriffen ist und sich deshalb sehr leicht merken lässt. Sollte in Zukunft also jemand darüber die Nase rümpfen, weil sie statt un- a- oder statt a- un- benutzen, können sie mit den folgenden zwei Merksätzen Ihr Expertentum auf diesem Gebiet kundtun und den Nörgler in seine Schranken weisen:
Atypisch ist, wenn ein Raucher unter Rauchern sitzt, die rauchen, und selbst nicht raucht.
Untypisch ist, wenn ein Raucher unter Rauchern sitzt, die rauchen, und selbst nicht atmet.
Lieber Vermieter,
wir haben weiterhin ein Problem mit vermehrter Lautstärke in unserer Wohnung. Diese ist nämlich nicht, wie vielleicht anzunehmen, durch uns verursacht, sondern durch unsere Nachbarn.
Wir haben auf Ihr Anraten hin seinerzeit das Gespräch gesucht und sind auch im Folgenden nicht davon abgewichen, allerdings stört es uns einfach, dass wir stets und ständig darum bitten müssen, dass wir nicht hören wollen, was über oder unter uns für Musik läuft. Daraus ergaben sich außerdem jede Menge Missverständnisse, denn wie nicht selten vorgekommen, wurde unsererseits die falsche Partei zur Ruhe bzw. Verringerung der Lautstärke aufgerufen, was natürlich auch dort für Verstimmungen sorgte. Die Belastung, die sich einerseits aus der Suche nach dem Verursacher der Lautstärke und der Lautstärke an sich ergibt, macht es uns nicht leicht, sich in unserer Wohnung wohl zu fühlen. Wir sind auch nicht bereit, Wohnraum „aufzugeben“, nur weil sich unter oder über uns gerade jemand aufhält, der in puncto Lautstärke andere Grenzen zieht als wir.
Es kann nicht angehen, dass ich am Donnerstag, den 08.11.12, gegen 23:11 Uhr eine Bohrmaschine in meiner Küche vernehmen muss oder während der Mittagsruhe, wie am Wochenende geschehen, in unserem Wohnzimmer mit lauten Bässen zu rechnen habe. Mit Regen muss ich rechnen, wenn ich nach draußen gehe, dafür gibt es den Wetterbericht; mit lauter Musik muss ich auch rechnen, wenn ich in die Disco gehe oder auf ein Konzert, dafür gibt es den Veranstaltungskalender, ich möchte aber in meiner Wohnung weder mit Regen noch mit übertriebener Lautstärke rechnen müssen. In beiden Fällen würde ich mich an den Vermieter wenden, was hiermit geschehen ist.
Mit freundlichen Grüßen
Da habe ich mich eben intensiv mit der Komparation beschäftigt und alles, was ich herausgefunden habe, ist nichts weiter als relativ. Widersprüchlich ist deshalb die völlig unsinnige Unterscheidung von
Elativ und
Exzessiv. Wikipedia zeigt das sehr schön, indem nämlich beim Exzessiv eine Erklärung gegeben wird, die sich mit Beispielen des Elativs deckt. Da heißt es: „Der Terminus Exzessiv benennt eine adjektivische Steigerungsform, die entweder ein extrem hohes („sehr sehr“) oder übersteigertes Maß („zu“) der bezeichneten Eigenschaft ausdrückt.“ Und beim Elativ steht im Beispiel: „Elativ (Partikel): „Wir arbeiten mit extrem modernen Maschinen.“
Komparieren wir das Adjektiv geil, kommt dann so etwas dabei heraus:
Positiv: geil
Komparativ=geiler
Superlativ=am geilsten
Elativ= extrem geil oder endgeil
Exzessiv=sehr sehr geil oder zu geil
Ich denke, es wird klar, dass sich Elativ und Exzessiv nicht allzu groß voneinander unterscheiden. Leider geil, würde ich sagen.
Ich hätte auch hinter einem Regal in zweiter Reihe stehen können, oder gerade beim Suchen nach Speisestärke in Gang drei, als die Kassiererin eingangs des Ladens an der Kasse plötzlich in ihr Mikro schreit: „Wir brauchen ganz dringend einen Notarzt!Ausrufezeichen!“
Die verunglückte Frau ist weißhaarig, dick und trägt ihre Krücken im vor ihr platzierten Einkaufswagen mit. Zwei Leute sind sofort zur Stelle aber die Frau kann nicht aufstehen. Die Kassiererin, die ganz dringend einen Notarzt bestellt hat, kassiert nicht mehr. Sie dreht sich nach allen Seiten um, ob nicht vielleicht ein Arzt im Geschäft herumstreunt und gleich seinen Kittel aus dem Koffer holt, das Stethoskop unter dem Pullover hervorzieht und mit routiniert modulierter Stimme um kaltes Wasser und Platz zum Arbeiten bittet.
Es kommt aber kein Arzt. Die Frau ist mit Hilfe einer weiteren Person und unter Aufbietung ihrer ganzen Kraft wieder zum Stehen gekommen. Den Schrei, den sie dabei ausgestoßen hat, hätte ich wahrscheinlich in Reihe drei ganz hinten gehört, dort wo die Milch steht und die Butter. Ohne Zweifel hätte ich dort auch den Ausruf der Kassiererin gehört, wie sie mit abfallender Stimme ins Mikro ruft: „Hat sich erledigt!“ Gut, dass ich vorn an der Kasse stehe und mit eigenen Augen sehen kann, dass es der Frau gut geht. Manchmal ist es ja doch schön, wenn sich etwas erledigt.
sauchen, Verb, etymologisch nahe verwandt mit suchen. Während das
gemeingerm. Verb
mhd. suochen,
ahd. suohhen eigentlich „suchend nachgehen, nachspüren“ bedeutet, sich ursprünglich auf den die Fährte aufnehmenden Jagdhund bezog und die Wurzeln im Allgemeinen eher im Dunkeln liegen, kann das Verb sauchen etymologisch eindeutig zurückverfolgt werden. Mit dem Aufkommen der ersten Standardtastaturbelegung auf
Schreibmaschinen, welche von
Remmington Ende des 19. Jh. eingeführt wurde, ist das Verb sauchen in der Literatur nachweisbar.
Semantisch ursprünglich durchaus äquivalent zu „suchen“ gebraucht, wandelte sich die Bedeutung mit der Intensivierung des Gebrauchs von Schreibmaschinen, Handys, Computern und sonstigen Spracheingabemodulen, die auf Basis der remmingtonschen Tastatur arbeiten, weg vom eigentlich zielgerichteten „suchen“ hin zu dem eher ziellosen Aspekt einer Suche, neu: Sauche.
Hierbei müssen grundsätzlich zwei Bedeutungsschwerpunkte unterschieden werden. Zum einen bestehen bei dem Verb "sauchen", insbesondere aber bei dem daraus gebildeten Substantiv "Sauche" Ähnlichkeiten zu gewissen kulinarischen
Flüssigkeiten. Zum anderen dient es der spezifischen Suche in „hastigen“ (hastig steht in diesem Zusammenhang für: fehlerbehaftet) Milieus, Google zum Beispiel liefert dafür eine ganze Reihe von
Treffern. Gerade in der zweiten Bedeutung könnte der obigen Definition nach ein Widerspruch stecken. Dies ist durchaus beabsichtigt und dient dem Anwender als Beweis seiner Eloquenz, denn die Sauche ist vor allem selbstreferentiell, der Saucher findet nur Ergebnisse anderer Saucher, er findet aber nichts, was er nicht auch gesucht hätte. In letzter Zeit wurde allerdings beobachtet, dass die Eloquenz nur eine mögliche Ursache für die Benutzung von sauchen, bzw. Sauche darstellt, seit neuestem spricht man in diesem Zusammenhang auch vom sog.
crassus digitus.