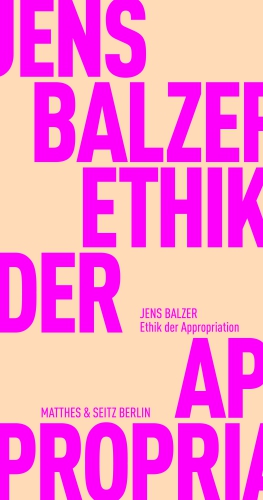Da sitze ich in der Mensa und bearbeite gerade einen Hähnchenschenkel mit meiner Gabel. Ich sitze hier völlig allein inmitten von Hunderten von Studenten an einem Tisch auf einem Stuhl, den ich besorgt höflich heranrücken muss, wenn jemand daran vorbei möchte, und da ich niemanden habe, der mich auf bessere Gedanken bringen kann, muss ich das selbst tun. Ich stelle mir also die Frage, ob der Hahn glücklich war. Das ist keine Frage, mit der man gewöhnlich auf bessere Gedanken kommt aber genau das macht für mich den Reiz dieser Frage aus. Ich habe schon ganz andere Schlachten geschlagen.
Ich kaue gerade auf einem Stück Haut herum, das alles andere als knusprig und wohlschmeckend ist, als ich mich meiner Frage folgendermaßen zu nähern versuche. Worin unterscheidet sich ein glücklicher von einem weniger glücklichen Zustand? Das ist natürlich davon abhängig, was ich als Hahn darunter verstehen würde.
Sagen wir, ich käme zur Welt in einer kleinen Box mit Hunderten anderer Hähne und fahre kurz danach gemütlich über ein Laufband, während plötzlich eine Hand neben mich greift und einen offensichtlich kranken Hahn vom Laufband nimmt. Da es auf den Unterschied ankommt, um feststellen zu können, welcher Moment jetzt der glücklichere ist, bleibt mir kaum etwas anderes übrig, als dem entfernten Hahn mein Beileid zu wünschen und mich glücklich zu schätzen.
In der Folge meines kurzen Lebens, gerate ich ständig in solche Situationen. Nebenbei fresse und picke ich, ich flattere herum oder ich schlafe unter dem Schein einer blauen Lampe, eingepfercht in einen Stall mit Hunderten meine Artgenossen. Immer bleibe ich übrig. Nur ganz am Schluss, da packen sie mich, töten und zerteilen mich. Mein Bein läge dann auf einem Teller, wie meinem, totgekocht in einer Tomatensoße mit Pilzen, dazu Kroketten mit einem so klingenden Namen wie „Hähnchenkeule Marengo“.
Ist das nicht glückliche Fügung, auf genau diesem Teller zu landen? Kann ich als Hahn nicht verlangen, dass, wenn ich schon am Ende gefressen werde, wenigstens mein Esser dabei glücklich ist? Ich als Esser des Beins würde sagen, dass es das Mindeste sei, was ich für den Hahn tun könnte. Und dennoch, ich sitze völlig allein unter Hunderten meiner Artgenossen an einem Platz, der kaum den Namen verdient und esse einen Hähnchenschenkel, der so lieblos in sich zusammenfällt, wenn ich nur einmal kurz aufseufze, dass ich eigentlich einen Löffel gebraucht hätte, statt einer Gabel und dann kommt so ein blöder Hahn und macht mir Vorwürfe, ich müsse doch glücklich sein bei dem Gedanken an ihn.
Wenn mich in diesem Moment jemand nach einer Definition von Glück gefragt hätte, ich hätte auf den Hähnchenschenkel gezeigt und gesagt, das bin ich, und wäre gegangen.
Ich war natürlich wieder auf dem letzten Drücker da. Das Prüfungsamt hatte gerade noch so geöffnet und ich stand mit ein paar anderen Studenten erstmal vor der Tür, bis mir aufging, dass die beiden einfach nicht wussten, dass die Tür offen ist und sie einfach eintreten dürfen. Es war ja schließlich gerade noch so Sprechzeit.
Heute endet der Zeitraum, um sich für mögliche Prüfungen anzumelden, ein von mir gern vernachlässigtes Datum. Ich nehme mir jedes Semester vor, sofort zu Beginn hinzugehen und am Ende laufen mir immer heißkalte Schauer über das Gemüt, weil ich jeden Tag daran erinnert werde und ich immer noch nicht da war. Ständig laufen einem Studenten über den Weg, die die Prüfungsanmeldung gerade vorhaben, wo es gerade erledigt ist oder wo einfach noch drüber geredet werden muss.
Ich ging also in den Raum mit meinen drei am Computer ausgefüllten Vordrucken. Alles in Schönschrift, gut lesbar und sogar eine maschinelle Verarbeitung wäre möglich. Aber da sitzt meine Lieblingssachbearbeiterin, kein Computer. Sie strahlt mich an, nimmt mir meine Zettel ab und klärt mich kurz auf über das Procedere. Wann ich ersehen kann, dass ich angemeldet bin, dass ich nicht heute Abend sofort unter meinen Zugangsdaten nachschauen kann, weil die Bearbeitung etwas dauert.
„Aber als alter Hase wissen Sie das natürlich, Herr Leisetöne. Da brauche ich Ihnen ja nichts vorzumachen“, generös zwinkert sie mir dabei zu und ich fühle mich einfach gut aufgehoben. Ich fühle mich immer gut aufgehoben bei ihr. Sie hat mit mir schon gemauschelt und getrickst, hier mal ein Modul angepasst und mir dort noch einen Tipp gegeben. Ich verdanke ihr viel. Dass sie mich erkannt hat, finde ich natürlich auch gut.
Einmal, vor ein paar Jahren, ich war gerade dabei meine Punkte zusammenzukratzen, um meine Bachelorarbeit anzumelden, da saß ich bei ihr und sie sagte mir in vertraulichem Ton: „Herr Leisetöne, jetzt mal ganz unter uns. Das Studium ist doch ein Klacks, das kann doch jeder. Aber die bürokratischen Hürden zu meistern, zu wissen, welche Scheine, wo benötigt werden, an welches Amt man sich wann meldet, das ist die eigentliche Weihe des erfolgreichen Studienabschlusses. Damit haben Sie endgültig bewiesen, dass Sie in unserem Verwaltungsapparat zu funktionieren wissen.“
Recht hatte Sie. Nichts ist schwerer als aus dem ganzen Papierkram schlau zu werden. Ich habe schon mehr als 3 verschiedene Prüfungsordnungen erlebt, und das in nur einem Fach! Ich schulde ihr auf jeden Fall etwas und ich schwöre, wenn ich fertig bin mit dem Studium, dann stelle ich dem Prüfungsamt eine Kiste Prosecco vor die Tür, anonym natürlich, sonst heißt es noch, ich hätte die Sachbearbeiterinnen bestochen.
Mit einem beschwingten Gefühl verabschiede ich mich von ihr, nachdem wir noch ein wenig geplaudert hatten und sie wollte gerade zur Erwiderung ansetzen, da schaute sie doch tatsächlich auf meinen Zettel und liest meinen Namen ab: „Tschüß Herr… Leisetöne, und viel Erfolg in den Prüfungen!“
Sie hatte mich gar nicht erkannt! Ihr erfahrener Blick, vergleichbar in etwa mit dem eines Fahrkartenkontrolleurs hatte sie lediglich dazu befähigt, schnell zu reagieren. An meiner Matrikelnummer, die mit einer 2 beginnt, hatte sie erkannt, dass ich schon geraume Zeit studiere – mittlerweile sind wir bei 4 als Anfangsziffer. Und mein Name steht ja ebenfalls auf dem Blatt, in Druckschrift, gut lesbar. Was hatte ich mir nur wieder eingebildet? Da gibt es tausende von Studenten und ausgerechnet mich erkannte sie wieder. Ich bin schon manchmal ein bisschen blöd.
Trotzdem. Ohne sie wäre ich vielleicht schon nicht mehr an der Uni, würde wieder Küchen verkaufen, zu Mondpreisen, die ich dann generös runterrechne – und mit dem geübten Blick eines Fahrkartenkontrolleurs würde ich sofort erkennen, ob sich das Geschäft lohnt oder ob ich lieber den Kunden dort hinten ansprechen sollte.
„Montag ist Schontag“, begann mein Hauptfeldwebel einmal zum morgendlichen Antreten sein Ansprache, um uns kurz darauf in Stuben zu schicken. So ähnlich begann mein Tag heute, als ich mich der Lektüre meine heutigen Seminare widmen wollte. Ich stellte fest, dass die heilige Cäcilie von Kleist aus nur drei Seiten bestand. Ich druckte mir den Text aus und begann zu lesen. Mitten im Satz brach die Erzählung ab.
Von der Bundeswehr war ich später nichts anderes mehr gewohnt, wenngleich diese Eröffnung damals einigen Eindruck auf mich machte; von einem Seminar der Literaturwissenschaft hatte ich mir indes anderes versprochen.
Essen ist kein Spaß, vor allem wenn man Hunger hat und noch nicht an der Reihe ist. Ich stehe regelmäßig vor der
Contine, der kleinen Mensa am Conticampus für einen großen Haufen von Juristen, BWLern, Germanisten, Anglisten und vielen anderen Studenten, die sich hier herumtreiben. Schon die Fachrichtungen alle aufzuzählen macht mir keinen Spaß, weil es zu lange dauert.
Die Contine ist eine so kleine Mensa, dass dort auf jedem Tisch ein Klappkärtchen steht, auf dem steht, dass das Benutzen eines Laptops zwischen 12 bis 15 Uhr verboten ist, damit die Neuankömmlinge, möglichst noch während der Vorbesitzer den letzten Bissens herunterhastet, auf dem vorgewärmten Platz Platz nehmen können. Wenn die Mensa es verbieten könnte, wäre selbst das Sprechen während dem Essen nicht erlaubt, um Zeit zu sparen. Hier wird das Besteck wie ein Staffelstab gereicht.
Es gibt in der Contine insgesamt 6 Schalter, an denen man sich mit Essen versorgen kann, davon sind zwei vegetarisch und der Rest ist Fleisch mit Soße oder Pommes mit C-Wurst und Soße. Regelmäßig stelle ich mich hinten an, um dann mit Erschrecken festzustellen, dass ein Pulk von angeblich teilnahmslosen Studenten, die nur mal kurz vorbei wollen, um ihre Karte noch aufzuladen oder auf die Speisekarte zu gucken, an mir vorbeirennen und sich am nächstbesten Schalter anstellen. Das geht deshalb so gut, weil das keine Sau nicht interessiert. Außer mir armen Sau, die sich darüber echauffiert.
Neulich bin ich auch zuerst gucken gegangen. Ich sah das eigentliche Problem der Schlangen. Sie zerteilt sich in zwei Hauptschlangen rechts und links vom Besteckregal und zerfasert dann zu einem eher losen Pulk in kleinere Einzelschlangen. Das ist wie eine Sanduhr, die rückwärts läuft. Drinnen wird es dann so unübersichtlich, dass man sich regelrecht durchkämpfen muss. Hilfestellung leisten dabei die überdimensionierten Tablettes, die man bäuchlings vor sich herträgt und anderen in die Nieren presst. Dreht sich doch einmal einer um, guckt man schnell nach hinten und ruft empört, wieso hier so gedrengelt wird.
Gedrengelt. Gedränge entsteht häufig da, wo es eng wird. Dass die beiden Worte keine gemeinsame etymologische Wurzel haben, ist schon mehr als erstaunlich, wo sie einander doch bedingen. Aber wahrscheinlich ist das nur wieder irgendwann vergessen worden, wie bei den anderen Wortpaaren, die sich meist auch noch zufällig reimen oder sich nur deshalb voneinander unterscheiden, weil vorher ein paar Konsonanten hinzugekommen sind. Nomen est omen, sage ich da nur.
Jedenfalls bin ich dann doch wieder hinausgegangen und habe mich brav an das Ende der Schlange gestellt. Ich habe mich einfach nicht getraut, da vorn zu bleiben und mich irgendwo reinzunuscheln. Ich bekam schlechte Laune und stellte mir vor, dass das Essen, was ich gleich esse, die Reste von gestern aus der Hauptmensa sind*. Als ich dann mein Essen hatte und endlich zwei Plätze an einem Tisch fand, besetzte ich gleich beide Plätze. Mein Rucksack platzierte ich auf dem Stuhl neben mir, und jedem der fragte, sagte ich, der Platz sei besetzt. Davon steht nämlich nichts auf den Klappkärtchen.
*Wenn Sie sich einmal die Mühe machen wollen, dann folgen Sie dem Link und schauen sich die Pläne genau an. Meine Vermutung ist nicht so weit hergeholt, wie ich mir das wünschen würde.
Ich habe den Ascher vergessen. Premiere, frenetischer Beifall. Hochstimmung. Die Technik ist da ganz anders. Die Jungs bauen erstmal die Rampe für den Rollstuhlfahrer. Der sieht auch sein Gutes in ohne Beine, er darf durch die Hinterbühne zum Personalausgang, weil es da einen Fahrstuhl gibt. Da sieht er die Schauspieler sich feiern. Alle umarmen sich, während ich die Tür des Fahrstuhls ins Kreuz bekomme, weil ich die Lichtschranke nicht getroffen habe. Mein Chef hält die Tür zum Flur auf. Als wir fertig sind, kommt die Technik auf ein Gespräch zu meinen Chef. Da fehlte eine Ascher am Bühneneingang.
„Hast du den Ascher etwa nicht platziert?“ fragt er mich. Doch habe ich, erwidere ich. Ich habe den Ascher genau dorthin zurück gestellt , wo ich ihn vor dem Saubermachen hergeholt habe, auf den Requisitentisch im Vorraum. Ich hätte in die Mappe gucken sollen, in die Scheißmappe, wo immer alles drin steht. Ich Chaot, sagt mein Chef, dann ist das erledigt.
Wenn ich in einem ein Stück die Requisiten selbst zurechtlegen muss, renne ich immer wie angestochen über die Bühne, frage mich dabei mindestens einmal während der Vorbereitungen, wo ich diese verdammte Scheißmappe hingelegt habe, in der steht, wo welche Requisite hingehört. Ich bin total aufgeregt, gehe den Plan drei- bis viermal durch, gleiche alles ab.
Bei der Premiere bin ich immer ganz ruhig, weil ich da überhaupt nichts mache, außer so Kleinigkeiten wie ein bisschen Streu nachlegen oder einen Ascher vergessen. Da stehe ich ein wenig weiter weg und tue so, als ob mich das alles nichts anginge. Nur wer gezielt auf mich zukommt, bekommt ein dreifach Gespucktes über die linke Schulter serviert. Ich bin nicht dabei bei der Entstehung des Stückes, ich teile nie die Aufregung, ob alles klappt bei einer Premiere, weil ich meine ganz eigene Aufregung kultiviere.
Ich stehe bei den Premieren lieber im Abseits, lasse mich ungern umarmen und beglückwünschen. Ich bin ja nur der Verwalter dieser gewachsenen Struktur. Ich bin nur dabei, damit ich sehe, wie es später gemacht wird. Ich räume auf und ab.
Die Scheißmappe liegt immer irgendwo auf einem Tisch, wo ich zufällig vorbeikam und kurz Rast machte. Alles hat eben seinen Platz. Auch Ascher. Die Kippen liegen stattdessen auf dem Boden und ich sammle sie von Hand auf. Ich werfe sie in die Mülltonne der Bühnentechnik, auf der ein Zettel angeklebt ist, auf dem steht „Keine Lebensmittel!“
Heute bekam ich einen Anruf von jemandem, den ich schon sehr lange nicht mehr telefonisch gesprochen hatte. Ich konnte das Gespräch nicht annehmen, weil ich mich gerade in der Uni in einem Seminar befand, dafür aber konnte ich mich nicht mehr auf das Seminar konzentrieren. Ich malte mir aus, was er denn von mir wollen könne.
Wir haben einst zusammen gearbeitet, dann haben wir auch gemeinsame Freunde und Bekannte, wir haben auch schon einiges zusammen gemacht, Pokern zum Beispiel und zuletzt haben wir uns ein wenig aus den Augen verloren, weil wir eben nicht mehr zusammen arbeiten. Hin und wieder läuft er mir im Moritz über den Weg, einer Bar bei den Sportwissenschaftlern, die ich genauso beliefere wie das Spandau, aber eigentlich haben wir kaum noch etwas miteinander zu tun.
Und dann kommt dieser Anruf. Er wohnt in einer herrlichen Altbauwohnung mit ein paar langjährigen Freunden zusammen. Einer unserer gemeinsamen Freunde ist kürzlich ausgezogen, ich habe dabei geholfen, und auch sonst scheint es ja gerade einige Veränderungen in seinem Umfeld zu geben und da dachte ich, vielleicht löst sich ja seine WG auf und er will mich nun fragen, ob wir in die Wohnung ziehen wollen.
5 Zimmer, Küche, Bad, direkt am Lindener Marktplatz gelegen, Balkon, sogar zwei Bäder, alles Dielenfußboden, ein bisschen abgerockt vielleicht aber eigentlich eine echte Traumwohnung. Das Zimmer ganz vorn ist ein wenig dunkel aber als Kinderzimmer geht das wohl, danach käme das Wohnzimmer mit Balkon, dann ein weiteres Kinderzimmer und ein Arbeitszimmer und zu guter Letzt, nach hinten raus würden wir unser Schlafzimmer einrichten. Laut ist es allerdings nicht dort, weder von der Straße, noch von Nachbarn, denn darüber wohnt niemand mehr und es ist auch die einzige Wohnung dieser Etage.
Ich müsste wahrscheinlich die Dielen abschleifen, also nur oberflächlich, tapezieren muss ich dann auch, wenigstens die Küche und die großen Zimmer, der Flur braucht nur einen neuen Anstrich. Ein kleiner Wermutstropfen ist, dass dort mit Gas gekocht wird, wo wir uns doch vor einiger Zeit ein Induktionskochfeld zugelegt haben. Die Küche muss ich sowieso komplett umbauen, die passt so gar nicht in den Raum.
Ich rief ihn zurück, gleich nach Ende des Seminars, er ging nicht ran. Er rief kurz darauf zurück, was ich nicht bemerkte und erst als ich dann wieder anrief, hatte ich ihn am Apparat. Er wollte wissen, warum ich immer so viel unterschiedlichen Käse kaufe, wo sie doch eigentlich nur eine Sorte benutzen würden, nämlich den Gouda für die Burger. Darauf wusste ich keine Antwort, ich hatte gerade ein paar Lampen angeschraubt.
Das Referat war für den Garten. Ich habe nicht hingehört, mir meinen eigenen Reim drauf gemacht und meinen Kommilitonen mit hineingeritten in den Quatsch, den ich verzapft habe. Wir sollten doch tatsächlich einen inhaltlichen Überblick über die Epoche des Kolonialismus geben. Ich konnte das nicht glauben, als der Dozent das damals gesagt hatte, schließlich sitzen ja keine Erstsemester in diesem Fachdidaktikseminar.
Der Kurs richtet sich ja vor allem an Leute, die ihr Fachpraktikum im Master absolvieren wollen oder einen zweiten Schein für ihr Didaktikmodul benötigen. Es wäre sicherlich ganz nett, wenn man bereits im ersten Semester damit konfrontiert wäre, dann würde man womöglich nicht erst nach 3 oder mehr Semestern* merken, dass einem das Ganze nicht liegt. Sind aber keine Erstsemester im Kurs, mindestens 3. Semester, wir hatten uns am Anfang einander vorgestellt, das wäre mir aufgefallen, wenn da ein Erstsemester dabei gewesen wäre. Ist ja auch egal.
Inhaltlich sollten wir arbeiten, wir sollten dem Plenum die Epoche des spanischen Kolonialismus vorkauen. Indigene Kulturen, Kulturkontakt, Sklavenhandel, Konquistadoren usw. Schaubilder, Karten, Jahreszahlen, Persönlichkeiten. Das sollten wir machen. Gemacht haben wir eine Schulbuchkritik. Verkackt halt.
*Wenn Ihnen das m in Semestern abhanden kommt, kommt Seestern raus, das finden sie mit keiner Rechtschreibkontrolle. Das nützt Ihnen jetzt nichts, verdeutlicht aber die ungefähre Entfernung des Themas unseres Referats von der eigentlichen Aufgabenstellung.
Ich habe heute schon wieder ein Referat zu halten. Diesmal geht es um Schulbücher und was diese aus bestimmten Themen so machen. Unser Thema ist dabei der Kolonialismus. Diese Zeit umfasst schon ein paar Jahre und so wundert es nicht, wenn in der Schullaufbahn gleich mehrmals darauf zu sprechen gekommen wird, einmal in der Sek. I und ein weiteres Mal, zumindest in Niedersachsen, in der Sek. II.
Ich hatte bereits zuvor aufSchwachstellen in der Schulbuchthematik hingewiesen, die wir in einem anderen
Seminar erörtert hatten. Hier gestaltet sich der Anspruch zumindest in Teilbereichen ein wenig besser, wenngleich auch hier wieder unnötig plakatiert und weniger auf sinnvolle Zusammenhänge geachtet wird.
Ein wirklich schönes Beispiel dafür war eine Abbildung aus dem 16. Jh., die Montezuma und Cortés in Verhandlungen zeigen. Dazwischen steht
Malinche als Übersetzerin. Weder wird in den Texten noch in anders gearteten Quellen auf diese Abbildung verwiesen. Es gibt keinerlei Erklärung, wer Malinche gewesen ist, und auch eine Aufgabenstellung zu der Abbildung, wie sie zu den anderen Bild- und Textquellen durchaus vorhanden sind, wird nicht vergeben. Da prangt also einfach eine Illustration, die knapp 1/5 der gesamten Seite einnimmt in diesem Schulbuch und niemand außer vielleicht die Lehrkraft hat eine Ahnung, worum es dabei gehen könnte.
Das zweite Beispiel, aus einem anderen Schulbuch, hat dagegen durchaus überzeugt, zumindest was die Auswahl der Text- und Bildquellen anging. Das ist auch kein Wunder, denn ein in der Geschichtsdidaktik sehr geläufiger Name taucht als Herausgeber auf,
Dr. Hans-Jürgen Pandel. Die Aufgabenstellungen, die das Kapitel bereithält, sind manchmal ein wenig weit weg vom lebensweltlichen Kontext der Schülerinnen und Schüler, aber es gibt genügend Alternativen in dem Buch, um Peinlichkeiten möglichst gering zu halten, siehe dazu „Stellt euch eine Szene vor, in der spanische Eroberer einer Gruppe von Indianern den Text von Q1 (die Quelle 1 ist ein Text, den die Spanier, den Indianern in spanischer und lateinischer Sprache vortrugen, wenn sie von dem Land Besitz ergreifen wollten) vorlesen. Baut euch zu einem Standbild auf. Versucht in eurer Haltung auszudrücken, was die Menschen damals gedacht und gefühlt haben.“ In der 7. Klasse, hätte ich mich schlicht geweigert, so eine Aufgabe zu machen, das wäre mir hochpeinlich gewesen.