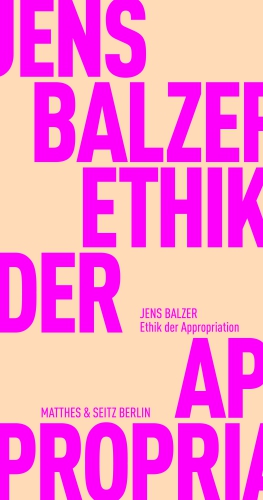Ich war überpünktlich. Die Dauer der Veranstaltung ist von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr ausgewiesen. Das bedeutet so viel wie, es geht um Viertel nach los und endet um Viertel vor. Ich betrat den Seminarraum um Punkt 10. Es sollte um Fallanalysen in Lebenswelten von Schülern gehen. Es waren kaum noch Plätze frei, bis auf die wenigen ganz vorn im U der Runde. Der Dozent ein junger Mann, vielleicht sogar jünger als ich, war ziemlich aufgeregt, hatte aber alle Sinne beisammen. Sozusagen war sein Lieblingswort, manchmal wunderte ich mich, dass er nicht aus Versehen einmal „sozusagen sozusagen“ sagte, aber ein Wort passte ihm dann doch immer dazwischen. Was sich anfangs noch als schleppend und unangenehme Ein-Mann-Show präsentierte, wechselte im Verlauf der Sitzung zu einer doch eher entspannten Konversationsrunde. Sehr angenehm.
Gleich zu Anfang der Sitzung erbat sich der Dozent beim Vorübergleiten der Anwesenheitslisten von irgendeinem Studenten eine Büroklammer, um die beiden losen Blätter aneinander zu heften. Da ich der letzte war, dem diese Chance zuteilwerden würde, verzichtete ich darauf in meinem sowieso hoffnungslos unaufgeräumten Rucksack nach einer solchen zu suchen. Mir gegenüber ging es aber sogleich zur Sache. Mehrere kramten in ihren Federetuis…, Moment, Federetuis? Ja, richtig. Unauffällig zählte ich die Teilnehmer und diejenigen, die ein Federetui besaßen und ich kam auf ein Verhältnis von fast 2:1. Also jede Zweite besaß ein Federetui. Ich sage mit Absicht, jede Zweite, nicht weil ich mich dem generischen Femininum verschrieben hätte, sondern weil es mit mir und dem Dozenten nur noch zwei weitere Männer im Raum gab, und wir hatten allesamt kein Federetui.
Wie bereits geschrieben, war meine Sitzposition äußerst ungünstig, nicht nur saß ich ganz weit vorn, außerdem auch direkt neben der Tür, eine Tür übrigens, die sich von außen nicht öffnen lässt, wenn man nicht schon mindestens einmal mit ihr gekämpft hat. Zwei Unterbrechungen gab es dann kurz nach Beginn, einmal wurde entnervt aufgegeben, ich konnte auch niemanden mehr entdecken und beim anderen Mal klopfte es und der Dozent sprang sofort auf und öffnete die Tür von innen; das geht übrigens problemlos, soviel also zu den Zulassungsbeschränkungen.
Noch ärgerlicher war aber, dass die Tür im Vestibür nicht richtig schloss, stattdessen hatte sie sich darauf verlegt, laut zu knarzen. Da hinter dieser Tür ein allseits beliebter Rauchplatz liegt, wurde die Tür ständig aufbewegt und dann kroch sie im Schneckentempo und Elefantenlautstärke wieder zurück.
Hinzu kam, dass der Dozent aus meiner Sicht mit mindestens der Hälfte des Kopfes hinter einem
Polylux verschwand. Das erinnerte mich an den gestrigen Kneipenabend mit
Trithemius, wo ich ihm beichtete, wie ich meinem ehemaligen Geographielehrer so manchen Streich gespielt hatte. Heute habe ich deshalb ein schlechtes Gewissen, früher war ich da abgehärteter. Mein Lehrer hatte ein Glasauge, ich saß ihm direkt gegenüber, nur in der letzten Reihe. Vor mir saßen auch keine kleinen Leute. Wenn er mich direkt ansprach, was häufiger vorkam, weil ich Geographie immer sehr gemocht habe, wechselte ich hin und wieder zwischen der rechten und der linken Seite, um an den vor mir Sitzenden vorbei zu sehen. Für ihn war das natürlich nicht so leicht wie für mich, weil er ja mit dem einen Auge nicht sehen konnte, und so wurde eine kleine Bewegung von mir zu einer maximalen Streuung am Lehrertisch. Wie ein Schunkelmännchen am Biertisch bewegte sich sein Oberkörper hin und her, seine Beine waren dabei um die Beine des Stuhls geschlungen, als ob er fürchten musste gleich abzuheben. Dabei war er immer so bei der Sache, dass ihm gar nicht auffiel, wie komisch das war, jedenfalls hatte ich weiterhin gute Noten.
Und so verbrachte ich meist schweigend, zählend oder in Gedanken versunken den Großteil des Seminars. Als die Stunde um war, verließ ich dann den Klassenraum und kurz darauf das Gebäude, nicht ohne der Tür im Flür einen missbilligenden Blick zuzuwerfen.
Bin im Theater. Es läuft bereits und ich vertreibe mir die Zeit, indem ich in der Cafeteria den Gesprächen lausche. Nebenbei tue ich so, als läse ich in einem furchtbar interessanten Zeitungsartikel. Es liegt nämlich immer ein Pressespiegel vom Tage herum, in dem all die für den Kulturbetrieb relevanten Artikel hineinkopiert und gebündelt werden.
Heute ist oben auf der kleinen Bühne ein Vorsprechen und dafür sind einige Leute angereist, die ich noch nie gesehen habe. Die erzählen sich dann beim Bier ihre dicksten Geschichten, packen noch eine Ladung oben drauf und schlingern mit diesem Karren in meinen Gehörgang, nicht ohne das ein oder andere dabei umzustoßen.
Gerade in diesem Moment sitzt ein Nachwuchsschauspieler mit einem altgedienten Techniker beisammen. Der Alte hat den Jungen auf ein Bier eingeladen und sie unterhalten sich über Beleuchtung. Der Nachwuchsschauspieler erzählt gerade, wie er an einem Regler für die Beleuchtung sitzt, der Regisseur von unten ruft, weiter, ja, noch weiter, während er oben längst die Hand vom Regler genommen hat und sich gähnend die Hand vor den Mund hält und plötzlich von unten ein, ja, so ist es gut, ertönt, so lassen wir das.
Jetzt kommt Bewegung in den Techniker. Er erzählt den gleichen Vorgang in einem Dutzend von Varianten nochmals, bis auch der letzte heimliche Zuhörer, also ich, bemerkt hat, dass er längst Bescheid weiß und dass das eigentlich seine Geschichte gewesen ist, die sich der Jungspund hier nur in einem Anflug von Größenwahn unter den Nagel gerissen hat. Und das, wo er ihm doch gerade ein Bier ausgegeben hat. Zusätzlich zu dem Variantendutzend gibt der Techniker nun auch noch unterschiedliche Erklärungen dafür ab, weshalb das immer so läuft, und weshalb nicht einfach die empfohlenen Einstellungen der versierten Techniker übernommen werden. Es geht zum Beispiel darum, als Regisseur das letzte Wort zu haben, den größten Hut, den tollsten Schal und überhaupt das dickste Schlüsselbund, das Schlüsselbund des Intendanten zu besitzen. So läuft das eben, beschwört der Alte seinen Jünger.
Ich habe jetzt eine ungefähre Vorstellung von der Größe des Schlüsselbundes des Jungschauspielers. Es ist definitiv kleiner als das des Technikers. Ich hole mein geborgtes Requisitenschlüsselbund hervor, wo sich auch eine kleine Variante des großen Universalschlüssels der gesamten Schließanlage des Hauses befindet. Ich atme hörbar die Luft ein, prüfe noch einmal die ganzen Bärte der Requisitenschlüssel, denke an die ganzen alten Zöpfe und kann ein Gähnen nur mühsam unterdrücken.
Meine Tochter bekommt seit geraumer Zeit einen Brei zu Mittag vorgesetzt. Den isst sie je nach Inhalt und Befinden entweder vollständig auf oder nur zum Teil, worüber ich mir selten große Gedanken mache, denn satt wird sie, das sehe ich ihr an. Nun passiert es jedoch hin und wieder, dass sich zusätzlich zu dem pürierten Gemüse auch ein Zusatz im Brei befindet. Das ist eine Paste die aus pürierter Hähnchenbrust besteht und von uns, der wir sonst den Brei komplett selbst herstellen, hinzugekauft und untergemengt wird. Egal welche Art Brei, und mag das Gemüse noch so exotisch sein, egal ob Pastinake, Süßkartoffel oder schlicht Möhren, sie isst ihn dann auf. Diese kleine Zutat, die pürierte Hähnchenbrust scheint dafür verantwortlich.
Auffallend in diesem Zusammenhang ist die offensichtlich sehr geringe Menge, die auf den Gesamtgeschmack wirkt. So ähnlich stellen wir das auch fest, wenn wir einen Longdrink bestellen, der ja zum größten Teil aus „Brause“ besteht und nur einen kleinen Teil, Gin, Wodka oder was weiß ich enthält. Trotzdem wird der Gin in „Gin Tonic“ als erstes, geschmackgebendes Element genannt und erst darauf folgt die Tonic. Auch bei der Wahl des Artikels, Sie haben es sicher gemerkt, spielt sich hier etwas Merkwürdiges ab. Das kann auch einfach an mir liegen, ich vermute aber, dass man sich zumindest drüber streiten könnte, ob es die Tonic aber der Gin Tonic heißt. Bei Komposita im Deutschen bestimmt nämlich eigentlich das zweit- bzw. letztgenannte Wort, das Geschlecht.
Sei es, wie es sei. Was sollte ich von einem kommentierten Vorlesungsverzeichnis des Deutschen Seminars halten, wenn sich darin nur eine einzige Veranstaltung findet, die als Vorlesung ausgewiesen ist und alle übrigen – mehr als 80 an der Zahl – aber Seminare sind? Sollte diese eine Veranstaltung dann nicht auch über eine „besondere Würze“ oder Note verfügen und nicht wie vorgefunden lediglich eine Einleitung in die Literaturwissenschaft geben?
Ich habe das schon erlebt, diese „besondere Würze“, und nicht zu knapp. Nicht selten waren Trithemius und ich beide zu diesen Veranstaltungen gegangen und haben, nicht nur in den Gefilden der Literaturwissenschaft, sondern auch über den „Tellerrand“ hinaus blicken dürfen. Ich habe darüber sogar
schon berichtet. Das finde ich persönlich ein wenig schade, denn der Titel „Kommentiertes Vorlesungsverzeichnis“ verspricht zwar keine spezielle Note, lässt mich und meine Gewohnheit aber daran denken.
Wenn du 50,- € brauchst, dir aber 50,- € fehlen, dann brauchst du sogar 100,- €, nämlich die 50,- €, die dir fehlen und dann noch die 50,- €, die du brauchst. Haben oder Nichthaben. So ungefähr muss man sich das vorstellen in der Küchen- und Kneipenpsychologie, -mathematik. So oder so ähnlich hat den Spruch ein jeder schonmal irgendwo gehört oder selbst erzählt. Ich kann es nicht mehr zählen, wie oft ich diesen Spruch schon gehört habe, und leider meistens in der Situation, wo mir tatsächlich etwas fehlte.
Gestern Abend fehlte mir auch etwas. Ich ging in den Supermarkt und suchte ein paar Kleinigkeiten für das Abendessen zusammen. Ganz zum Ende machte ich vor dem Süßigkeitenregal halt und wurde auch dort fündig. Mit meinen 11,- € aus dem Portemonnaie ahnte ich, es würde vielleicht nicht reichen. Ich hatte genau drei 2,- € Stücke und einen Fünfer, als ich zur Kasse ging. Ich überschlug die Summen im Kopf und kam auf 12,- €, dachte aber, dass ich ja großzügig aufrundete.
Die Waren laufen piepend über das Fließband, der Pegel steigt. 6,54 €, 7,38 €, 9,41 €.
„11,50 €, bitte“, sagt die Frau an der Kasse. „Hab‘ ich nicht“, hauche ich zurück, das Wasser steht mir schon im Hals. Ich sortiere die Süßigkeit wieder aus, ein bisschen enttäuscht. Ich lege sie rüber und vermelde traurig: „Das bleibt dann hier.“
Sie dreht sich um, schaut über die Regale, klingelt an einem Knopf, es piept irgendwo im Gang. Ihre Chefin muss das Ganze stornieren. Es ist 21:45 Uhr, eine Viertelstunde vor Feierabend. Bis eben war der Laden komplett leer, jetzt steht eine Schlange hinter der Kasse. Alles guckt möglichst unbeteiligt und ärgert sich insgeheim über den Penner an der Kasse, der zu blöd zum Rechnen ist, das bin ich. Ich stehe auch da und starre fassungslos in meine Geldbörse.
Ich krame nochmals darin herum. Ich finde, eingekeilt zwischen dem ausgewaschenen rosa Lappen, einen weiteren Fünfer. Ich drehe mich triumphierend zur Verkäuferin herum, schwenke mein Friedensangebot und will dann alles bezahlen, als schon die Chefin um die Ecke kommt. Stornieren muss sie trotzdem und die Verkäuferin gibt dann alles nochmal ein. „11,50 €, ja?“ fragt sie mich. Ich gebe ihr meinen zweiten Fünfer zu dem ersten und eines meiner 2,- € Stücke. Sie hat von mir 12,- € erhalten und sagt erneut in leicht dummfrechen Tonfall „11,50 €, ja?“, ich nicke und sie gibt mir 1,50 € wieder raus.
Ich hatte kurz überlegt, ob ich dazu was sage. Ob ich vielleicht die Frechheit besessen hätte, mir von ihr mein Kleingeld zu einem Fünfer wechseln zu lassen. Mir fiel diese Redewendung ein, mir fiel ein, wie ich hier bedröppelt an der Kasse stand und „hab‘ ich nicht“ hauchte, wie entnervt rollende Augen den Laden inspizierten, um nach der Chefin zu suchen, wie die Schlange an der Kasse in den Laden hineinwuchs, wie peinlich das alles war; dass mir nicht einmal eingefallen ist, einfach meine EC-Karte zu zücken, wie die dämliche Kuh mich dreimal fragte, ob es denn jetzt 11,50 € seien, ob ich auch alles dabei habe oder ob ich nicht noch eine Packung blaue Säcke oder so… Nein! Ich behielt das Geld, stopfte die Sachen in meinen Rucksack und stapfte aus dem Geschäft.
Den ganzen Tag über schon beschlich mich das Gefühl, auf die Toilette zu müssen. Ich ging, ein ums andere Mal. Zuletzt, ich war gerade dabei die Requisiten des Stückes einzuräumen, konnte ich nicht, weil ich die Arbeit ungern an dieser Stelle unterbreche. Nachher fehlt irgendetwas beim Wiederaufbau und mir oder jemand anderem schwant von diesem Abend und meiner lausigen Arbeitsmoral. Ich unterdrückte also das Gefühl, unterbrach meinerseits die Arbeit der Kostümabteilung, indem ich ihnen von dem verschwundenem Stahlhelm erzählte und erntete dafür sogleich eine volle Box mit Kleidern, die noch auf der Bühne verblieb, als die beiden Frauen längst schon in der Bahn oder im Bus oder auf dem Fahrrad die Heimreise angetreten hatten.
Den ganzen Tag über schon brodelte es. Ein wirklich schlechter Tag kündigt sich ja nicht einfach so an, er beschließt sein Ende in einem fulminanten Finale aus Kleinigkeiten. Man merkt erst ganz zum Schluss, in der Rückschau, sozusagen, was sich alles abgespielt hat. Dann zieht man einen Summenstrich drunter, rechnet nach: da haben wir’s ja, ein wirklich beschissener Tag.
Nach getaner Arbeit stehe ich am Waschbecken und will mir die Hände waschen. Es ist das hundertste Mal, beschleicht mich ein Gefühl, weil ich ständig irgendwo in Schuhcreme hineinfasse, die wahllos auf der Bühne verteilt in Ecken lauert, wo ich gerade meine Griffel anbringe. Sie gehört zum Stück, ich gehöre irgendwie auch dazu, also habe ich gefälligst Schuhcreme an den Händen.
Ich stehe also vor diesem Waschbecken, ziehe meine Finger in Richtung Handfläche, weil man das so macht, wenn man Seife aus dem Spender haben möchte, und muss feststellen, dass mir die Seife zwischen Mittel- und Ringfinger hindurchrinnt, nicht ohne eine hauchzarte Spur in der Mulde zu hinterlassen. Die Spur reicht nicht und ich versuche ein weiteres Mal mein Glück, denke aber nicht daran, auch nur eine Kleinigkeit anders zu machen als zuvor, mit dem gleichen Ergebnis.
Ich wasche mir die Hände und will sie gerade an den sensorgesteuerten Papierzuführer halten, als ich bemerke, dass dieser alle ist. Da habe ich den Strich gemacht, vorsichtshalber, nachher stimmt mein Urteil von dem fulminanten Ende gar nicht. Vielleicht - ach!
Es ist wieder soweit. Das neue Semester beginnt. Heute wurden die letzten Veranstaltungen des Deutschen Seminars freigeschaltet. Punkt 10 Uhr hieß es deshalb für mich, am Rechner zu sitzen, den Aktualisierungsbutton im richtigen Moment zu drücken, die Leitungsgeschwindigkeit zu verfluchen und abzuwarten. Ich bin in genau eine Veranstaltung hineingekommen heute. Auf den anderen 3 Veranstaltungen stehe ich auf Wartelistenplätzen 3, 11 und 36, denn wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen: nur wenige Minuten nach offiziellem Freischalttermin kommt man nur noch auf Wartelistenplatz 36!
Ich gebe zu, diese Veranstaltung habe ich nicht in einem extra Tab meines Browserfensters geöffnet. Ich habe sie mir erst herausgesucht, als abzusehen war, dass ich bei den anderen auf Wartelistenposition einsteige. Das dauert natürlich extra lange, weil es drei verfluchte Seitenaufbauten benötigt, um ein Seminar zu auszuwählen: „Veranstaltung suchen“, „Namen eingeben“, „Auswählen“. Dann folgt noch ein weiterer Schritt, bei dem ich mich in die Veranstaltung einzutragen habe. Minutenlanges Warten und ständiges Herumblättern in den jeweiligen Tabs und Fenstern.
Seit gestern lese ich „Der Schaum der Tage“ von Boris Vian und auf Seite 66 meiner Zweitausendeinser Ausgabe sagt Chick zu Colin: „Die Erwartung ist ein Präludium in Moll.“ Ich hatte mir diesen Satz unterstrichen, obwohl er eigentlich nicht meinen Prinzipien entspricht, ich erwarte lieber nichts, dann überrascht mich auch nichts. Nach meiner heutigen Erfahrung weiß ich auch wieder, warum ich mich vor langer Zeit darauf verständigt habe. Der Satz ist aber trotzdem schön.
Gestern tat ich meinen letzten Dienst am Strandleben für dieses Jahr. Es waren nur zwei Stunden, Gäste hatten wir kaum, dafür aber jede Menge aufzuräumen, weil am Nachmittag doch noch einige das schöne Wetter genutzt und dem Strandleben einen Besuch abgestattet hatten. Davon bekam ich nichts mit, weil ich den Nachmittag im Zoo verbracht hatte und erst am frühen Abend meine Schicht antrat. Da war bereits alles gelaufen.
Alle Menschen, die ihren Tag gestern übrigens nicht am Strandleben verbracht hatten, sind mit ihren Kindern in den Zoo gegangen. Würde der Eindruck nicht ein wenig einseitig daherkommen, müsste ich angesichts der Kinderschwemme im Zoo den demographischen Wandel als ein Schreckgespenst abtun, mit dem uns die Politik nur höhere Rentenbeiträge aus dem Kreuz leiern will, um die nächste Diätenerhöhung finanzieren zu können. Ich aß den halben Zoo leer, hatte ich das Gefühl. Hier noch eine Brezel, da ein Eis, ein paar Nudeln noch und das mitgebrachte Essen musste auch dran glauben. Mein Sohn, dessen Augen noch größer waren als mein Magen, bestellte und ich aß es dann auf, wenn er die Lust verloren hatte.
Der Samstag ist ebenfalls ruhig verlaufen. Die Party am Abend war voll, laut und verraucht und ich war erstaunlich früh, also vor 12, zu Hause. Ich fühlte mich unwohl wegen der ganzen Erdnussflipse, die ich essen musste. Die Schüssel stand direkt da, wo ich mich hingesetzt hatte und ich hörte nicht eher auf, in diese hineinzugreifen, bis sie restlos alle war. Dass ich vorher bereits das vegane Chili con Carne in ausreichender Menge zu mir genommen hatte, hätte ein unbeteiligter Beobachter niemals für möglich gehalten. Davor, keine zwei Stunden her, war ich beim Chinesen und hatte mir zur Feier des Tages eine kleine knusprige Ente mit Reis und Gemüse servieren lassen, die ich im Kreise seiner Familie zu mir nahm. Seine drei Kinder spielten im Gastraum mit Lego, die beiden älteren Kinder schmiedeten und verwarfen Allianzen, während der Jüngste die Roboter, Flugzeuge, Raumschiffe und anderen Ungetüme in Masse produzierte, die dann die älteren unter sich aufteilten.
Wenn wir zwei zusammen kämpfen, können wir doppelt so stark sein, sagte das Mädchen zu ihrem Bruder, und der meinte, das ginge nur, wenn sie ihn dann genau so stark machen würde, wie sie ist. Das machte der Jüngste möglich, weil er gerade ein zusätzliches Gerät entworfen hatte, dass die Flotte gegen ihn erweitern sollte. Der Jüngste blieb dabei völlig gelassen, er selbst hatte eine immense Anzahl von Kriegsgerät vor sich versammelt und in absehbarer Zeit konnte die geschmiedete Allianz der beiden älteren nicht reichen, um ihn auch nur annähernd zu gefährden.
Ich aß die Ente währenddessen, die sich zu der Brezel gesellte, die ich am Strand vertilgt hatte. Denn auch am Samstag hatte ich die Schlussschicht am Strand und da gibt es Brezeln. Es war ein trauriger Dienst, den nicht einmal die Gespräche mit meinem Arbeitskollegen aufheitern konnten. Wir spürten beide, dass es sich wohl demnächst erledigt hat mit dem Strandleben.
Heute Morgen hatte ich zum ersten Mal seit zwei Tagen keinen Hunger, dafür hatte mein Sohn seinen Füßen über Nacht Namen gegeben. Greta hieß sein linker und Balu sein rechter Fuß. Ich überlegte, ob ich ihm sagen sollte, wie mein Bauch heißt, verwarf den Gedanken aber wieder, weil mir etwas Besseres als Balu auch nicht eingefallen wäre, und so hieß ja schon sein Fuß.
Ich sah durch die Scheibe alle Personen der ersten Sitzreihe doppelt, sie waren sich dabei nicht unbedingt gleich, obwohl es doch identische Personen waren, weil eine der beiden Personen schärfer und deutlicher zu sehen war als die zweite.
Ich und Ich in einem Roman namens Narcopolis versus sie und sie in einer Fensterscheibe. Ich saß in einer moderierten Lesung von irgendeinem Autor, dessen Name mir zu kompliziert war, um ihn mir zu merken. Das Buch heißt Narcopolis und hat einen Preis gewonnen. Es geht um Opium und Bombay. Die Simultanübersetzung, meine erste übrigens der ich beiwohnen durfte, war ziemlich gut. Dennoch hatte ich ständig das Gefühl, etwas zu verpassen, ein Gefühl, dass sich auch nicht abstellen ließ, als ich auf die Übersetzung verzichtete, denn ich verhungere zwar nicht im angelsächsischen Raum aber ich werde auch nicht satt, dafür spreche und verstehe ich einfach zu wenig Englisch.
Das Buch interessierte mich, schon wegen des 9 Seiten langen, ersten Satzes, der im Englischen nur 6 ½ Seiten lang ist, was ich auf die Buchpreisbindung und ihre Pervertierung im deutschsprachigen Raum zurückführe. Das Buch sollte 22,99 Euro kosten. Soviel hatte ich nicht bei. Es war dann auch keine Kaskade wie bei Kerouacs „On the Road“, vielmehr eine Ansammlung von Haupt- und Nebensätzen, die man sehr wohl durch Punkte hätte trennen können. Die eigentliche Wirkung, nämlich zu beschleunigen, sollte gar nicht Ziel sein. Entschleunigen sollte dieses Satzkonstrukt, leider lebt diese Entschleunigung nur durch die Erklärung, genauso wie auch der endlose Satz beim Vorlesen nicht wie ein einziger Satz klingen konnte. Das enttäuschte mich.
Von dem folgenden Interview habe ich leider kaum etwas behalten. Ich schließe das auf meine Ungewohnheit, englische und deutsche Sprache in gleicher Lautstärke wahrzunehmen. Aber eine Frage aus dem Publikum am Schluss der Lesung habe ich behalten. Sie fragte nach der Paradoxie, die sich ergibt, dass man aus gutem, bildungsbürgerlichen Hause kommend, einem gewissen Erfolgsdruck unterliegt, der einen zur Droge greifen lässt, und genau aus der Schilderung dieser Begebenheiten innerhalb eines Romans ist man als Autor plötzlich erfolgreich. Ob es dafür eine Erklärung gibt? Natürlich nicht. Die Frage ist anmaßend, denn sie stellt den Autor auf eine Stufe mit dem Protagonisten des Romans, sie macht sie gleich, wo doch genau das nicht Ausdruck des Schreibens gewesen sein sollte.
Ein Autor beantwortet diese Frage nicht, gerade auch und im Angesicht des anderen, vielleicht schon älteren Werks, was mit dem Erfolg des neuen Romans ja nicht zwangsläufig etwas zu tun haben muss. Und so war es auch, wenngleich mir die Antwort insgesamt zu höflich ausfiel. Es gibt darauf keine Antwort, es gab auch hier keine, nur Herumgedruckse. Ich sah des Autors Gesicht nicht aber das Gestammel bei der Antwort verriet die Fassungslosigkeit über das scheinbar unbedarfte, ja naive Publikum.
Ja, und dann geschah mir die anfangs geschilderte Szene, wo die Personen, entrückt von sich selbst, plötzlich doppelt erschienen in der Fensterscheibe. Dieses Gleichnis zum Erzähler, dem Ich, und dem Ich der Opiumpfeife, welches die Geschichte erzählt, drängte sich mir auf und ich schaltete ab.
Trotzdem war es ganz nett, für das erste Mal Simultanübersetzung, für das erste Mal Literarischer Salon Hannover.