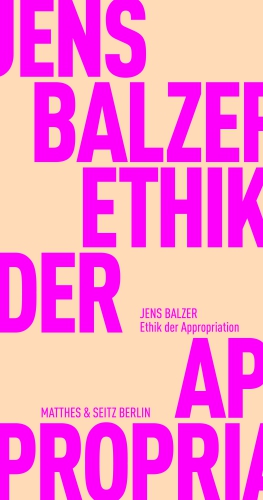Hiermit begann die Reihe um die Vorlesung "Angewandte Literaturwissenschaft":
Text 1.
Am Meer
„Seht dort jenen Surfer gleiten,“
Chapeau! Nur wenige Lyriker der letzten tausend Jahre – sinngemäß umriss Martin Rector einmal seine 2-semestristige Vorlesung „Höhepunkte deutscher Lyrik“ so – hatten Gelegenheit von einem Surfer zu schreiben.
Doppelt Chapeau! Nur wenige Vorlesungen trauen sich vom altbewährten Muster derart radikal abzuweichen. Ich hätte es natürlich wissen können, denn in Ansätzen ist das Konzept bereits in der Ringvorlesung „Leibniz und die Aufklärungskultur“ verfolgt worden, wenn auch dort das Dialogische längst keinen so großen Stellenwert besaß, wie es heute der Fall war.
„wie er kreuzt und wie er powert“
Im Dialog lag dann auch die vermeintliche Stärke beider Dozenten, man merkte es ihnen an wie beide kreuzten und powerten. Es war ein ständiger Wechsel der Ausführungen, der Moderator, der die Fragen möglichst kurz und verständlich formulierte und dem Gastdozenten, der möglichst ausführlich und genau zu antworten versuchte. Man fühlte sich gut unterhalten. Es fehlten die Kameras, die großen bequemen Sessel und das obligatorische Getränk auf dem kleinen Beistelltischchen und dann wäre mir das Format wohl allzu bekannt vorgekommen. So blieb der Rahmen, wenn auch nur des Protokolls wegen dann doch eine Vorlesung und keine Talkshow zur besten Sendezeit.
Auch ich will hier ein wenig kreuzen, denn mein Rahmen soll dieses Gedicht sein, welches ich in der Laudatio ANH’s ( einem Blognachbarn ) zur Vergabe des Literaturpreises der Literatur Nord an Dirk von Petersdorff fand ( ich fand die Laudatio im Netz als PDF zum Herunterladen, sowas soll’s geben ). Ich möchte dabei allerdings nicht ganz so offensichtlich vorgehen, wie es in der Vorlesung der Fall war, indem ich zwischen meiner leidlichen Analyse dieses Gedichts und des Gesprächs beider Dozenten hin und her wechsle.
Das Kreuzen ist auch nicht alles, was passiert ist in der „Vorlesung“. Interessant erscheint zunächst noch das powern. Was vormals, beim Rufen „Seht dort jenen Surfer gleiten“ noch als elegante Fortbewegung auf dem Wasser wahrgenommen werden sollte ( gleiten ), wandelt sich bereits hier zu einer machtvollen, kontrollierten Bewegung in unkontrollierbarem Gewässer. Der Surfer powert! Welcher Lyriker der letzten tausend Jahre konnte mit diesem Verb eine Zeile beschließen?
„durch die wind-verwehten Weiten,“
Hier wird klar, dass es mehr braucht als einen Surfer auf dem Meer, der Surfer braucht Wind; Luftbewegung, die Wellen schafft, Segel füllt und letztendlich die Kraft abverlangt, zu dessen Vergnügen sich der Surfer dem Meer ausliefert. Die heilige Dreifaltigkeit des Surfens sozusagen.
Wir waren ebenfalls zu dritt in der Vorlesung ( natürlich nicht im wörtlichen Sinne ), es gab den Moderator, den Gast und das Publikum. Wem jetzt welche Rolle zukam, möchte ich hier gar nicht weiter erörtern, denn die Runde war im allgemeinen recht locker und auch wenn klar war, dass die beiden Dozenten das Heft in der Hand hielten, so blieb tatsächlich Raum für eigene Überlegungen, die, formuliert in thematisch völlig offenen Fragen, an den Gast gestellt werden konnten. Die Ausbeute war nicht berauschend und die Fragen gingen auch nicht in die Tiefe, die Antworten allerdings waren ausführlich und unverbindlich.
„wo das Meer im Licht erschauert.“
Von einem Schauer konnte bei der Vorlesung keine Rede sein, weder ein wohliger noch ein schrecklicher stellten sich ein. Der herben Kritik aus meinem Anfangstext kann ich nichts hinzufügen, ich muss sogar revidieren. Ehrlich gesagt gab es bis auf die fehlenden Sessel und das Erfrischungsgetränk ( auf Kameras kann ich verzichten ) nicht viel zu kritisieren. Von der hemmenden Ehrfurcht war nicht viel zu spüren, kein Erschauern. Trotz der 5 gestellten Fragen, die größtenteils von den „üblichen Verdächtigen“ gestellt wurden, also denen, die auch sonst bereitwillig mitarbeiten und diese Art Berührungsängste womöglich gar nicht kennen, hatte ich nicht das Gefühl, dass der Charakter der Veranstaltung eher einem Seminar mit Minimalbesetzung glich.
Die Frage war ohnehin nicht, vor wem das Meer, das Publikum, erschauert, sondern worin. Das Meer erschauert im Licht, einem Mitspieler, der immer dann zum Tragen kommt, wenn dem Betrachter sein eigener Standort zum Geschehen ersichtlich wird. Nur selten wird dieser Mitspieler als Entschuldigung missbraucht ( beim Autofahren passiert das ganz gerne, denn im toten Winkel stand dann alles, was wir zufällig erwischt haben, als wir rückwärts aus einer Einfahrt kamen ). Meistens dient er eher der Erklärung unseres eigenen Standpunktes.
Ist es das, was Petersdorff meinte, als er von Ironie sprach, die sich nicht ausschließlich gegen Personen, in diesem speziellen Fall sogar gegen eine ganze Epoche richtet? Ist das überhaupt Ironie, so „modern“ zu dichten und dann ein höchst romantisches Bild heraufzubeschwören? Ich stelle mir gerade vor, wie es wohl aussähe, wenn auf Caspar David Friedrichs „Kreidefelsen“ im Hintergrund ein Surfer auf den Wellen glitte, genau dort wo das Meer im Licht erschauert.
„Das Leben – ein kurzes Erwachen,“
Huch. Eine zweite Strophe! Die kam in der Laudatio gar nicht vor. Die googelte ich beim Eingeben der ersten Zeile des Gedichts und sie stellt mich vor ungeahnte Herausforderungen, ich muss mit meinem Artikel forfahren:
Wo die erste Strophe eine geschlossene Einheit bildet überrascht der Autor hier mit 9 statt der vorher üblichen 8 Silben – und einem Gedankenstrich. Innehalten ist verlangt, und das inmitten der Zeile. Dann erst die Botschaft: die ist schon so oft gehört oder gesagt worden, dass sie wie eine Gardinenpredigt klingt, den Ironieschalter (Slang aus dem Netz, gern benutzt in aller Herren Foren ) kann ich also getrost auf „On“ verharren lassen, nachdem er bei Zeile 4 der ersten Strophe eingeschaltet worden war.
Ja, huch, eine zweite Strophe! Die kam deshalb nicht in der Laudatio vor, weil es nicht darum ging, mit dem Werk bekannt zu machen, sondern weil es um den Autor ging. Ähnlich wie in der Vorlesung, da ging es auch nicht um den Autor Petersdorff, sondern darum, wie er zum Autor wurde, wie er Professor wurde, wie das im Allgemeinen überhaupt vonstatten geht, deshalb hörten wir nur am Rande bzw. am Schluss ein paar lyrische Zugaben, wo mein gewähltes Gedicht leider nicht dabei war. Ob er es zu Benns „Handvoll“ dazuzählt, konnte ich ihn nicht fragen, soweit war ich noch nicht.
Aber zurück zum Text: das Googeln brachte das gewünschte Ergebnis, die zweite Strophe, und ich musste mich fragen, weshalb der DTV die 2009 veröffentlichte Sammlung der „Power-Lyrik“, zusammengestellt von Anton G. Leitner, mit 20 Seiten ins Netz stellt. Ich gehe nicht davon aus, dass es sich dabei um das vollständige Exemplar der Sammlung handelt. Aber anscheinend will doch hier jemand neugierig machen auf Lyrik, dem Urheberrecht zum Trotz völlig kostenlos. Und da komme ich schon mit Riesenschritten auf ein Thema zu, dass einen „Autor“ über kurz oder lang beschäftigen muss:
„ein Glitzern, flüchtiges Treiben,“
Das trifft genau zu: auf das Urheberrecht. Ich würde diesen Punkt hier nicht ansprechen, wenn er nicht Teil der Vorlesung gewesen wäre. Er wurde nicht intensiv diskutiert, sondern vielmehr abgehandelt, so wie es der Großteil der Menschen nun einmal macht. Zu Wort kommen alle, aber schön hintereinander. Ich wollte mich hier in meinem Blog nie darüber auslassen, denn die Diskussion ist müßig. Es gibt einen Text von Lachmann, in dem er sich über die Auffassung des Autorbegriffs beklagt – jene, die das Seminar Dehrmanns „Was ist ein Autor“ besucht haben, können sich vielleicht erinnern – und den Verdienst an der Sache in Frage stellt. Und genau darin liegt doch das Problem, es wird seit mehr als 4000 Jahren eine Schriftkultur gepflegt ( im
Gilgamesh-Epos soll es sogar den Ausspruch geben, dass zum Zeitpunkt der Niederschrift des Epos bereits alles geschrieben worden sei ) und wer sich wo bediente und in welchem Maße ist längst nicht mehr überschaubar bis auf die wenigen Beispiele, die gut belegt erst in den letzten 200 Jahren gesammelt wurden. Bleibe ich gleich bei Lachmann, dessen Parzival ja immer noch die gültige Fassung einer längst vergangenen Dichtung darstellt. Oder Helene Hegemann, die sich im Blog von Airen bediente. Wolfram von Eschenbach musste sich nicht dafür rechtfertigen, dass er von seinem „französischen Kollegen“ abgekupfert hat. Auch er glitzerte nur kurz und steht nachwievor für den Parzival. Höchstwahrscheinlich nur dem studierten Germanisten ist bekannt, dass der Parzival, so wie wir ihn kennen oder schon einmal von gehört haben, textkritisch von Lachmann bearbeitet wurde. Was bleibt, ist die Frage nach dem Autor? Höchstwahrscheinlich ist er genauso ein Konstrukt, wie die „Urfassung“ des Faust oder die Urfassung der Nibelungensage, es ist alles eine Frage der Enge der Definition.
Der Ironieschalter übrigens steht weiterhin auf „On“, der Kreuzreim kann hier nicht darüber hinwegtäuschen, dass die beiden ersten als auch die beiden letzten Zeilen eine dichte jeweils gemeinsame Sinneinheit bilden. Der wehmütige Unterton des „Flüchtigen“ spielt sogar noch auf den Schluss der ersten Strophe an, wie ich finde.
„Du mußt Tempo machen!“
Ja, das muss ich, mein Manuskript fasst bereits 2 volle Seiten. Ich verlasse den Ironiesektor und widme mich endlich den wirklich wichtigen Dingen: in seinen Zeilen bestimmt keine herausragende Einzelleistung, das können andere genauso gut. In der Gesamtheit aber offenbart sich etwas Einmaliges. Es ist die Komposition, die ironische Ernsthaftigkeit, die mich an diesem Gedicht so gefesselt hat. Aus der Musik kennt man die Vermischung zweier oder mehrerer Musikstile unter dem Begriff Crossover, ähnlich ist es auch hier gelagert, wenn Anglizismen auf Romantik treffen.
„Du mußt locker bleiben!“
Ich bleibe lieber geschmeidig, denn ich darf nicht vergessen, dass ich einer anderen Generation angehöre. Diese andere Generation übersieht aber nicht die Parallelen zwischen dem „gleiten“ und dem „locker bleiben“, die scheinbare Mühelosigkeit, die in beidem steckt – den geschlossenen Kreis. Sie übersieht auch nicht, in welcher Konstellation die Vokale am Schluss der Zeilen eingesetzt werden, in welchem Wechselverhältnis sie zueinander stehen, die halblangen Diphtonge in „treiben“, „bleiben“, „weiten“ und „gleiten“ und ihre Wirkung aufs Gemüt. Sie stehen für die ausführlichen Antworten des Gastdozenten, wogegen die kurzen, herausgestoßenen „au‘s“ und „ach’s“ auf den „Interviewer“, dem hauptamtlich leitenden Professor zuzuschreiben sind. Diesen Zusammenhang habe ich mir ausgedacht, schließlich wollte ich die Vorlesung in Gedicht pressen – analytisch und nicht den Worten
Schillers nach ( ich habe den Originallink leider nicht mehr gefunden, deshalb muss ich hier auf mich selbst zurückgreifen ).
Dafür muss ich locker bleiben, was mir manchmal schwer fällt, vor allem dann, wenn ich solche Sätze höre: „Auch als Blogger kann man sich zum Autor entwickeln.“ Wenn ich mir jetzt den Zusammenhang vergegenwärtige – es ging darum, dass in irgendeiner Zeitung stand, ein Blogger hätte sich bei der Künstlersozialkasse angemeldet, und das kürzlich, also vor vielleicht einer Woche – dann frage ich mich einerseits, ob das Medium Zeitung tatsächlich noch der Höhe der Zeit entspricht und den Ton angeben sollte, und welche schlummernden Ressentiments in unserem Dozenten bisher verborgen blieben. Zum ersten: bereits vor diesem von der Zeitung völlig verschlafenen Termin gab es Blogger, die in die Künstlersozialkasse eingezahlt haben, die „künstliche“ Trennung zwischen Autor und Blogger – soviel zu zweitens – ist demnach eine vor allem von etablierten Medien gestützte Hypothese, die mir fast genauso grotesk erscheint wie der Streit um das Urheberrecht ( ein paar schöne Links zu dem Thema aus meiner
Nachbarschaft ). Und drittens erscheint mir das Statusdenken hier zu stark formalisiert, denn nur weil im Durchschnitt jeder Bundesbürger 20.000 Euro Schulden hat, trifft das noch lange nicht auf mich zu. Nur weil ein Blogger in die Künstlersozialkasse einzahlt, ist er ein Künstler, oder was?
Wie der geneigte Leser wahrscheinlich schon längst festgestellt hat, ich habe keine Ahnung von Lyrik. Ich kann den Kreuzreim vom umarmenden Reim unterscheiden aber Blankverse mit 5-hebigen Jambus waren nicht meine Welt, denn ich habe ja Internet und kann mich schlau lesen. Außerdem ist das hier mehr eine Pflicht, denn eine Kür. Auch wenn ich mir sehr viel Mühe gab, auch wenn ich diese Pflicht selbst heraufbeschwor, so bleibt dieser Text doch nur ein Blogeintrag von vielen – nicht auszudenken, wenn ich dafür bezahlt werden würde, dann hätte ich den Lachmann womöglich korrekt zitieren müssen, Recherche betreiben, die unvollständig bliebe und Angriffspunkte lieferte, ich hätte konsequenter Anführungszeichen setzen müssen. Vielleicht wäre ich zu dem Schluss gekommen, den Text gar nicht veröffentlichen zu können, weil hier absolut gar nichts zusammenpasst. Dem setze ich mich nicht aus.
Ich habe jetzt drei Halbe intus, keine notwendige Substanz zum Schreiben, aber in diesem Fall erleichterte es die Sache ein wenig.
Und noch etwas möchte ich anmerken, nachdem dieser Text seit 5 Tagen online ist. Ich habe mir erlaubt, daran zu arbeiten, seine Form flüssiger zu machen und den sperrigen Assoziationen ein paar Erklärungen nachgeschoben, das mache einmal jemand mit einer Zeitung, einer Examensarbeit oder einem bereits veröffentlichten Gedicht, dann heißt es gleich wieder: wo ist die Urfassung? Welcher Text steht dem Autor näher, welcher Text repräsentiert seine Ansichten besser? Das kann ich nicht abschließend beantworten aber den Nutzen aus der Ambivalenz zwischen der Entfernung zum eigenen Text und der trotzdem vorhandenen Nähe zu ihm kann mir nur ein Text im Internet bieten, den ich nach Belieben, wann ich es will, ändern kann.
Hier geht's weiter:
Text 3