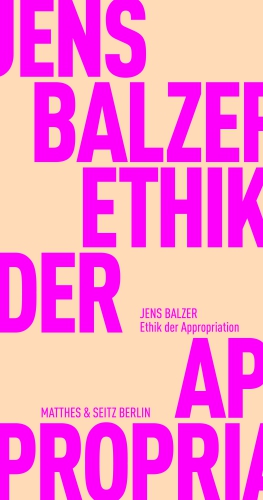Die DDR hat sich hier ein Denkmal gesetzt, hier in Eisenhüttenstadt. Die Stadt ist ein einziges Denkmal, Mahnmal, Museum? Eisenhüttenstadt ist auf dem Reißbrett entstanden. Die Kohle aus der Lausitz und der Stahl aus der Ukraine sollten hier die Stahlindustrie befeuern, die - oberstes Ziel im ersten Fünjahresplan - schnellst möglich aufgebaut werden sollte.Zuerst kam das Werk. Mit modernster Technik ausgestattet und trotz vieler baulicher und technischer Mängel konnte die Stahlproduktion ziemlich schnell anlaufen. Dann wurde die Stadt gebaut, für mindestens 30.000 Einwohner sollte die Stadt ein neues Zuhause bilden. Das Konzept sah vor, dass sich jeder Baukomplex fächerförmig zum großen Werkstor hin herausbildete, das fehlende große Werkstor war vielleicht der erste Riß in einer sonst noch schönen Fassade, denn egal wie hässlich die
Stalingotik - einer der ersten Baustile im Wohngebiet - auch gefunden wird, was danach kam war hässlicher. So entstanden also erste Wohnsiedlungen. Viel Grün, großzügige, fast verschwenderische Bebauung, hier ein Brunnen, dort ein kleiner Park und alles weit auseinander, damit sich niemand eingeengt fühlen musste zwischen den Häusern.
Spätestens mit Stalins Tod ging es im Baustil rapide bergab, was die kleinen Extravaganzen anbelangte. Vom Realismus der Mangelwirtschaft eingeholt fielen zuerst die Verzierungen später alles scheinbar Zwecklose der Architektur der einheitlichen Plattenbauweise zum Opfer, die in den verschiedenen Baukomplexen in ihrer Entwicklung sehr schön nachvollzogen werden kann. Wo das endete, hat jeder schon gesehen, dafür muss man nicht einmal in den Osten fahren.
Die zweite Ausstellung befindet sich im Wohnkomplex II.
Das Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR. Da gab es nichts überraschendes. Die üblichen Aneinanderreihungen von Ostprodukten, einer "
Industrieästhetik" ( komisch, das hier gleich der erste Beitrag auf Eisenhüttenstadt verlinkt ) untergeordnet und mit abschreckend großen Textbeiträgen zu Designern, Produkten und Geschichte. Die Beiträge sind an den Wänden angebracht, die Exponate stehen für sich. Für mich kein Problem, ich kenne die meisten Produkte. Für Menschen, die sich nicht auskennen, ist das ein ewiges Rennen nach der richtigen Information zwischen dem Exponat und dem Text an einer der Wände, als wollte man beweisen: Willst du das Produkt, dann musst du du dich bewegen, vielleicht gibt es da was.
Vielleicht ist das gar nicht so schlecht, das Konzept. Ich fand es blöd. Die Trennung von Exponat und Text kann man bei holländischen alten Meistern machen, wenn die Ausstellung dann "Licht und Schatten" heißt, weiß ich, wonach ich zu suchen habe, da brauche ich keinen Text. Wenn aber in einer DDR-Ausstellung ein Stapel Tetrapacks mit offensichtlich schwedisch bzw. dänischem Aufdruck in einer Vitrine liegt, dann muss sich der nichtwissende Besucher womöglich fragen, ob das Tetrapack-Konzept nicht in der DDR erfunden worden ist und dann exportiert wurde. Das stimmt natürlich nicht, das war nur Strandgut, von einem Designer gefunden, der am Strand entlang spazierte.
Wer geht also nach Eisenhüttenstadt ins DOK? Die; die noch nicht genug haben, die sich Mangel und Repression ersparen möchten, die auf bunte Plastik stehen und den Eierbecher oder das Sandspielzeug aus Kinder- oder Jugendtagen wiedererkennen, die sind hier richtig; die mehr wissen wollen als der Ostalgiker, die sind hier falsch. Bis auf die zu Tränen rührende Erklärung am Anfang der Ausstellung ist hier viel Verheißung und wenig Erfüllung, und vielleicht, nein, ganz bestimmt, ist hier auch die große Parallele zur Alltagskultur der DDR zu suchen.
Im Deutschen Historischen Museum in Berlin stehen links, wo eine wenig freundlich aussehende Dame die Garderobenwagen für Gruppen hinter einer ansonsten geschlossenen Tür hervorholt, ein Bismarck und ein Lenin, direkt nebeneinander, nur durch die Tür zwischen ihnen getrennt.Nun verbindet die beiden nicht wirklich viel, war der eine doch gerade geboren, als der andere schon die Geschicke Europas lenkte.
Wenn man sich die kleinen A-Texte durchliest, ist klar, weshalb die beiden hier das Garderobentor bewachen. Nicht in Form, Material, politischen Ansichten oder Ähnlichkeit in Haltung oder Gesicht kam es bei der Platzierung an, es ging schlicht um ihren Weg in das Museum. Während der Bismarck ein vergessener Entwurf eines Denkmals war und nur aus Gips bestand, der später zerhauen wurde, um der Verkleidung einer Decke zu dienen - was dann nicht klappte und ein paar Mutige sich der Trümmer annahmen und ihn wieder zusammensetzten - war der Lenin Kriegsbeute der Nazis, die ihn in einem Dorf nahe St. Petersburg - in Puschkin um genau zu sein - gestohlen hatten und einschmelzen lassen wollten. Dafür schafften sie ihn nach Eisleben, wo er dann doch nicht eingeschmolzen wurde und kurz bevor die Russen in Eisleben einmarschierten, wurde Lenin dort aufgestellt und verhalf der später entstandenen DDR zu einem weiteren Gründungsmythos.
Da stehen sie nun einträchtig nebeneinander, die sonst wohl nichts hätten teilen wollen, wenn sie sich gekannt hätten und bewachen die Taschen, Koffer, Jacken und Mäntel der Besucher einer überholten Institution - eines deutschen Nationalmuseums.
Heute wird das letzte Teilstück einer einsemestrigen Arbeit abgeschlossen. Was als formloses Treffen begann und zwischenzeitlich zum Seminar auswuchs, was uns alle ganze Tage, häufig am Wochenende, beschäftigte, findet heute mit einer Exkursion seinen Abschluss. Es geht zuerst nach Eisenhüttenstadt, im Tagesverlauf dann nach Berlin. Wir werden mehrere Ausstellungen besuchen, allles dreht sich um das Alltagsleben in der DDR. Wir sollen unsere Eindrücke schildern, später sollen diese in einem Blog, auf Wunsch anonym, veröffentlicht werden. Sobald ich weiß wo, werde ich den Link hier posten. Was ich sicherlich vielen voraus habe, ist ein eigenes Blog, in dem ich natürlich auch darüber schreiben werde, dazu dann hoffentlich schon am Freitag mehr.
Es ist fast geschafft, heute finden für mich die letzten Veranstaltungen vor den Semesterferien statt. Gestern Abend waren der Herr
Trithemius und ich ein letztes Mal in der Leibnizvorlesung, und egal wie verärgert oder enttäuscht ich mich des öfteren geäußert habe, so war es insgesamt eine lohnenswerte Geschichte. Ich habe ein paar interessante Anregungen erfahren, manches nachschlagen und vertiefen müssen, um mich von der Richtigkeit überzeugen zu können, und - wie es leider meistens ist bei Veranstaltungen mit Freiwilligencharakter - ich lernte die unmöglichsten Sachen und die "wichtigen" habe ich vergessen.
Dass Leibniz in Leipzig geboren wurde und Gottsched sein größter "Fan" war, dass Goethes Indien ein Ort ist, der ganz tief in dessen Schriften zu suchen sei, dass Lessing bei der Exegese der Theodizee fast zu tief eindrang und somit die anthropozentrische Wende einläutete aber gleichzeitig dem Optimismus zu viel Raum einräumte ( das konnte der gute Mann aber nicht wissen, schließlich trug er noch keine zwei Weltkriege im Gepäck ).
Naja, der letzte Gedankengang hat uns ( also Trithemius und mich ) auch noch eine Weile getriezt. Es waren nach der Vorlesung mehrere Biere nötig, um die häßlichen Gedanken abzuschütteln. Unsere Köpfe konzentrierten sich dann auf andere spannende Sachen, aber das ist eine andere Geschichte, die soll ein andernmal erzählt werden...
Was bleibt sind 3 Monate Ferien und die Hoffnung einer nicht minder spannenden Fortsetzung der Vorlesungen im Oktober. Ich halte zumindest Ohren und Augen offen.
Teil 1 des Interviews gibt es
hier
Nachdem das Seminar nun gelaufen ist und tatsächlich eins der interessantesten war, das ich seit längerem besucht habe, folgt hier der zweite Teil des Interviews mit meiner ehemaligen Deutsch- und Geschichtslehrerin:
2. Wie sah der Schulalltag aus, sowohl der Unterricht als auch die Freizeitgestaltung danach? Welchen Einfluss übten die Lehrer dabei aus?
Meine eigene Kindheit verlief unter dem Aspekt des Empfindens der Geborgenheit, obwohl wir ein christliches Leben hatten, und ich dem auch nachgehen konnte. Es war auch in der Schule ständig jemand da, der mit Kindern etwas veranstaltete, etwas zeigte, sie betreute, man konnte werkeln im Keller, tanzen und malen, man konnte aber auch zur Kirche gehen, da wurde dies ebenfalls angeboten. Am Anfang waren beide Institutionen sogar noch in einem Haus. Man konnte in dem Viertel, in dem ich aufgewachsen bin rundum betreut und beschützt werden. Das war auch notwendig, denn die Leute arbeiteten ja. Dann gab es natürlich Horte, nicht ganz unentgeltlich, soweit ich weiß. Der Obolus wurde für die Verpflegung entrichtet. Darüber hinaus auch AGs und die Sportvereine. Das darf man heute nicht vergessen, die Leute konnten für wenig Geld ihre Kinder bis in die frühen Abendstunden abgeben und diese wurden dort gut versorgt.
Als ich dann Lehrer war, hat sich dieses System erhalten. Die Betreuung der Kinder, wenn diese nachmittags in die Schule kommen wollten, war bis zur 10. Klasse möglich. Ich selbst hatte zu meiner Anfangszeit, weil ich gleich in die Oberstufe reinrutschte – ich hatte nur ein einziges Mal eine 5. Klasse –sehr viel mit den Jugendlichen zu tun. Dabei fiel mir auf, dass zwar die Kinder ordentlich betreut wurden, die Jugendlichen aber weniger. Die fingen dann an, wie heute auch, zu trinken, rauchen, Blödsinn machen. Da habe ich dann einfach einen Schulclub gegründet. Ich habe mit den Jugendlichen zusammen diesen Club aufgebaut. Ich habe zu Ihnen gesagt, wenn sie das wollen, dann übernehme ich die Aufsicht, ihr seid der Clubrat – meine 10. Klassen holte ich so mit ins Boot. Auf die konnte ich mich voll verlassen. Dann stellte ich fest, dass die jungen Leute da hin kamen und nichts gegessen hatten, weil ja auch niemand zu Hause war. Dann haben wir angefangen, für 5 Pfennig Brötchen mit Wurst zuzubereiten. Später haben wir dann auch Tee angeboten. Dann kamen die Jugendlichen schon allein deshalb dorthin. Um 18.00 Uhr machte der Club auf, dann aßen die dort und später war Disco. Das haben wir später erweitert auf drei Tage in der Woche. Ich habe dann die Lehrerschaft dazu gezwungen, mit Aufsicht zu machen. Das lief sehr gut. Die Räumlichkeiten wurden von der Schule zur Verfügung gestellt. Es gab einen großen Raum im Keller, der dazu umfunktioniert wurde. Alles in allem war diese Zeit sehr angenehm für mich, da sich das gute Verhältnis zu meinen Schülern natürlich auch auf den Unterricht übertrug.
Vielleicht gab es ideologische Zwänge. Ich für meine Person wurde gar nicht bedrängt. Das einzige, was ich immer tun musste, war nach Offiziersanwärtern zu suchen, weil ich ja die Oberstufe unterrichtete.
Generell zum Ablauf des Unterrichts gibt es wenig zu sagen, was sich von heute unterscheidet. Die Stunden waren gleich lang. Lehrpläne waren einheitlich geregelt. Ein großer Vorteil waren auch die einheitlichen Schulbücher. Nach streng wissenschaftlichen Kriterien wurde der Unterricht gestaltet, die Ideologie gab es als Bonbon obendrauf, wobei man als Lehrer auch immer selbst entscheiden konnte, inwieweit diese im Unterricht einen Stellenwert bekam, sofern nicht gerade ein Fachberater* zur Hospitation anwesend war. Man konnte die Anweisungen – dass man im Sinne der Arbeiterklasse unterrichtete – nämlich auslegen. Wenn man genug weiß, konnte man auch genug auslegen. Wer dagegen wenig weiß, musste sich eben an die Vorschriften halten. Ein glücklicher Umstand für mich war auch, dass ich nie Geschichte in der 10. Klasse unterrichten musste. Das war furchtbar, das war nur noch DDR, SED, Parteitage usw. Da fehlte es natürlich gänzlich an Wissenschaftlichkeit. Man musste bis zum Beginn der 10. Klasse mit der Entstehung der geteilten Welt fertig sein. Danach kam nicht mehr viel.
Mit den homogenen Lehrplänen hat man natürlich auch ein relativ gleichmäßiges Bildungspotential erhalten. In den grundlegenden Dingen war die DDR-Bevölkerung nach der Schule erstmal gleich gebildet. Klassenarbeiten wurden wie heute auch im Fachbereich erarbeitet. Die Benotung war ähnlich, wenn auch nur mit 5 Noten, wie heute. Wir hatten keinen Anforderungsbereich wie heute, also es hieß nicht so, aber an bestimmten Maßstäben wurde sich orientiert und diese wurden angewandt. Die Eltern hatten gegenüber den Lehrern einen relativ schlechten Stand. Sie durften pro forma ihre Sorgen mitteilen, bei Lernschwierigkeiten waren die Lehrer dazu da, Abhilfe zu schaffen. Nachhilfe in dem Sinne gab es nicht, das wurde von den Lehrern organisiert. Es zählten vor allem aber die Noten und - was ich heute vermisse- die Persönlichkeit des Schülers. Diese beiden Aspekte hatten maßgeblichen Einfluss bei einer Versetzung. Dies war dann sicherlich auch von der Atmosphäre in der Schule abhängig. Bei uns an der Schule herrschte eine eher pädagogische denn politische Stimmung. Da wurde der Schüler nach gewissen Fähigkeiten eingeschätzt, wie zum Beispiel Fleiß, Ausdauer usw. nicht unbedingt der IQ. Es galt bei uns deshalb der Maßstab, eher zu versetzen, als wiederholen zu lassen. Es gab Fälle, meist erst zum Abitur oder beim Studium, da wurde dann dem ein oder anderen, der sich nicht in FDJ oder anderen Organisationen beteiligte, das Studium bestimmter Fächer verwehrt. Probleme gab es auch immer wieder mit Kindern aus sehr religiösem Elternhaus, die entweder von dort aus oder auch von sich aus, nicht am gesellschaftlichen Leben innerhalb der Jugendorganisationen teilnehmen wollten. Theologie zu studieren, war zum Beispiel sehr schwer.
Vielleicht noch ein Beispiel: in der Magdeburger Börde wurde zu bestimmten Zeiten immer die Hasenjagd für Erich Honecker veranstaltet. Die jüngeren Schüler mussten dafür Wimpel nähen und später gingen dann alle zum Bahnhof und empfingen ihn dort. Wenn man allerdings nicht mitging, so hatte das auch keine Konsequenzen. Es trauten sich nie alle. Manche haben gesagt, sie können nicht, manche haben sich krank schreiben lassen. Es passierte deshalb aber nichts. Das war für mich immer wieder ein richtiges Aha-Erlebnis, weil man ja doch ein wenig Angst hatte.
* Der Fachberater war das Schreckgespenst. Dieser beherrschte genau das, worüber man als Student Prüfungen ablegen musste. Dieser setzte sich immer wieder hinten rein, nicht etwa wie ein Freund, sondern wie jemand, der eine Prüfung abnimmt. Solche Musterstunden – das wussten ja alle – kann man nur einmal am Tag abhalten, danach war man fix und fertig. Heute weiß ich aber, wenn man gute Fachberater hatte, die fachlich versiert waren – oft waren sie ja einfach nur konform oder hatten mit Kindern Probleme, weshalb sie selbst nicht unterrichteten – und mein Fachberater in Geschichte war so jemand, dann hat man da auch wertvolle Tipps erhalten. Zu den Notizen, die diese Leute über einen gemacht haben: man hielt das nicht aus, immer zu überlegen, was sie jetzt über einen denken. Man konnte DDR-Alltag nur ertragen, wenn man sich sagte: ich sage, was ich sagen will und passe auf, wem gegenüber. Aber man konnte nicht immerzu nur wachsam sein. Die Wahrnehmung der Kontrolle rückte aber in den Hintergrund, umso öfter sie stattfand. Man war versucht auch das als „normal“ anzusehen. Meine Fachberater haben sich nur wenig über meinen Stil aufgeregt, vor allem bestimmte Aspekte, wie vielleicht die Rolle der Arbeiterklasse während einer bestimmten Zeit, die ich nicht einmal erwähnt hätte, so etwas ist mir selbst nicht passiert. So jemanden habe ich selbst nicht erlebt. So etwas hatte ich nur während meiner Lehrerprüfung. Vielleicht hat das ein wenig abgestumpft, um es zu ertragen, haben wir viele Dinge in Kauf genommen. Das war alles nicht so wichtig, Hauptsache, wir hatten unser seelisches Gleichgewicht. Ich weiß nicht, ob das richtig oder falsch war, ich für meinen Teil wollte aber auch leben und nicht immer kämpfen.
Gestern waren der Herr Trithemius und ich mal wieder die universitäre Luft beschnuppern. Die roch gewaltig nach Regen, und, so sagte Trithemius, sie sei deshalb besonders sauerstoffhaltig.
Im Hörsaal angekommen erwartete uns eine nicht kleinere Menge an Zuhörern als sonst. Die eingeschworenen Teilnehmer hatten sich trotz der widrigen Witterung eingefunden, um dem Vortrag des Herrn Doktor Otto zu lauschen. Die Laudatio vom schwer zu verstehenden Dr. Li fiel vielversprechend aus, bis zu diesem Satz: "Wo andere Teilnehmer der Konferenz einen 10-15seitigen Beitrag in dem Sammelband, der zu Tagung erschienen ist, veröffentlichten, war der Aufsatz des geschätzten Kollegen Otto 76 Seiten stark. Das vermittelt ungefähr das Gewicht."
Ich denke mir noch: Gewicht? Wieso Gewicht? Und da prasselte der Vorträger bereits auf uns ein. Ohne Punkt und Komma flog einem Gewitter gleich die erste Ladung des Vortrages über uns hinweg und während wir uns noch fragten, wie der dritte Punkt der Überschrift hieß - wir verstanden nur Leibniz, Gottsched und die deutsche... - waren die Einleitung und die ersten Zitate schon über uns herabgeregnet, leider vermisste ich den Sauerstoff.
Es gab ein paar Dinge, die ich mir trotz der Geschwindigkeit notiert hatte. Die kann ich hier leider nicht vortragen, denn ich bin mir nicht sicher, ob ich sie nicht falsch wiedergeben würde. Deshalb beschränke ich mich einfach mal auf die Art und Weise des Vortrages.
Ich behielt im Gedächtnis, dass Gottsched ein ziemlicher Egozentriker gewesen sein muss ( oder seine Frau hat ihm die Flausen eingeflüstert ) und Leibniz, in Leipzig geboren, entwickelte sich zu einem kontinuierlichen Stolperstein in Gottscheds Leben und vor allem im Vortrag. Nicht selten kam es nämlich vor, dass Dr. Otto "Leipzig" sagte, wenn er "Leibniz" meinte und umgekehrt. Die unfreiwilligen Pausen dieser Versprecher nutzte der gute Mann allerdings für ausgiebige Recherchen auf seinen Blättern, um danach in verdoppelter Geschwindigkeit den Tempo- und Zeitverlust wieder einzuholen. Auch "aus" und "auf" bargen so ihre Schwierigkeiten und da sich diese Präpositionen auch als Präfixe in der deutschen Sprache tummeln, wurden auch hier Pausen nötig, um noch einmal zu rekapitulieren, was denn überhaupt gemeint sei.
Nach gefühlten 66 Seiten Vortrag kamen wir dann endlich zu einem sehr interessanten Punkt, nämlich Punkt 4. Punkt 4 sollte nach der Ankündigung, die mir während des Vortrages ins linke Ohr wehte - das rechte nahm Herr Trithemius in Beschlag, denn wir hielten es ohne Rückversicherung über das Gehörte nicht lange aus und versuchten wie die Mäuschen die akustisch schwer verständlichen Passagen zu entschlüsseln, indem wir uns gegenseitig zutuschelten, was wir verstanden hatten, um das Gehörte dann irgendwie zu vervollständigen, nebenbei bemerkt, das klappte nicht so gut - der letzte Punkt sein.
Dieser Satz eben war auch symptomatisch für die Vortragsweise, bestanden doch nicht wenige Blätter auf seinem Vortragspapier aus weniger als zwei Sätzen, Zitate einmal nicht mitgerechnet. Doch was behandelte der letzte Punkt? Ich sage es nur ganz kurz und bin mir nicht sicher, ob er das tatsächlich so gemeint hat aber im Großen und Ganzen verstand ich, dass der gute Gottsched mit seiner Forderung nach einem Denkmal für Leipzig in Leibniz ( hihi ) die Erinnerungskultur als nationenbildendes Moment in die bürgerliche Öffentlichkeit trug. Ein Denkmal für einen Bürgerlichen, das hatte schon was. Damit hat er natürlich nicht ganz unrecht, allerdings, und das musste auch Dr. Otto zugeben, bedarf es hier noch ein paar ausgiebiger Studien zu dem Thema. Die Glorifizierer und Mystifizierer waren ja schon seit dem späten Mittelalter aktiv, als man nach langem Entschwinden Tacitus´ Germania wiederfand. Klopstock und andere griffen das Ganze dann literarisch auf und beglückten uns mit schwülstig, sperrigen Charakterstudien Hermanns des Obergermanen. Gottscheds Stil war das nicht und da Dr. Otto ihm ja jetzt eine eigene Nische der nationenbildenen Tätigkeiten zugewiesen hat, können wir den Klopstock wieder begraben, Gottsched sei Dank.
Im übrigen bekam Leipzig sein Leibnizdenkmal erst 1883, also mit einiger Verspätung. In Hannover steht bereits seit 1790 der Leibniztempel. Der gute Gottsched war glücklicherweise nicht so erfolgreich mit seinem Wunsch nach Vereinnahmung des guten Leibniz in seiner Geburtsstadt und so konnte sich die Stadt Hannover vom Ruhm des Universalgelehrten noch eine große Scheibe abschneiden, die Uni, die Bibliothek, einen Tempel; wir haben hier Leibniz satt :)
Dass das soviel Arbeit machen kann, hätte ich nie gedacht. Meine Interviewpartnerin ist meine ehemalige Deutsch-, Geschichte- und Sozialkundelehrerin. Ich habe sie ausgewählt, weil sie für das Referat, wo ich dran beteiligt bin, eine gute Gesprächspartnerin bildet - nicht nur wegen ihres etwas verqueren Lebenslauf, sondern auch wegen ihrer Unterrichtsfächer. Geschichtslehrer in der ehemaligen DDR gewesen zu sein und das auch darüber hinaus, ist nicht vielen gelungen. Die Gründe dafür ergeben sich schon fast gänzlich aus der ersten Frage, die ich ihr stellte.
Wie sah Ihr eigener Werdegang in der DDR aus? Beginnen Sie mit der Schulausbildung bis zum Abitur und dem anschließenden Hochschulstudium. Gab es dabei bestimmte Hürden zu nehmen und wenn ja, wie sahen diese aus?
Also ich komme aus einem christlichen Elternhaus, bin in einem Arbeiterviertel von Magdeburg geboren. In diesem Arbeiterviertel lebten natürlich auch viele Arbeiter, die sich nach dem Krieg dem neuen System, das ja proletarierfreundlich war, auch angepasst haben, so dass solche Kinder wie ich durchaus als exotisch galten und sich in der Schule auch zurückhalten mussten. Und das tat man dann instinktiv und dann hatte man seine Ruhe. Als ich eingeschult wurde, war der Christenlehreunterricht noch fester Bestandteil des Stundenplans und ich denke, das hat die Voraussetzungen geschaffen, dass ich trotz meiner Herkunft nur mit meinen Fähigkeiten etwas erreichen konnte – also leichter als zum Beispiel nach 1971 als sich die DDR fest etabliert hatte.
Meine Eltern waren Angestellte. Es gibt sonst niemanden, auch meine Geschwister nicht und in Wirklichkeit hätten womöglich in anderen Gesellschaftsordnungen in Deutschland meine Eltern es nicht geschafft ein Kind diese Laufbahn gehen zu lassen. Da war wieder der Vorteil, dass die DDR das Geld nicht zurückhielt, wenn jemand kam, der nicht sofort konform wirkte. Das lief also ganz ruhig ab. Ich war dann auch „prädestiniert“ auf das Gymnasium zu gehen, mein Vater allerdings wurde dann gelähmt. Aufgrund dessen disponierte meine Familie anders. Das kam nicht von oben. Ich sollte nun die 10. Klasse beenden, dann in eine Berufsausbildung mit Abitur gehen. Diese Möglichkeit gab es, heute sagt man wahrscheinlich dritter Bildungsweg dazu.
Das lief dann genauso locker ab. Ich habe also dann auf Wunsch meines Vaters Kaufmann gelernt, obwohl das nicht unbedingt mein Traum war, habe mein Abitur absolviert, meinen Kaufmann, sodass ich damit immer Geld verdienen konnte, wenn ich keines hatte, zum Beispiel Abschlussbilanzen in großen Betrieben. Das wurde noch alles mit dem kopf gemacht, es gab ja keine Computer, was dem Verstand ja nicht geschadet hat.
Aufgrund der kaufmännischen Ausbildung, vielleicht und meines schon immer vorhandenen Faibles für Geschichte – das gehört ja zusammen, Ökonomie und Geschichte – habe ich mich dann entschieden, Geschichte zu studieren, was man mir in Leipzig empfohlen hat, weil mein Traum nicht mehr zu verwirklichen war – angeblich waren die Plätze im germanistischen Seminar alle vergeben. Heute, wo ich alt bin und zwei Systeme erfahren habe, möchte ich sagen, man musste von der Herkunft her koscher sein, um Germanistik studieren zu können, denn es existierte ja eine Zensur, das hatte ich bis dahin noch nicht so richtig begriffen, weil es mir so im Großen und Ganzen nicht schlecht ging. Das heißt also, ich wurde in Wirklichkeit zu keinen Dingen gezwungen in politischer Hinsicht, das darf man aber nicht als positiv bewerten, es hängt immer alles von den Menschen ab, mit denen man lebt. Und bis dahin war ich mit Lehrern verbunden, die der individuellen Entwicklung Raum gaben, trotz der ideologischen Zwänge. Es zählte in meiner Entwicklung vor diesen Menschen immer die Fähigkeit, da hatte ich vielleicht auch Glück.
Das Germanistikstudium wurde demzufolge nichts, am gleichen Tag habe ich mich dann für das Geschichtsstudium entschieden, da auch die Aufnahmeprüfung bestanden und als Studienrichtung Neuzeit, d.h. ab den großen Entdeckungen durch Christoph Columbus. In der marxistischen Geschichtswissenschaft hat man ja so eingeteilt, teilweise wird es heute aber auch noch benutzt. Da studierte ich dann zwei Jahre in Leipzig an der Uni. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war eine unheimlich offene Atmosphäre. Dann kam die Hochschulreform, ich glaube 1972, wir haben uns nicht vorstellen können, dass es in der DDR eine Reform geben kann und haben das nicht so ernst genommen. Dann bekamen wir jedoch neue Studentenausweise, auf denen nicht mehr draufstand „Geschichte der Neuzeit“, sondern „Wissenschaftlicher Kommunismus/Geschichte“. Das gefiel uns nicht. Wissenschaftlicher Kommunismus wurde plötzlich ein Fach, pflichtgemäß gelehrt. Wir habe das in Wirklichkeit nicht als Wissenschaft angesehen. Natürlich, das gebe ich zu, mit dem Gedanken des Kommunismus kann man sich rein logisch und argumentativ anfreunden, wenn man mit der „Teilerei“ zufrieden ist. Als Unterrichtsfach war das für uns kaum zu akzeptieren. Wir hatten sowieso schon die Fächer Philosophie und Ökonomie, in beiden musste ein Staatsexamen gemacht werden, also schriftliche und mündliche Prüfung. Das war die reinste Propaganda. Es gab große Unruhen an der Universität, weil die Studenten das nicht wollten. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie sie es geschafft haben, uns zu besänftigen. Man hat dann Events gestaltet, unter anderem sollte Fidel Castro vor den Studenten über sich und Ché Guevara sprechen. Dann kam aber ein anderer Kubaner, weil es Fidel angeblich nicht so gut ging an diesem Tag. Irgendwie verliefen die Proteste dann im Sande. Und damit hat man uns vielleicht betäubt, es wirkte international und offen. Man vergaß im Endeffekt die Mauer und auch der Studentenausweis rückte in den Hintergrund. In Wirklichkeit hätten wir durchhalten sollen, das war eine Frechheit.
Dann kam es bei mir persönlich zu einem Einschnitt, ich hatte schon mein Diplomthema, das war ganz toll. Ich konnte mir aussuchen die Entwicklung des Proletariats, also mit der Entstehung der kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse, entweder in den USA oder in Belgien. Und meine Professorin sagte zu mir, dass wenn wir nach Belgien führen, würden wir beide zusammen hinfahren, ich solle meine Diplomarbeit schreiben und zwischendurch fahren wir nach Paris und kaufen Parfüm. Das machen wir, war meine Antwort. Zum Glück ist das nichts geworden. Als Student gab es da keinerlei Beschränkungen, auch nicht seitens der Professoren, wenn solch ein Thema vergeben wurde, war es selbstverständlich, dass so etwas nicht ohne vor Ort zu sein auch bearbeitet werden konnte. Allerdings musste ich – das wusste ich damals noch nicht – einen kleinen schicksalhaften Zettel unterschreiben, der auch relativ neutral rüberkam. Und zwar, wenn man im Ausland weilt, weder über die DDR erzählt noch Kontakte knüpfen und natürlich zurückkehren, sich also im Rahmen der Bedingungen bewegt. Wenn ich nach Belgien gegangen wäre, hätte ein Diplom gemacht, hätte ich heute nicht unterrichten dürfen, dann wäre ich in der Stasi gewesen, obwohl das erstmal nichts damit zu tun zu haben scheint.
Das hat sich aber alles zerschlagen, weil ich schwanger war. Ich habe mich beurlauben lassen für ein Jahr, und als mein erstes Kind geboren war und mich gerade ein wenig erholt hatte, war mein zweites Kind unterwegs. Ich habe mir das dann nicht mehr zugetraut, denn es gab keine Krippenplätze. Man hatte jeder Frau einen Krippenplatz versprochen man die Geburtenrate durch finanzielle Zuwendungen forciert – und man konnte sich in der DDR ja auch in Ruhe lieben und Kinder kriegen und Fremdgehen auch, das war alles nicht so spießig und kontrolliert, also machten die Leute das auch – aber die Plätze waren gar nicht da. Wohnungen und Krippenplätze, das waren die großen Mängel, weshalb die Leute oft weder ein noch aus wussten und den beruflichen Weg doch abbrechen mussten. So ging es mir auch. Ich bin dann meinem Mann gefolgt, er hat in Eisenach sein Diplom gemacht, als Ingenieur in der Automobilbranche. Wir hatten überhaupt kein Geld. Mein Mann lief ja ebenfalls noch als Student, das hieß für uns beide ca. 200 Mark Einkommen im Monat. Die Miete machte ca. ein Drittel unseres Verdienstes aus. Es war ein kärgliches Studentenleben.
Ich entschloss mich dann aber, wieder zu studieren. Das war für mich kein Zustand, ich arbeitete in Gotha in einem Großbetrieb im Außenhandel und da habe ich viel Geld verdient. Trotzdem habe ich mich dazu entschlossen zu studieren, weil ich meine wissenschaftlichen und kulturellen Ambitionen verwirklichen wollte. An das Lehrerdasein habe ich gar nicht gedacht ich bin kein Lehrerfreund gewesen und heute noch nicht. Diese Möglichkeit ergab sich für mich dann aber nicht mehr. Das war damals Alltag und ist es wahrscheinlich heute ebenfalls, wenn man zwei Kinder hat. Für eine wissenschaftliche Karriere musste man schon erwägen, ob man seine Familie im gewissen Sinne im Stich lässt oder sich ihr zuwendet. Das Lehrerstudium war also ein Kompromiss. Das Studium habe ich dann auch erfolgreich absolviert, das war natürlich anstrengend mit Familie und Kindern. Das klingt alles so leicht, wenn man immer sagt, in der DDR wurde alles gefördert, so war das nicht – ich lief zum Beispiel nicht über die förderwürdigen Leute, das hieß Arbeiterschaft zu sein, in der SED musste man sein, dann hätte ich 300,- Mark Stipendium bekommen. Da ich aber nichts von alledem war, sondern alles nur „mein Wunsch“ – wie man das dann formulierte – war es sehr schwer. Ich musste kämpfen, auf allen Verwaltungsgremien in Magdeburg bin ich mit meinen Kindern hingezogen und habe gesagt, ich möchte studieren. Immer wieder wurde mir gesagt: Mädchen, das geht nicht. Ich sagte, gut, dann komme ich nächste Woche wieder, vielleicht haben Sie sich das bis dahin anders überlegt. Ich war immer wieder dort und fragte, wo es geschrieben steht, dass ich nicht studieren darf. Dafür gab es aber keine Richtlinien. Irgendwann habe ich dann jemanden getroffen, der so genervt war, dass sie mich doch studieren ließen. Ich wollte eigentlich Sport studieren, das wurde mir allerdings ausgetrieben. Für ein Sportstudium war ich bereits zu alt ( 26 oder 27 ). Die Fakultät war eine Zweigstelle der DFK Leipzig, das war ja das renommierte Institut für unsere Nachwuchssportler und da musste man schon was bringen. Deshalb habe ich mich dann für ein Studium der Geschichte und Deutsch entschieden.
1981 bin ich dann an die POS Lindenhof, später Leninschule, gekommen und musste genau wie die Lehrer im Westen – das möchte ich mit Nachdruck betonen, denn in der Hinsicht werden wir bis heute diskriminiert – ein zweijähriges Referendariat absolvieren, außer vielleicht man war politisch vorbelastet. Alle anderen mussten in diesen zwei Jahren beweisen, dass sie zum Lehrer taugen. Nach einem Jahr, mir wurde aufgrund guter Leistungen – und vielleicht auch aus sozialen Gründen, denn ich hatte bereits zwei Kinder im schulfähigen Alter – ein Jahr erlassen. Ich verdiente zum ersten Mal richtig Geld. Das waren ca. 700,- Mark. Da arbeitete ich dann eine ganze Weile, bis mich eine Mutter, die Direktorin an einer Berufsschule war und krampfhaft einen Deutschlehrer suchte, abgeworben. Und weil ihre Söhne bei mir lesen und schreiben gelernt hatten, fragte sie mich – es ging also nicht anders als heute, nicht alles über Partei und Stasi. Den Segen von der Schulverwaltung gab es auch und es fehlte nur noch die Partei. Weil ich aber der Tochter der Parteisekretärin ebenfalls Lesen und Schreiben beigebracht hatte – deren Töchter jetzt wieder meine Schüler sind – und anscheinend einen guten Ruf genossen habe – wir kannten uns ja nicht persönlich – hat sie das ebenfalls befürwortet und ich konnte dann an die Berufsschule wechseln. Das war der endgültige Ritterschlag. In der Berufsschule hat man wesentlich mehr Geld verdient, denn die wurden aus der Wirtschaft unterstützt. Man konnte im Prämiensystem besser bedacht werden. Ich hatte es dort sehr gut. Ich war die einzige Deutschlehrerin, niemand konnte mich verbessern. Geschichte musste ich an den Nagel hängen, denn auch die wenigen Abiturienten – das war eine Berufsschule für Gastronomie – hatten keinen Geschichtsunterricht. Hier hatte ich meinen Platz gefunden, als dann die Wende kam.
Die Betriebe wurden dann aufgelöst und somit auch die Berufsschulen und meine Schulleitung empfahl mir dann, mich für das Gymnasium zu bewerben und da ich auch politisch nicht vorbelastet war, konnte ich am Gymnasium unterrichten. Ich landete beim Scholl-Gymnasium, zu dem ich eigentlich nicht wollte, denn als ich Abiturient war, gab es in Magdeburg drei EOS. Zwei waren althergebrachte EOS OvG und EOS Humboldt – ich lernte damals am EOS OvG – und das dritte war das 1949 neu geschaffene Geschwister-Scholl-Gymnasium, für das Proletariat. Und so heimlich bestand ja noch der Krieg zwischen dem Bürgertum und dem Proletariat. Das Bürgertum belächelte die Arbeiterkinder. Das zeigte sich dann immer beim Sportfest in der Hermann Gieseler Halle, gegenüber saßen sich OvG und Humboldt und an der Stirnseite musste Scholl Aufstellung nehmen und wenn die einliefen pfiff alles und manchmal flogen auch schon mal ein paar Sachen hinüber.