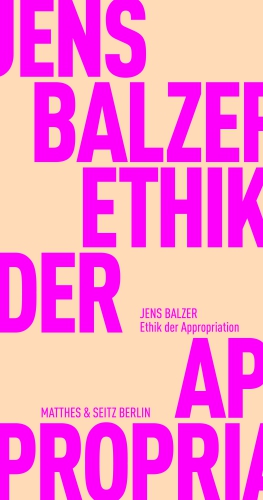Ei?
Frühstücksei. Das ist ein Wort, das kann mein Sohn noch nicht sagen. Er verlässt sich darauf, dass wir die letzte Silbe verstehen und ihm zu gegebener Zeit ein solches präsentieren. Die Zeit, zu der das passiert, ist immer sonntags. Und sobald wir beide vom Bäcker kommen und die Küche betreten haben, in der gerade ein Ei von meiner Frau abgepellt wird, ertönt der Ruf eines furchtbar seltsamen Vogels. Es klingt ein wenig nach den Möwen aus „Findet Nemo“, die stets und ständig „meins?“ rufen. Nur sein Ruf ist noch kürzer und bezieht sich direkt auf das dampfende weiße Ding, was gerade von der Küchenarbeitsplatte zum Frühstückstisch wandert: „Ei? Ei? Ei?“, dabei wird heftig mit dem Finger gezeigt und am Kinderstuhl geruckelt. „Jetzt setz mich doch, verdammt nochmal, endlich in den Sitz und gib mir das Ding da rüber!“ Das wäre mein Übersetzungsvorschlag für die lautstarke und gestenreiche Darbietung.
Ich wäre wahrscheinlich nicht der Vater unseres Sohnes, wenn ich nicht wüsste, dass ich als kleiner Junge nicht anders gewesen bin. Ich vermute, es gibt für jedes Kind in einem bestimmten Alter eine bestimmte Köstlichkeit, die alles zuvor Gelernte vergessen lässt und unter Aufbietung allen Vokabulars, aller Gestik und Mimik, und alles total durcheinander, einen Wunsch – nein, einen Willen! – formulieren lässt, den Eltern offensichtlich trotz aller sonstigen Verständigungsprobleme eindeutig identifizieren können.
„Ei?“, das kennen auch meine Eltern noch. Ich war ein Frühstückseiliebhaber besonderer Art. Ich war zuerst kein Gourmet in Sachen Frühstücksei, ich verschlang sie alle. „Alle?“, ruft mein Sohn Fiete dann, wenn ich ihm verständlich gemacht habe, dass er sein Ei restlos verputzt hat. Und dann schaut er auf mein Frühstücksei, zeigt darauf und ruft wieder: „Ei? Ei? Ei?“ Gestern habe ich mein Ei hinter einer Phalanx aus Kaffeetasse, Zuckerstreuer und Marmeladenglas versteckt, mein antifietestischer Schutzwall, das stimmte Fiete etwas ratlos, brachte ihn aber immerhin dazu, noch etwas anderes zu essen, außer die Eier von allen anderen, die am Frühstückstisch saßen. Meins war außer Sicht und das meiner Frau ist sowieso bereits nach Verzehr von zwei Brötchenhälften passé.
Früher verschlang ich mein Ei auch deshalb, weil ich zwei Geschwister habe. Ich verschlang einfach alles in wahnsinniger Geschwindigkeit. Gab es einen Nachschlag, so war ich mit meinem ersten Teller bereits fertig, bevor meine Mutter allen anderen aufgetan hatte. Das ging mit den meisten Dingen so, bis heute. Viel und schnell. Nur beim Ei, da wandelte sich mein Verhalten irgendwann als kleines Kind.
Ich war bereits so alt, dass ich wusste, wie man einen Löffel bedient, ich konnte mir mein Brötchen selbst schmieren – Butter, Salz und Pfeffer, etwas anderes esse ich heute noch nicht zum Ei – und ich habe irgendwann begriffen, dass es nur eine ganz bestimmte Zeit des Eiüberflusses gibt, nämlich Ostern, und ich mich sonst mit nur einem Ei zufriedengeben muss. Als ich das begriffen hatte, wandelte sich mein Verhältnis zum Frühstücksei grundlegend. Ich aß plötzlich mit Bedacht. Ein klitzekleiner Löffel portionierte das Ei zu immer kleineren Happen, die parallel zum Biss vom Brötchen in die Luke geschoben wurden. Ich konnte so bis zu drei Brötchen, also 6 Hälften, mit nur einem Ei essen. Grundlegend hat sich mein Essverhalten demnach nicht geändert, was meinen Vater also weiterhin den Kopf schütteln ließ, nur mit dem Ei ging ich plötzlich anders um.
Wenn Fiete, unser Sohn, demnächst eine Schwester bekommt, und diese nach geraumer Zeit ein eigenes Ei zum Frühstück – also in ca. 2 Jahren wahrscheinlich – wird er sich sein Brötchen selbst schmieren können. Dann wird er einen Eierbecher bekommen, das gleiche Format übrigens, wie die Eierbecher, die meine Eltern früher besaßen und wir heute noch besitzen – ich schätze fast jeder Haushalt der DDR verfügte über diesen Eierbechertyp der „tausend kleinen Dinge“, ein Gockel aus Plaste, einfarbig gelb, rot, blau oder grün – und er wird sich sein ganz persönliches Ei einteilen können, wie er will, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Ich wäre wahrscheinlich nicht der Vater unseres Sohnes, wenn ich nicht wüsste, dass ich als kleiner Junge nicht anders gewesen bin. Ich vermute, es gibt für jedes Kind in einem bestimmten Alter eine bestimmte Köstlichkeit, die alles zuvor Gelernte vergessen lässt und unter Aufbietung allen Vokabulars, aller Gestik und Mimik, und alles total durcheinander, einen Wunsch – nein, einen Willen! – formulieren lässt, den Eltern offensichtlich trotz aller sonstigen Verständigungsprobleme eindeutig identifizieren können.
„Ei?“, das kennen auch meine Eltern noch. Ich war ein Frühstückseiliebhaber besonderer Art. Ich war zuerst kein Gourmet in Sachen Frühstücksei, ich verschlang sie alle. „Alle?“, ruft mein Sohn Fiete dann, wenn ich ihm verständlich gemacht habe, dass er sein Ei restlos verputzt hat. Und dann schaut er auf mein Frühstücksei, zeigt darauf und ruft wieder: „Ei? Ei? Ei?“ Gestern habe ich mein Ei hinter einer Phalanx aus Kaffeetasse, Zuckerstreuer und Marmeladenglas versteckt, mein antifietestischer Schutzwall, das stimmte Fiete etwas ratlos, brachte ihn aber immerhin dazu, noch etwas anderes zu essen, außer die Eier von allen anderen, die am Frühstückstisch saßen. Meins war außer Sicht und das meiner Frau ist sowieso bereits nach Verzehr von zwei Brötchenhälften passé.
Früher verschlang ich mein Ei auch deshalb, weil ich zwei Geschwister habe. Ich verschlang einfach alles in wahnsinniger Geschwindigkeit. Gab es einen Nachschlag, so war ich mit meinem ersten Teller bereits fertig, bevor meine Mutter allen anderen aufgetan hatte. Das ging mit den meisten Dingen so, bis heute. Viel und schnell. Nur beim Ei, da wandelte sich mein Verhalten irgendwann als kleines Kind.
Ich war bereits so alt, dass ich wusste, wie man einen Löffel bedient, ich konnte mir mein Brötchen selbst schmieren – Butter, Salz und Pfeffer, etwas anderes esse ich heute noch nicht zum Ei – und ich habe irgendwann begriffen, dass es nur eine ganz bestimmte Zeit des Eiüberflusses gibt, nämlich Ostern, und ich mich sonst mit nur einem Ei zufriedengeben muss. Als ich das begriffen hatte, wandelte sich mein Verhältnis zum Frühstücksei grundlegend. Ich aß plötzlich mit Bedacht. Ein klitzekleiner Löffel portionierte das Ei zu immer kleineren Happen, die parallel zum Biss vom Brötchen in die Luke geschoben wurden. Ich konnte so bis zu drei Brötchen, also 6 Hälften, mit nur einem Ei essen. Grundlegend hat sich mein Essverhalten demnach nicht geändert, was meinen Vater also weiterhin den Kopf schütteln ließ, nur mit dem Ei ging ich plötzlich anders um.
Wenn Fiete, unser Sohn, demnächst eine Schwester bekommt, und diese nach geraumer Zeit ein eigenes Ei zum Frühstück – also in ca. 2 Jahren wahrscheinlich – wird er sich sein Brötchen selbst schmieren können. Dann wird er einen Eierbecher bekommen, das gleiche Format übrigens, wie die Eierbecher, die meine Eltern früher besaßen und wir heute noch besitzen – ich schätze fast jeder Haushalt der DDR verfügte über diesen Eierbechertyp der „tausend kleinen Dinge“, ein Gockel aus Plaste, einfarbig gelb, rot, blau oder grün – und er wird sich sein ganz persönliches Ei einteilen können, wie er will, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Shhhhh - 1. Okt, 09:45