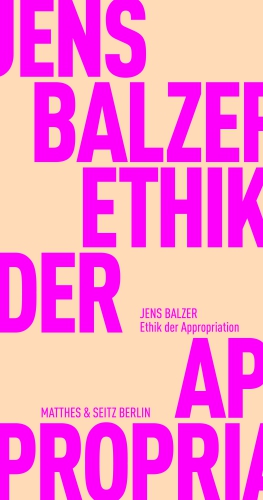Präpositionalkomposition und Kalauer
Wir haben gestern in einem Seminar hin und her überlegt, was es mit den Präpositionen auf sich hat. Wir hatten Fachleute am Start, haben uns in die Materie eingearbeitet und sind zu keinen neuen Ergebnissen gekommen, dafür aber zu neuen Fragen und komischen Sätzen.
Die interessanteste Frage, der ich selbst mit dem Wortregister der Eisenberggrammatik nicht beikommen konnte, ist die seltsame Fügung der Präposition "bis". Ganz klar verlangt sie den Akkusativ bei nachstehenden Substantiven und verhält sich auch sonst nicht komisch. Bis zu dem Punkt - ich schrieb es eben auf - wir eine zweite Präposition anhängen. Plötzlich ist der Akkusativ Makulatur und der Dativ, den das umtriebige "zu" verlangt, ist der Fall der Fälle.
Nun verhält es sich mit dem "zu" so, dass dieses kleine morphologische Wunder längst nicht nur als Präposition ihr Dasein fristet, sondern auch noch andere Funktionen übernimmt - ich schrieb schon darüber. Es kann zum Beispiel abtönen, indem ich sage: Zum Lateinkurs komme ich höchstwahrscheinlich zu spät, weil ich mich hier verquasselt habe. Oder in Infinitvkontruktionen gebraucht werden: Ohne mir darüber Sorgen zu machen, schreibe ich einfach weiter, weil der Dozent auch immer zu spät kommt.
Der von der Präposition "zu" verlangte Dativ scheint im Falle der Präpositionalkomposition einen höheren Stellenwert einzunehmen, ähnlich wie bei den Komposita, wo der zweite Wortbestandteil den ersten regiert und aus einem Pferd ( das ) eine Pferdekutsche ( die ) macht. Durch aus hat vielleicht einmal ein ähnliches Schicksal erlitten und sieht seine Einzelbedeutungen in Komposition mittlerweile zum Partikel geschrumpft. Wir schreiben durchaus sogar zusammen. Wir schreiben ständig Sachen zusammen, als wären die Wortzwischenstände, die irgendwann eingeführt worden sind, damit eine bessere Lesefähigkeit erreicht wird, gar nicht notwendig. Die Entwicklung der Sprache reicht anscheinend von bis zu und wieder zurück. "Bis" würde ich in Kombination mit "zu" übrigens auch als Partikel behandeln, es tönt das "zu" ja auch irgendwie ab.
Und bevor ich den geneigten Leser jetzt vollends abtörne, möchte ich noch kurz den tollen Satz präsentieren, der uns gestern vorgestellt wurde - ein hundsgemeiner Kalauer, dem ich glücklicherweise entronnen bin, da ich zu einem Zeitpunkt zu studieren anfing, als sich meine Eltern längst nicht mehr für mich verantwortlich fühlen mussten, ich habe mich da eher auf den Staat verlassen;) :
Der Stundent hängt vom Geld seiner Eltern ab.
Die interessanteste Frage, der ich selbst mit dem Wortregister der Eisenberggrammatik nicht beikommen konnte, ist die seltsame Fügung der Präposition "bis". Ganz klar verlangt sie den Akkusativ bei nachstehenden Substantiven und verhält sich auch sonst nicht komisch. Bis zu dem Punkt - ich schrieb es eben auf - wir eine zweite Präposition anhängen. Plötzlich ist der Akkusativ Makulatur und der Dativ, den das umtriebige "zu" verlangt, ist der Fall der Fälle.
Nun verhält es sich mit dem "zu" so, dass dieses kleine morphologische Wunder längst nicht nur als Präposition ihr Dasein fristet, sondern auch noch andere Funktionen übernimmt - ich schrieb schon darüber. Es kann zum Beispiel abtönen, indem ich sage: Zum Lateinkurs komme ich höchstwahrscheinlich zu spät, weil ich mich hier verquasselt habe. Oder in Infinitvkontruktionen gebraucht werden: Ohne mir darüber Sorgen zu machen, schreibe ich einfach weiter, weil der Dozent auch immer zu spät kommt.
Der von der Präposition "zu" verlangte Dativ scheint im Falle der Präpositionalkomposition einen höheren Stellenwert einzunehmen, ähnlich wie bei den Komposita, wo der zweite Wortbestandteil den ersten regiert und aus einem Pferd ( das ) eine Pferdekutsche ( die ) macht. Durch aus hat vielleicht einmal ein ähnliches Schicksal erlitten und sieht seine Einzelbedeutungen in Komposition mittlerweile zum Partikel geschrumpft. Wir schreiben durchaus sogar zusammen. Wir schreiben ständig Sachen zusammen, als wären die Wortzwischenstände, die irgendwann eingeführt worden sind, damit eine bessere Lesefähigkeit erreicht wird, gar nicht notwendig. Die Entwicklung der Sprache reicht anscheinend von bis zu und wieder zurück. "Bis" würde ich in Kombination mit "zu" übrigens auch als Partikel behandeln, es tönt das "zu" ja auch irgendwie ab.
Und bevor ich den geneigten Leser jetzt vollends abtörne, möchte ich noch kurz den tollen Satz präsentieren, der uns gestern vorgestellt wurde - ein hundsgemeiner Kalauer, dem ich glücklicherweise entronnen bin, da ich zu einem Zeitpunkt zu studieren anfing, als sich meine Eltern längst nicht mehr für mich verantwortlich fühlen mussten, ich habe mich da eher auf den Staat verlassen;) :
Der Stundent hängt vom Geld seiner Eltern ab.
Shhhhh - 18. Jan, 09:24