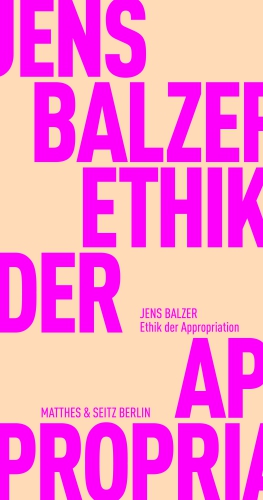Bei uns zu Haus sind gerade alle krank, außer mir. Sohn und Tochter sind krank. Den Einen plagt Fieber, die Andere plagt Heiserkeit und meine Frau hat Schwindelanfälle und Bauchschmerzen. Ich hatte für heute einen Arbeitstermin angenommen, kurzfristig und ohne darüber nachzudenken, weil ich das Geld brauchte. Ich war nicht da in der Zeit vom Mittagessen bis zum Abendbrot und saß nach einem Telefonat mit der erhaltenen Nachricht steigenden Fiebers auf heißer Kohle. Ich wollte endlich Feierabend machen und die Zeit klebte wie doppelseitiges Klebeband zwischen zwei Blättern aus Papier: ohne Schaden geht es nicht mehr auseinander.
Nicht einmal nach der Uhrzeit konnte ich schauen und es sofort wieder vergessen, wie es meine Angewohnheit ist, denn mein Akku im Telefon war alle. Wenn so etwas passiert, spüre ich ständig das Vibrieren in der Hosentasche, meinen Phantomschmerz. Ich befühlte den Apparat und fragte meine Kollegin nach der Zeit. Ich vergaß sie nicht, wie sonst, die Zeit blieb einfach stehen und ich wagte kaum erneut zu fragen.
Als ich dann kurz vor Dienstschluss die Toilette betrat, bemerkte ich die laufende Spülung in einer der Kabinen. Ich ging hinein, besah mir den Schaden. Der Hebel für die Arretierung der Wasserleitung bei Erreichen der Höchstmarke war defekt. Das Wasser sprudelte darüber hinweg und gluckerte ungenutzt in den Tank. Ich musste das Wasser abstellen. Um den Spülkasten nicht leer laufen zu lassen und damit folgende Gäste das Klo nicht verstopfen, schloss ich die Tür ab, ich holte mir einen Zettel und beschrieb ihn mit dem Wort „Defekt“.
Ich fand kein Klebeband für den Zettel, ich wusste ja bereits, wo es steckte und suchte nicht weiter danach. Ich nahm ein Pflaster aus dem Verbandskasten und befestigte den Zettel mit Hilfe des Pflasters an der Kabinentür, in der Hoffnung, die Botschaft würde schon verstanden werden. Dann hatte ich endlich Feierabend.
Ich hatte heute gleich mehrere Eingebungen innerhalb so kurzer Zeit, dass ich mein Notizbuch damit schlicht nicht strapazieren konnte. Da war die russische Referentin eines Vortrags, die ich wegen ihres Nachnamens erst einmal fragen musste, ob sie denn überhaupt aus Russland kommt. In dem Vortrag ging es um Mikropolitik und um Sätze mit seltsamen Verbpositionen, was das Verständnis leider arg beeinträchtigte. Der Nachname aber, der als erster und letzter Eintrag in meinem Notizbuch landete, endete mit „-ov“, was mich zu der Frage nach ihrer Herkunft brachte.
Ursprünglich, so dachte ich nämlich, sei es so gewesen, dass Nachnamen, die auf „-ov“ enden, Menschen aus der Ukraine oder aus Weißrussland produzieren, während die Nachnamenendung „-ow“ den Russen vorbehalten sei. Eine seltsame Beobachtung, ich weiß, aber mein System hatte bis dahin meist funktioniert, so dass ich mir ziemlich sicher war nach den vielen Fragerunden, die ähnlich konsternierte Gesichter hervorgerufen hatten wie das von heute – man stelle sich nur vor: in einem gut gefüllten Seminarraum zu sitzen, zu schwitzen und aufgeregt zu sein, weil gleich ein Referat zu einem Thema ansteht, das kritisch beäugt wird von den Seminarteilnehmern und noch kritischer vom Dozenten selbst, und dann kommt da so ein Typ, liest sich das Deckblatt der Powerpointpräsentation durch und fragt nach der eigenen Herkunft, weil der Name natürlich auch auf dem Titelblatt zu finden ist; das bringt einen doch völlig aus dem Konzept.
Sie sagte mir jedenfalls, sie komme aus Russland. Das nötigte mich dazu, eine kleine Notiz in mein Büchlein zu schreiben, woraufhin meine Banknachbarin fragte, ob dies ein Tagebuch sei. Ich verneinte und schrieb weiter an meinem kleinen Absatz zur Namenskunde. Ich überlege mir ja immer, warum, wer worauf zu kommen scheint, und es war ziemlich schnell klar, dass die Datumsanzeige, mit der ich den ersten Absatz eines Tages zu kennzeichnen pflege, die Frage nach dem Tagebuch herausgefordert hatte. Und kurz bevor das Seminar dann beginnen sollte, sagte ich der Referentin deshalb auch, weshalb ich sie so aus dem Konzept bringen musste: nämlich wegen meiner Beobachtung der Nachnamenendungen „-ov“ und „-ow“. Sie hatte dazu leider keine Idee.
Da ich mich bis dahin strikt geweigert hätte, eine andere Lösung als die Meine überhaupt in Betracht zu ziehen, muss ich seitdem immer wieder darüber nachdenken, wer denn die Eindeutschung eines slawischen Nachnamens vornimmt. Es muss ein Beamter des Einwohnermeldeamtes sein. Und da meine bisherige Theorie überhaupt nichts zu taugen scheint, habe ich mich jetzt darauf verstiegen, dass der Unterschied der Nachnamenendung im Osten und Westen der Bundesrepublik wurzelt. Während nämlich ein Ostdeutscher durchaus in den Genuss des Erlernens der russischen Sprache gekommen sein könnte, sich also mit der Eindeutschung russischer Nachnamen auskennen könnte, trifft das für Westdeutsche wahrscheinlich nicht zu. Eine Dienstanweisung wird es dazu wohl kaum geben. So sind also alle Emigranten, die im Ostteil der Republik eingebürgert wurden mit einem „-ow“ belegt, während die im Westen Eingebürgerten mit dem „-ov“ vorlieb nehmen müssen.
Das ist natürlich alles furchtbar einfach und erklärt in keinster Weise, welche Eingebungen ich denn noch zu erwarten hatte, aber darum ging es ja auch gar nicht.
Dass die deutsche Sprache sich vermittels simpelster Mathematik, ja, dass sich die verschiedensten Sprachen durch einfachste logische Zusammenhänge, wie sie die Mathematik bietet, erklären lässt, ist seit Chomsky und Turings längst kein Geheimnis mehr, das sich Linguisten hinter vorgehaltener Hand beim Pausenbrot im Sprachlabor erzählen müssen. Keine Krümel rieselten davon an die Öffentlichkeit, sondern ganze Berge von Monographien, Artikeln in Fachzeitschriften und nicht zuletzt auch Beiträge in populärwissenschaftlichen Magazinen und televisionellen Formaten. Doch lässt sich der interessierte Laie oftmals vom wissenschaftlichen Kauderwelsch täuschen und versinkt in sprachlose Apathie, sobald im ersten Satz der wissenschaftlichen Ausführungen mehrere Fremdworte auftauchen. Diese dem Wissenschaftler gemeinhin als distinktive Maßnahme getarnte, zu Eigen geratene Persönlichkeitsstörung, ist es zu verdanken, dass vieles, selbst die einfachsten Zusammenhänge im Verborgenen bleiben.
Heute möchte ich deshalb auf einen dieser simplen Zusammenhänge aufmerksam machen, sozusagen einen der „Krümel“ unter die Lupe nehmen: 1 + 1= 2. So einfach wie diese Gleichung daher kommt, vermittelt sie doch einen Charme, der es in sich hat. Neben dem Operator, dem Pluszeichen, das auf Addition hindeutet, sehen wir uns in der linken Hälfte der Gleichung mit zwei gleichen Zahlen konfrontiert, den Operanden. Diese verschmelzen, folgt man dem Gleichheitszeichen hinüber auf die rechte Seite, zu einer völlig neuen Zahl, dem dritten Zahlensymbol in dieser Gleichung. Verstörend daran könnte jetzt mein Ausdruck „drittes Zahlensymbol“ gewirkt haben, denn eigentlich sind nur zwei unterschiedliche Symbole in der Gleichung zu finden. Das hat aber durchaus seinen Sinn, denn um die Mathematik auf die Sprache zu übertragen benötigt der versierte Wissenschaftler viel mehr als nur die schlichte Übereinkunft des gerade angewendeten Zahlenkonzeptes.
Stünde nun zum Beispiel statt der Zahl 1 der Ausdruck Präposition und stünde für die Zahl 2 der Ausdruck Adverb, so hieße die eben noch unter 1 + 1 = 2 firmierende Gleichung: Präposition + Präposition = Adverb. Welchen Grad von Abstraktheit der Wissenschaftler beim Betrachten dieser Gleichung anwendet, ist ihm selbst überlassen, doch wie sich selbst für den Laien erschließen muss, 1 und 1 muss nicht dasselbe sein. So könnte zum Beispiel, um der Gleichung wieder die Praxisnähe angedeihen zu lassen, die unsereiner für notwendig erachtet, statt dem sperrigen Begriff „Präposition“ zu verwenden, einfach eine solche in die Gleichung eingefügt werden ( Welcher nicht halbwegs Gebildete kann mit der Zuordnung von Worten zu der Kategorie Präposition nichts anfangen? Doch wer von diesen kann auch etwas von der Etymologie, dem Geheimnis der Genese etwas beisteuern: nur der Spezialist, der Wissenschaftler, das macht er natürlich auch, aber leider nicht in allseits verständlicher Sprache ).
Nehmen wir die Präposition „vor“. Sie ist deshalb sehr gut geeignet, weil sie in sich bereits zwei unterschiedliche Fälle von Anwendung vereint, die erheblichen Einfluss auf das Satzgefüge haben können. Zum Einen ist sie als lokale, also den Ort spezifizierende Präposition bekannt, und zum Anderen gebietet sie auch über den temporalen, also den zeitlichen Ablauf bestimmenden Aspekt des Satzgefüges. Sie sehen, meine Damen und Herren: 1 und 1 ist nicht immer dasselbe. Ein ähnlicher Zusammenhang, der Sie nun hoffentlich gänzlich überzeugen wird, ist der Umstand, dass wir uns als gemeinsamen Grad der Abstraktion zwei verschiedene Präposition vorzustellen haben, die, obwohl in sich fast völlig verschieden, die Position des zweiten Operators 1 einnehmen soll: die Präposition „bei“. „Bei“ verhält sich ähnlich unentschieden in seiner Anwendung wie die Präposition „vor“, denn sowohl „beim Essen“ als auch „bei der Oma“ sind sinnvolle Ausdrücke, die sowohl den lokalen, als auch den temporalen Bedeutungsinhalt einer Phrase auszudrücken vermögen. Dass „bei“ allerdings immer den dritten Fall, den Dativ, fordert, unterscheidet sie in ihrer Vielseitigkeit vom „vor“. Würde man der Gleichung 1 + 1 = 2 stur folgen, ergäbe sich jetzt folgendes Phänomen: vor + bei = vorbei.
Das bestätigt natürlich nur den zuvor bereits untermauerten Zusammenhang, dass Präposition + Präposition = Adverb ist und wäre ehrlich gesagt viel zu simpel für den Wissenschaftler. Es verrät darüber hinaus auch noch etwas, das ich hier nur in Ansätzen schildern möchte, weil ich meine mathematischen Kenntnisse leider nicht in so tiefe Gewässer schicken möchte. Aber ansatzweise möchte ich dem geneigten Leser hier anzudeuten versuchen, weshalb der Wissenschaftler sich nicht nur in seinen schriftlichen oder mündlichen Ausführungen vom „normal“ Gebildeten unterscheidet, sondern darüber hinaus auch zu erstaunlichen Schlüssen kommen kann, die dann in Fachzeitschriften, Monographien, Sie wissen was ich meine….: Nehmen wir einmal an, bei der Gleichung 1 + 1 = 2 handelte es sich statt um ganze Zahlen um Brüche, also: 1/1 + 1/1 = 2/1. Der Mathematiker als auch der „Normalgebildete“ neigen dazu diesen Wust an Überfluss einfach wegzukürzen. Nicht so der Linguist. Der betrachtet die Komponenten erst einmal nach ihren Eigenschaften, bevor er sich dem Kürzen widmet und anders als beim Mathematiker, wo Gleiches gern gegen Gleiches aufgewogen wird, sprich gekürzt wird, sind es beim Linguisten, die Unterschiede, die nicht zu zählen haben.
Daraus ergibt sich dann in unserem Versuchsaufbau folgendes Szenario: „vor“ verlangt sowohl den dritten als auch den vierten Fall, kann sowohl temporal als auch lokal verwendet werden. „Bei“ verlangt lediglich den dritten Fall, kann ebenfalls lokal und temporal verwendet werden. Daraus ergibt sich, nach Kürzung aller Unterschiede, dass nach erfolgter Addition von beiderseitig befähigten, also lokal und temporal begabten Präpositionen ein Adverb entstehen muss, dass ausschließlich temporale Bezüge zuzulassen scheint. Dem Linguisten, der natürlich nur den allerletzten Satz, mit möglichst vielen Fremdwörtern belegt, in den Äther der medialen Verwertung schickt, obliegt es nun auf honorigem Posten, diese These zu beweisen. Das versteht niemand. Deshalb sieht sich nicht nur der Linguist, sondern insbesondere der Wissenschaftler im Allgemeinen stets und ständig der Elfenbeinturmargumentation ausgesetzt und er fühlt sich als unverstandener Experte aufs schmählichste in seiner Persönlichkeit verletzt.
Ich hoffe, meine bescheidenen Erklärungsversuche haben neben der allseitigen Erheiterung auch für ein wenig Erhellung gesorgt, meine Ausführungen sind damit am Ende. Vorbei.
Ich habe das Geheimnis ewiger Schönheit entdeckt. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt kommt's, ich werde das Geheimnis mit allen meinen Lesern teilen. Ist das nicht toll? Also, es geht los:
Länger schön ist man nur mit h.
Gestern wurde ich Zeuge einer völlig fehlgeleiteten Kommunikation. Wir standen am Strandleben und warteten darauf, dass die Cocktailschulung losgeht, als ein junger Mann mit dem Fahrrad zu uns stieß, sich zu uns gesellte und in die Unterhaltung mit einstieg. Dazu muss ich sagen, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt, also am Anfang der Saison, längst nicht alle von Angesicht, geschweige denn mit Namen kennen. Außerdem hatten wir offiziell auch geöffnet, es hätte sich also auch ein Gast an den Strand verirren können, wenngleich außer dem zukünftigen Personal niemand anderes anwesend war.
Ich war deshalb nicht weiter verwundert, als sich dieser Typ plötzlich zu uns stellte und Dinge fragte. Mir wurde es erst ein wenig mulmig, als er von den vielen Grillplätzen hier auf der Wiese sprach und – was wohl witzig sein sollte – auf fehlende Feuerlöscher hinwies. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das witzig meinte oder nicht, denn er löste das Dilemma nicht. Wenig später gab er an, dass er bemerken könnte, wie der Pollenflug wieder in die Gänge kam. Dass ständig die Kopfhaut juckt, Haare müssen abends und morgens gewaschen werden, häufiges Niesen, schwerer Kopf und und und.
An diesem Punkt war ich plötzlich der Einzige, der auf den Fremden hörte. Alle anderen hatten sich anderen Gesprächen zugewandt. Ich versuchte Anschluss zu bekommen und gleichzeitig Reißaus zu nehmen, denn nachdem ich nur kurz anmerkte, dass ich unter keinen dieser Symptome zu leiden hätte, wies er das völlig selbstverständlich von sich, so als wäre ich derjenige gewesen, der mit den ganzen dem Pollenflug einhergehenden Unannehmlichkeiten angefangen hätte. Ich fühlte mich wie in einem Roman von Knut Hamsun.
Schließlich, nach mehreren einsilbigen, aber dennoch höflichen Antworten, schaffte ich den Absprung und begab mich in ein Gespräch mit mir bekannten Akteuren. Und auf einmal war der Typ weg. Ich konnte ihn auf dem Hinweg zum Strand – eine Strecke von fast zweihundert Metern, gut einsehbar – und auch in unmittelbarer Nähe nicht mehr entdecken. Toilette hätte noch sein können, war aber nicht. Einfach weg. Ich fragte unseren Chef, ob er vielleicht einer von den Neuen sei, nein, zumindest hatte ich ihn mir nicht eingebildet.
In Hannover trifft man sich seit 150 Jahren schon „unterm Schwanz“. Zumindest behauptet das der Zoo in seiner neuen
Werbekampagne. Dieser vielleicht anrüchig anmutende Ort, also unterm Schwanz, hält natürlich längst nicht, was er verspricht, denn mit diesem Ort ist das weitausladende Hinterteil eines
Reiterstandbildes gemeint, das direkt vor dem Eingang des Hauptbahnhofes steht.
Ein überdimensionierter Ernst August reitet auf seinem nicht minder stattlichen Pferd gemächlich in Richtung Innenstadt. Der Schwanz des Tieres hingegen wendet sich dem Bahnhof zu, gleich so als würde das antiquierte Fortbewegungsmittel Pferd einen Furz auf die neue Art des Reisens geben. Einen Furz lässt das Pferd aber nicht. Auch Pferdeäpfel gehören für diesen Gaul längst der Vergangenheit an, was die Treffpunktbenutzer unterm Schwanz, den die Hannoveraner ja seit 150 Jahren ansteuern, vor herunterfallenden Exkrementen bewahrt.
Der Zoo nun wieder dachte sich, dass mit einer Werbekampagne ganz im Sinne dieses Treffpunkts, unterm Schwanz, ja auch Tiere aus dem Zoo gemeint sein könnten. Angesichts sinkender Einnahmen wegen allzu schlechten Wetters, käme es den Betreibern gerade recht, wenn die Hannoveraner sich nicht unterm Schwanz am Hauptbahnhof träfen, sondern unterm Schwanz im Zoo.
Bildgeber in dieser merkwürdigen Metapher sind übrigens tatsächlich Zootiere, das heißt also, der Hannoveraner kann sich dann unterm Schwanz eines
Elefanten treffen oder eines
Zebras oder eines
Leoparden. Das ist selbstverständlich längst nicht so ungefährlich wie unterm Schwanz am Hauptbahnhof, sind das doch erstens trotzdem wilde Tiere, auch wenn sie im Zoo leben, und zweitens könnten diese Tiere tatsächlich einen Haufen machen, weshalb sich dieser Treffpunkt nur bedingt eignet, sollte man danach noch etwas vor haben.
Genau aus diesen Überlegungen heraus hat der Zoo zwei unschlagbare Tricks aus der Mottenkiste geholt: bei den Tieren, die im Erwachsenenalter tatsächlich gefährlich sein könnten, sind statt großer, womöglich fleischfressender Raubkatzen niedliche kleine Tierbabys aufgenommen worden. Nur beim Zebra, dem harmlosesten von den dreien, haben sie auf den zusätzlichen Niedlichkeitsfaktor verzichtet.
Der zweite Trick aber ist so perfide, dass ich schon eine ganze Weile suchen musste, um herauszufinden, wie die das überhaupt gemacht haben. Ich musste
wahnwitzige Suchanfragen in Google stellen, um den offensichtlichen Mangel im Zoobild aufzudecken, und gefühlte hundert Jahre später hatte ich dann endlich ein
Vergleichsbild gefunden. Wollen Sie noch wissen, was der Zoo gemacht hat? Ja? Die haben dem armen kleinen Elefanten einfach das Arschloch wegretuschiert, damit er niemandem auf den Kopp scheißen kann!
Ich habe meiner Tochter heute Morgen etwas vorgelesen und bin dabei über einen Satz gestolpert, den ich darauf immer wieder lesen musste, so interessant fand ich ihn. Meine Tochter übrigens fand ihn nicht interessant, sie schlief kurz darauf ein; es sei ihr gegönnt. Jedenfalls hätte ich das auch alles für mich behalten, wenn heute nicht zufällig der Welttag des Buches wäre. Im Übrigen finde ich es jammerschade, fast schon beschämend, dass sich Google dazu nichts einfallen ließ und seine Startseite ein wenig umgestaltete, aber so sind sie die neuen Medien.
Jedenfalls - ich komme endlich zu dem Satz - las ich ihn in einem Buch namens „Ragtime“ von E.L. Doctorow. Ich habe den Satz ein wenig abgewandelt und dem Präteritum entrissen, das passt hier inhaltlich besser. Ich hoffe, niemand ist deshalb empört:
„Das System von Sprache und Begriffsbildung beruht auf der These, dass Menschen mit dem Akt des Zeugnis-Ablegens die Grenzen von Zeit und Ort, in denen sie ihr Leben verbrachten, überschreiten und sich in anderen Zeiten und an anderen Orten Gegenwärtigkeit sichern.“
Normalerweise habe ich hier den Satz zitiert, der auf dem Bild zu sehen ist. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das Zitat aus dem Buch selbst stammt und nicht aus der Werbeanzeige.

Bildquelle: E.L. Doctorow, Ragtime, Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, März 1995.
Konstellation und Charakter der Figur bestimmen das Scheitern in der Tragödie. Doch selten steht die Katastrophe am Anfang. Sie ist das Element, das sich erst aus der Geschichte entwickeln muss. Die Eigenheiten, die Umstände verlangen nach Beschreibung, bevor der Protagonist scheitern darf. So ist es in der Fiktion häufig, wenn auch nicht immer, anzutreffen. In der Realität kann die Katastrophe auch schon einmal am Anfang stehen und die Erklärung erfolgt erst später. Manchmal braucht es jemanden mit genügend Abstand, um hinreichend erklären zu können, weshalb es überhaupt zur Katastrophe, zur Tragödie kam. Und stehen gleich mehrere Tragödien miteinander in Beziehung, dann können durchaus Jahrhunderte vergehen, bis dieser Zusammenhang hergestellt wird. Das nun Folgende berichtet von einem solchen Zusammenhang, von einer Fußnote und einem Ereignis, das die Welt Kopf stehen ließ.
Es war im Jahre 1796 als der damals 24-jährige David Kinnebrook in einer sternklaren Nacht, der Auge-Ohr-Methode nach, die Durchlaufgeschwindigkeit eines Himmelsobjekts bestimmen sollte. Er musste dafür simultan auf die Sekundensignale einer Uhr achten und das Himmelsobjekt bei seinem Durchgang durch den Meridianfaden seines Teleskopokulars im Blick behalten.
Sein Vorgesetzter, niemand geringeres als der 5. Königliche Astronom an der Sternwarte zu Greenwich, Sir Nevil Maskelyne, musste ihn, seinen Angestellten, nach Absolvieren dieser Aufgabe entlassen. Die Differenz in der Genauigkeit der Angaben Kinnebrooks war für den Astronom nicht hinnehmbar. Bis zu 800 Millisekunden wich das Ergebnis seines Assistenten von seinen eigenen Ergebnissen ab, und Maskelyne konnte sich dies nicht anders erklären, als dass es seinem Assistenten an der nötigen Sorgfalt mangelte.
Kinnebrook war zum Zeitpunkt seiner Entlassung noch keine zwei Jahre Maskelynes Assistent und nur 6 Jahre später starb er, 9 Jahre vor seinem ehemaligen Dienstherrn, obwohl dieser 40 Jahre älter war als er. Vor Gram vielleicht? Wir wissen es nicht, denn in die Geschichte eingegangen ist nur das Versagen Kinnebrooks, nicht seine Lebensgeschichte.
Nur wenige Jahre später, um genau zu sein, 24 Jahre später, als David Kinnebrook noch nicht zu einer Fußnote der Geschichte herabgestuft worden war, erfuhr der berühmte Mathematiker und Astronom Friedrich Wilhelm Bessel von diesem Fall. Diese Geschichte beschäftigte ihn intensiv genug, um einen eigenen Test anzustrengen. Er ließ den Test unter vergleichbaren Bedingungen von seinem Personal ausführen. Einige seiner Mitarbeiter, Kinnebrook an Erfahrung teilweise weit überlegen, waren nicht imstande ein so genaues Ergebnis zu generieren. Die Diskrepanzen in den einzelnen Messungen beliefen sich zum Teil auf mehr als eine Sekunde!
Vielleicht postierten sich die Messungen um einen Wert herum und traten umso seltener auf, je größer die Differenz war? Das ließe sich nachprüfen, ist aber bisher nicht von Belang. Wir wissen es nicht, und es wurde auch niemand entlassen, es kam zu keiner zweiten Tragödie. Bessel bewies Umsicht, denn ihm muss plötzlich klar geworden sein, dass diese individuellen Differenzen nicht auf die Arbeitseinstellung zurückzuführen waren, sondern andere Ursachen hatten.
Fortsetzung folgt.