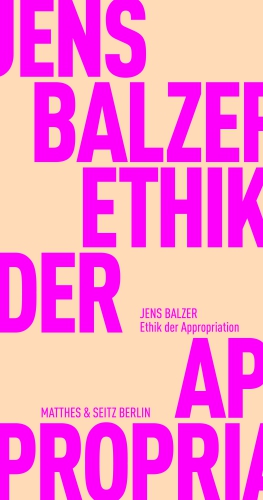Ich habe das Geheimnis ewiger Schönheit entdeckt. Ist das nicht wunderbar? Und jetzt kommt's, ich werde das Geheimnis mit allen meinen Lesern teilen. Ist das nicht toll? Also, es geht los:
Länger schön ist man nur mit h.
Gestern wurde ich Zeuge einer völlig fehlgeleiteten Kommunikation. Wir standen am Strandleben und warteten darauf, dass die Cocktailschulung losgeht, als ein junger Mann mit dem Fahrrad zu uns stieß, sich zu uns gesellte und in die Unterhaltung mit einstieg. Dazu muss ich sagen, dass wir uns zu diesem Zeitpunkt, also am Anfang der Saison, längst nicht alle von Angesicht, geschweige denn mit Namen kennen. Außerdem hatten wir offiziell auch geöffnet, es hätte sich also auch ein Gast an den Strand verirren können, wenngleich außer dem zukünftigen Personal niemand anderes anwesend war.
Ich war deshalb nicht weiter verwundert, als sich dieser Typ plötzlich zu uns stellte und Dinge fragte. Mir wurde es erst ein wenig mulmig, als er von den vielen Grillplätzen hier auf der Wiese sprach und – was wohl witzig sein sollte – auf fehlende Feuerlöscher hinwies. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das witzig meinte oder nicht, denn er löste das Dilemma nicht. Wenig später gab er an, dass er bemerken könnte, wie der Pollenflug wieder in die Gänge kam. Dass ständig die Kopfhaut juckt, Haare müssen abends und morgens gewaschen werden, häufiges Niesen, schwerer Kopf und und und.
An diesem Punkt war ich plötzlich der Einzige, der auf den Fremden hörte. Alle anderen hatten sich anderen Gesprächen zugewandt. Ich versuchte Anschluss zu bekommen und gleichzeitig Reißaus zu nehmen, denn nachdem ich nur kurz anmerkte, dass ich unter keinen dieser Symptome zu leiden hätte, wies er das völlig selbstverständlich von sich, so als wäre ich derjenige gewesen, der mit den ganzen dem Pollenflug einhergehenden Unannehmlichkeiten angefangen hätte. Ich fühlte mich wie in einem Roman von Knut Hamsun.
Schließlich, nach mehreren einsilbigen, aber dennoch höflichen Antworten, schaffte ich den Absprung und begab mich in ein Gespräch mit mir bekannten Akteuren. Und auf einmal war der Typ weg. Ich konnte ihn auf dem Hinweg zum Strand – eine Strecke von fast zweihundert Metern, gut einsehbar – und auch in unmittelbarer Nähe nicht mehr entdecken. Toilette hätte noch sein können, war aber nicht. Einfach weg. Ich fragte unseren Chef, ob er vielleicht einer von den Neuen sei, nein, zumindest hatte ich ihn mir nicht eingebildet.
In Hannover trifft man sich seit 150 Jahren schon „unterm Schwanz“. Zumindest behauptet das der Zoo in seiner neuen
Werbekampagne. Dieser vielleicht anrüchig anmutende Ort, also unterm Schwanz, hält natürlich längst nicht, was er verspricht, denn mit diesem Ort ist das weitausladende Hinterteil eines
Reiterstandbildes gemeint, das direkt vor dem Eingang des Hauptbahnhofes steht.
Ein überdimensionierter Ernst August reitet auf seinem nicht minder stattlichen Pferd gemächlich in Richtung Innenstadt. Der Schwanz des Tieres hingegen wendet sich dem Bahnhof zu, gleich so als würde das antiquierte Fortbewegungsmittel Pferd einen Furz auf die neue Art des Reisens geben. Einen Furz lässt das Pferd aber nicht. Auch Pferdeäpfel gehören für diesen Gaul längst der Vergangenheit an, was die Treffpunktbenutzer unterm Schwanz, den die Hannoveraner ja seit 150 Jahren ansteuern, vor herunterfallenden Exkrementen bewahrt.
Der Zoo nun wieder dachte sich, dass mit einer Werbekampagne ganz im Sinne dieses Treffpunkts, unterm Schwanz, ja auch Tiere aus dem Zoo gemeint sein könnten. Angesichts sinkender Einnahmen wegen allzu schlechten Wetters, käme es den Betreibern gerade recht, wenn die Hannoveraner sich nicht unterm Schwanz am Hauptbahnhof träfen, sondern unterm Schwanz im Zoo.
Bildgeber in dieser merkwürdigen Metapher sind übrigens tatsächlich Zootiere, das heißt also, der Hannoveraner kann sich dann unterm Schwanz eines
Elefanten treffen oder eines
Zebras oder eines
Leoparden. Das ist selbstverständlich längst nicht so ungefährlich wie unterm Schwanz am Hauptbahnhof, sind das doch erstens trotzdem wilde Tiere, auch wenn sie im Zoo leben, und zweitens könnten diese Tiere tatsächlich einen Haufen machen, weshalb sich dieser Treffpunkt nur bedingt eignet, sollte man danach noch etwas vor haben.
Genau aus diesen Überlegungen heraus hat der Zoo zwei unschlagbare Tricks aus der Mottenkiste geholt: bei den Tieren, die im Erwachsenenalter tatsächlich gefährlich sein könnten, sind statt großer, womöglich fleischfressender Raubkatzen niedliche kleine Tierbabys aufgenommen worden. Nur beim Zebra, dem harmlosesten von den dreien, haben sie auf den zusätzlichen Niedlichkeitsfaktor verzichtet.
Der zweite Trick aber ist so perfide, dass ich schon eine ganze Weile suchen musste, um herauszufinden, wie die das überhaupt gemacht haben. Ich musste
wahnwitzige Suchanfragen in Google stellen, um den offensichtlichen Mangel im Zoobild aufzudecken, und gefühlte hundert Jahre später hatte ich dann endlich ein
Vergleichsbild gefunden. Wollen Sie noch wissen, was der Zoo gemacht hat? Ja? Die haben dem armen kleinen Elefanten einfach das Arschloch wegretuschiert, damit er niemandem auf den Kopp scheißen kann!
Ich habe meiner Tochter heute Morgen etwas vorgelesen und bin dabei über einen Satz gestolpert, den ich darauf immer wieder lesen musste, so interessant fand ich ihn. Meine Tochter übrigens fand ihn nicht interessant, sie schlief kurz darauf ein; es sei ihr gegönnt. Jedenfalls hätte ich das auch alles für mich behalten, wenn heute nicht zufällig der Welttag des Buches wäre. Im Übrigen finde ich es jammerschade, fast schon beschämend, dass sich Google dazu nichts einfallen ließ und seine Startseite ein wenig umgestaltete, aber so sind sie die neuen Medien.
Jedenfalls - ich komme endlich zu dem Satz - las ich ihn in einem Buch namens „Ragtime“ von E.L. Doctorow. Ich habe den Satz ein wenig abgewandelt und dem Präteritum entrissen, das passt hier inhaltlich besser. Ich hoffe, niemand ist deshalb empört:
„Das System von Sprache und Begriffsbildung beruht auf der These, dass Menschen mit dem Akt des Zeugnis-Ablegens die Grenzen von Zeit und Ort, in denen sie ihr Leben verbrachten, überschreiten und sich in anderen Zeiten und an anderen Orten Gegenwärtigkeit sichern.“
Normalerweise habe ich hier den Satz zitiert, der auf dem Bild zu sehen ist. Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass das Zitat aus dem Buch selbst stammt und nicht aus der Werbeanzeige.

Bildquelle: E.L. Doctorow, Ragtime, Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, März 1995.
Konstellation und Charakter der Figur bestimmen das Scheitern in der Tragödie. Doch selten steht die Katastrophe am Anfang. Sie ist das Element, das sich erst aus der Geschichte entwickeln muss. Die Eigenheiten, die Umstände verlangen nach Beschreibung, bevor der Protagonist scheitern darf. So ist es in der Fiktion häufig, wenn auch nicht immer, anzutreffen. In der Realität kann die Katastrophe auch schon einmal am Anfang stehen und die Erklärung erfolgt erst später. Manchmal braucht es jemanden mit genügend Abstand, um hinreichend erklären zu können, weshalb es überhaupt zur Katastrophe, zur Tragödie kam. Und stehen gleich mehrere Tragödien miteinander in Beziehung, dann können durchaus Jahrhunderte vergehen, bis dieser Zusammenhang hergestellt wird. Das nun Folgende berichtet von einem solchen Zusammenhang, von einer Fußnote und einem Ereignis, das die Welt Kopf stehen ließ.
Es war im Jahre 1796 als der damals 24-jährige David Kinnebrook in einer sternklaren Nacht, der Auge-Ohr-Methode nach, die Durchlaufgeschwindigkeit eines Himmelsobjekts bestimmen sollte. Er musste dafür simultan auf die Sekundensignale einer Uhr achten und das Himmelsobjekt bei seinem Durchgang durch den Meridianfaden seines Teleskopokulars im Blick behalten.
Sein Vorgesetzter, niemand geringeres als der 5. Königliche Astronom an der Sternwarte zu Greenwich, Sir Nevil Maskelyne, musste ihn, seinen Angestellten, nach Absolvieren dieser Aufgabe entlassen. Die Differenz in der Genauigkeit der Angaben Kinnebrooks war für den Astronom nicht hinnehmbar. Bis zu 800 Millisekunden wich das Ergebnis seines Assistenten von seinen eigenen Ergebnissen ab, und Maskelyne konnte sich dies nicht anders erklären, als dass es seinem Assistenten an der nötigen Sorgfalt mangelte.
Kinnebrook war zum Zeitpunkt seiner Entlassung noch keine zwei Jahre Maskelynes Assistent und nur 6 Jahre später starb er, 9 Jahre vor seinem ehemaligen Dienstherrn, obwohl dieser 40 Jahre älter war als er. Vor Gram vielleicht? Wir wissen es nicht, denn in die Geschichte eingegangen ist nur das Versagen Kinnebrooks, nicht seine Lebensgeschichte.
Nur wenige Jahre später, um genau zu sein, 24 Jahre später, als David Kinnebrook noch nicht zu einer Fußnote der Geschichte herabgestuft worden war, erfuhr der berühmte Mathematiker und Astronom Friedrich Wilhelm Bessel von diesem Fall. Diese Geschichte beschäftigte ihn intensiv genug, um einen eigenen Test anzustrengen. Er ließ den Test unter vergleichbaren Bedingungen von seinem Personal ausführen. Einige seiner Mitarbeiter, Kinnebrook an Erfahrung teilweise weit überlegen, waren nicht imstande ein so genaues Ergebnis zu generieren. Die Diskrepanzen in den einzelnen Messungen beliefen sich zum Teil auf mehr als eine Sekunde!
Vielleicht postierten sich die Messungen um einen Wert herum und traten umso seltener auf, je größer die Differenz war? Das ließe sich nachprüfen, ist aber bisher nicht von Belang. Wir wissen es nicht, und es wurde auch niemand entlassen, es kam zu keiner zweiten Tragödie. Bessel bewies Umsicht, denn ihm muss plötzlich klar geworden sein, dass diese individuellen Differenzen nicht auf die Arbeitseinstellung zurückzuführen waren, sondern andere Ursachen hatten.
Fortsetzung folgt.
Ich habe mich gestern gleich zweimal in der Vorlesung zur Pädagogischen Psychologie geärgert. Zuerst – da konnte ich mich fast noch gar nicht drüber ärgern, weil ich ja nicht wissen konnte, was danach geschieht – erzählt der Dozent von den ganzen Errungenschaften der Institution Schule und der ganzen Forschung darüber und wie sich dieser Kasper David Precht doch erlauben kann, dies alles einfach über Bord werfen zu wollen, und dass die ZEIT darüber auch noch einen Artikel druckt, der mehr Buchstaben enthält als eine ganze BILD-Zeitung. Ich gebe zu, ich bin kein Freund des Gedankens, alles über Bord zu werfen, ähnlich wenig gefällt mir Precht. Aber im Rahmen einer Vorlesung kann doch die eigene Meinung auch einmal draußen bleiben, gerade wenn es nicht um allgemeines FDP-Bashing geht ( was der Dozent bisher in jeder Sitzung anbrachte ), sondern um Dinge, die direkt mit dem Gegenstand der Vorlesung zu tun haben. In diesem Zusammenhang dann auch noch über Lehrkräfte herzuziehen, die ja eher die ZEIT lesen als die BILD, war für mich als zukünftige Lehrkraft dann auch nicht lustig. Ein Großteil des Plenums lachte sogar an dieser Stelle.
Ferner bin ich kein Freund von PISA, zu vieles bleibt da zu wenig transparent. Umso interessierter war ich plötzlich, als das folgende Schaubild erläutert wurde. Da befanden sich am linken Rand zwei große Felder, in denen von sozialem und kulturellem Kapital die Rede war. Unbedingt sollten wir uns das merken, hieß es, das wäre ganz neu und ein Verdienst der PISA-Studien.
Die aus Platzgründen fehlende Quellenangabe dieses Schaubildes musste ich erfragen. Und irgendwie kamen mir die Begriffe auch seltsam bekannt vor. Ich musste davon schon einmal gelesen haben. Der Hinweis, dass dies völlig neu sei, brachte mich also einigermaßen durcheinander. Wenig später fiel mir dann auch ein, wer dazu geschrieben hatte. Bordieu hat ganz ähnliche Kapitalbegriffe fast 20 Jahre früher eingeführt als PISA. Auf meine Nachfrage hin erhielt ich dann die interessante Antwort, dass mein Einwand absolut korrekt sei, aber erst jetzt auch empirische Daten vorlägen, die Bordieus Theorie stützen würden.
Eigentlich wünsche ich mir das nicht, aber wenn morgen jemand begänne, empirische Daten zu Prechts Vorstellungen einer neuen Schule zu sammeln, könnte ich vielleicht noch zu Lebzeiten ganz andere Witze auf Kosten ganz anderer hören, sollte ich im Rentenalter noch einmal die Muße besitzen, mich in eine Psychologievorlesung zu setzen. Die Arroganz mancher dieser Zunftvertreter schlägt mir manchmal ganz schön aufs Gemüt.
Leider gibt es derzeit viel zu viel zu tun und das Wetter ist auch gegen mich; es schickt wärmende Strahlen zur Erde und lässt die Knospen der Bäume aufbrechen. Die Kastanien beispielsweise scheinen in einer sehr eigenen Kommunikation mit den außerirdischen Sonnenstrahlen zu stehen. Die Knospen sitzen wie kleine Alienfinger auf den Spitzen der Äste, zeigen in den Himmel und telefonieren nach Hause. Ich dagegen sitze viel zu selten am Schreibtisch und noch seltener gehe ich der Arbeit nach, die ein neues Semester mit sich bringt. Gleich am kommenden Freitag muss ich ein Referat zur Geschichte der Intelligenzforschung halten und habe bis auf die Texte zu lesen noch nichts Nennenswertes dafür getan.
Ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich einem trockenen Vortrag mit lauter Namen und Daten aus dem Weg gehen kann. Direkt vor meinem Fenster hat eine Dachdeckerfirma ein Gerüst gebaut und transportiert nun unter starker Geräuschkulisse Ziegel nach unten. Ich kann mich gar nicht konzentrieren bei dem ganzen Gewusel da drüben. Und wie gesagt, draußen ist es gerade viel zu schön, als dass ich mich hier drin verkriechen wollte. Scheiße.
Nehmen wir das Flaster als das, was es ist: unvollständig. Wem geht es nicht so wie mir, der schmerzhaft das Gesicht verzieht, als wäre etwas furchtbar Kaltes an einen empfindsamen Zahn gelangt und der Schmerz bohrte sich nun den offen liegenden Wurzelkanal entlang bis in den Knochen. Und alles nur, weil wir dem Flaster das „P“ raubten. Denn richtig muss es Pflaster heißen.
Nun ergab sich jedoch, und wahrscheinlich nicht nur für mich, schon einmal die Situation, dass wir unzufrieden waren mit dem Behelf, mit dem Pflaster. Es könnte ja sein, die Straße wurde aufgebrochen für ein neues Erdkabel, und anschließend mehr schlecht als recht wieder verschlossen. Wer will da von Pflaster sprechen. Oder ein tiefer Schnitt, wie ihn nur ein furchtbar scharfes Messer antun kann, durchzieht plötzlich den Zeigefinger, und alles was Sie tun können, ist ein Pflaster, das so schnell durchgeblutet ist wie diese modernen Teefilterpapiere im heißen Wasserglas. Wer will solche Gegenstände, die mehr Notbehelf als Lösung sind, denn mit etwas belegen, dass eine solch lange etymologische Geschichte der Heilung und des Straßenbelags vorzuweisen hat?
Schon die alten Griechen kannten das Pflaster als „émplast(r)on“, eine zu Heilzwecken aufgetragene Salbe. Aus dem Mittellateinischen fand die Entlehnung in das Althochdeutsche statt und zu der Bedeutung des Wundpflasters gesellte sich der aus Zement oder Mörtel bestehende Fußbodenbelag. Zementierter Boden! Für die Ewigkeit! Noch heute hält sich das Pflaster in dieser Bedeutung! Wäre es da nicht von Vorteil ein weniger starkes Äquivalent zu finden, mit dem man die schlechten und unvollständigen Beläge belegen kann?
Nicht umsonst schrieb ich stark. Denn bei den Verben kennen wir es schon. Der Übergang vom starken Verb zum schwachen Verb, häufig mit der Grammatikalisierung in Verbindung gebracht und als Sprachwandelphänomen stigmatisiert, ist ein Prozess, der sich in unserem Beispiel auf ein Substantiv übertragen ließe. Fast jeder kennt die Konjugation von bellen: bellen, bellte und gebellt. Früher hieß es allerdings noch: bellen, boll, gebollen! Natürlich müssten die Regeln für schwache Substantive andere sein als für schwache Verben, denn ein Substantiv ist mit einem Verb nicht vergleichbar. Aber warum sollte es denn nicht auch schwache Substantive geben?
Stellen Sie sich einmal vor, sie nutzen das Wort Flaster immer dann, wenn Sie mit den Eigenschaften desselben nicht einverstanden sind, und wenn Sie es sind, dann benutzen Sie das Wort Pflaster. Schwach wäre das Substantiv Flaster deshalb, weil es in seiner Deklination vom Pflaster abhängig ist und auch sonst jeden Quatsch mitmacht, den Sie mit Pflaster machen können. Sie können zum Beispiel einen Weg beflastern. Nein! Sie nicht. Ihr Nachbar würde seinen Weg beflastern, würden Sie sagen, weil Sie das ja viel besser können. Erkennen Sie das Ausmaß der Möglichkeiten?
Im Übrigen werde ich jetzt zum Zahnarzt gehen. Ich benötige eine neue Füllung, weil die alte an einem harten Stück Brot entzwei brach. Und weil diese Dinger, also die Füllungen, meist nicht von Dauer sind, geschieht es ihnen ganz recht, dass sie des „P“ beraubt wurden. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag!