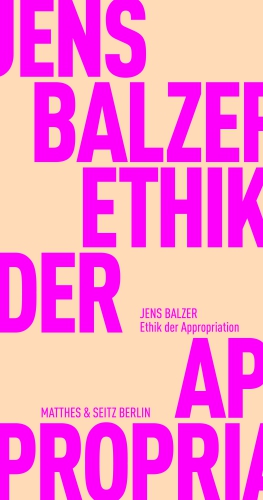Eine besonders merkwürdige Facette des Todes ist sein Gestank, mal abgesehen vom Toten selbst, der vielleicht ganz andere Probleme hatte. Der Tod macht etwas mit den Lebenden, es findet plötzlich eine Verdrängung der Umstände statt, die sich nicht nur sich selbst gegenüber beschwichtigend äußern kann: Gestank durch Tod ist dann nämlich selten Tod, da stinkt zum Beispiel lieber etwas anderes. In unserem Fall war es Güllegeruch von frisch gedüngten Feldern, weil das Fenster offen war. Ich wusste es besser und sagte dazu nichts. Ich schaltete stattdessen die Klimaanlage im Auto aus und öffnete meinerseits ebenfalls das Fenster. Wir fuhren nach Haus.
Später, ich befand mich vor dem Haus, wo die Person wohnte, deren Auto wir uns geliehen hatten, erinnerte ich mich des Gestanks. Ich ging zum längst geparkten, abgeschlossenen Auto zurück, öffnete die Motorhaube und steckte meine Nase in Angelegenheiten. Schnell war der Geruchsherd ausgemacht. Es war ein kleiner Vogel, der, tot, in einer Ecke lag und stank. Stinken ist ein starkes Verb: stinken, stank, gestunken. Das ist auch ein ziemlich starkes Indiz dafür, wie uns die Nase umtreibt. Jedenfalls, der Vogel stank erbärmlich. Er lag eingekeilt neben dem Eingang der Lüftung. Ich entfernte ihn mit einem Stock und ging nach getaner Arbeit zurück zur Haustür, wo ich den Schlüssel in den Briefkasten werfen sollte.
Als ich da so stand, sah ich mich um nach jemandem, der womöglich einen Schlüssel für die Haustür besitzen könnte. Es ist mir immer sehr unangenehm irgendwo klingeln zu müssen, um in einen Hausflur zu kommen, denn die Person, in deren Briefkasten der Autoschlüssel gehörte war nicht da; der Briefkasten aber war im Hausflur an der Wand befestigt. Ich öffnete mein mitgebrachtes Bier, was ich mir für den Fußweg heimwärts mitgebracht hatte, da sprach es plötzlich hinter mir: „Alkohol tötet.“ Er maß nur einen Meter, war aber ganz Empörung. Leben tötet, dachte ich. In seinem Haus, diesem Haus, sei ein Mann gestorben letzte Woche, weil er zu viel Bier getrunken hatte. Werd‘ du erst mal so alt wie ich, dachte ich, dann reden wir noch mal. Ich ignorierte ihn weitestgehend, war aber froh, dass er die Tür aufschloss und mich den Autoschlüssel in den Briefkasten versenken ließ. Nur wenige Tage später erfuhr ich dann die Geschichte des toten Mannes in diesem Haus. 3 Wochen lang merkte niemand etwas, bis auf den Gestank. Der Gestank führte dann auch zum Auffinden der Leiche. Wenn ich mal tot bin, möchte ich auch ordentlich stinken.
 Tja, die Woche
Tja, die Woche ist rum und ich bin das Glanzstückchen schon wieder los. Darum bin ich ein wenig traurig. Ansonsten war die Woche hier sehr heiter, was nicht zuletzt an den Kommentaren lag. Ich musste gleich beim ersten Kommentar googeln: "die Stütze ist da:ergo bibamus", denn meine Lateinkenntnisse sind sehr bescheiden. Da traf ich gleich auf den ollen Goethe und trank einen auf ihn.
Sehr interessant war auch die Assoziation "Draußen nur Gläschen", was mich die ganze Zeit überlegen ließ, was wohl drinnen genommen wird; ich kam nicht dahinter.
Naja, jedenfalls war das eine kleine feine Sammlung von Spitzen, die gekrönt wurde durch den Kommentar des Herrn
Lo: "Else Kasuppke konnte nicht verstehen, wieso man ihr beim "Perfekten Dinner" Punktabzug für die Tischdeko gab." Da ich das selber manchmal - aber ganz selten, also so gut wie nie - schaue, war mir gleich eine Zahl in den Kopf gesprungen, die sich auf einer großen weißen Tafel befand, die ich langsam umzudrehen hatte. Die Tischdeko geht leider gar nicht, für den Spruch aber erhält der Kandidat von mir 10 Punkte!
Glückwunsch, und weiter gehts am Freitag
hier.
Dialoggewitter im Schauspielhaus auf der Hauptbühne, verfrühte Zeichen und schnelle Bewegungen. Schauspieler und Publikum ergehen sich in einem Theaterstakkato von Ibsen, ein Fünfakter so ganz ohne Kurzweil, denn Kurzweil geht anders, nicht so anstrengend.
Während der Umbaupause flachsen die Akteure in der Kantine. Eilig werden Verkabelungen erneuert, Schweiß abgewischt, Zigaretten gedreht, angesteckt, aufgeraucht, gelacht, geprobt, Getränke getrunken, erneut Zigaretten gedreht, angesteckt, aufgeraucht. Alle werden zur Bühne gerufen, der Umbau ist zu Ende. Nur einer sitzt noch, der mit den
Cohibas. Er schaut auf die Uhr und lacht.
„Normalerweise wären wir jetzt erst fertig“
„Wie?“
„Mit dem 3. Akt. Jetzt zu dieser Minute würde erst die Pause beginnen und der Umbau erfolgen.“
„Dann wart ihr entweder schneller oder ihr habt etwas weggelassen?“
„Ja, wir waren schneller als sonst.“
Normalerweise redet er nicht. Ist mir deshalb sehr sympathisch. Weil ich auch nicht viel rede, fällt mir in diesem Gespräch nicht mehr viel ein, was ich noch sagen könnte. Ich schließe damit, wie es Ibsen wohl gefunden hätte, wenn sein Stück plötzlich erheblich schneller vorgetragen würde. Ein Brummeln von rechts und ich denke schon, das war der falsche Kommentar, da spricht er wieder: „Ein Kollege von uns muss einen Zug bekommen. Der fährt 3 Minuten vor dem regulären Ende des Stückes ab.“
Jetzt lachte ich kurz, mit diesem Problem muss sich Ibsen nicht mehr herumschlagen.
 Vielen Dank an
Vielen Dank an den Herrn
Strempfer für die Verleihung des Freitagstexterpokals an mich. Der Pokal steht hier auf meinem Schreibtisch und glänzt in der Sonne.
Heute ist es nun wieder soweit. Ich muss mich mit dem Gedanken vertraut machen, den Pokal wieder abzugeben, und dazu bitte ich alle Pokalübernahmewilligen einen Gedanken, einen Spruch, ein Gedicht oder sonstirgendeine Meldung, die sich in einen Kommentar fassen lässt, hier zu hinterlassen. Am Dienstag gegen 23:59:59 Uhr ist es dann an mir, aus den Einsendungen eine Auswahl zu treffen und den Gewinner zu küren. Ja, so geht das, so ging das und so wird das wieder gehen.

Habe heute im Seminar eine Menge über Wahrnehmungs- und Beurteilungsfehler gelernt. Wir sind in Gruppen eingeteilt worden und sollten an den einzelnen Stationen die Aufgaben lösen. Es wurde viel diskutiert und ernsthaft gearbeitet. Es gibt:
Milde- und Strengefehler
Tendenz zur Mitte/zu Extremen
Reihungsfehler/rhythmische Schwankungen
logischer Fehler/Halo-Effekt
Wissen um die Folgen-Fehler
Kontrastfehler und Ähnlichkeitsfehler/Fehler der gleichen Art
Nähe Fehler
Bei den vielen Fehlerarten, die es gibt und die man als Lehrer machen kann, frage ich mich, ob es überhaupt noch ein Richtig gibt. Unterstützt wurde das Ganze noch durch ein Schlagwort am Ende des Seminars, als es dann nämlich hieß: Wir erreichen sowieso keine Objektivität, nennen wir das Ganze doch gleich „kontrollierte Subjektivität“.
Und weil das alles schon merkwürdig genug war, begegnete mir heute Abend auf dem Weg zur Vorlesung eine ehemalige Arbeitskollegin aus dem Strandleben. Sie ist jetzt seit einem Jahr Lehrerin und hatte heute ihre ersten mündlichen Prüfungen als Prüfer in einer Abschlussklasse. Sie sagte, das sei ganz seltsam gewesen, weil sie ja sonst schon Mittag zu Hause sei. Diesmal jedoch hatte sie am Vormittag frei und erst am Nachmittag gingen die Prüfungen los. Ich sagte noch so etwas wie, ach, dann konntest du wenigstens ausschlafen. Das konnte sie nicht, sie hat vielmehr kein Auge zugetan, weil sie so aufgeregt war.
Bei uns zu Haus sind gerade alle krank, außer mir. Sohn und Tochter sind krank. Den Einen plagt Fieber, die Andere plagt Heiserkeit und meine Frau hat Schwindelanfälle und Bauchschmerzen. Ich hatte für heute einen Arbeitstermin angenommen, kurzfristig und ohne darüber nachzudenken, weil ich das Geld brauchte. Ich war nicht da in der Zeit vom Mittagessen bis zum Abendbrot und saß nach einem Telefonat mit der erhaltenen Nachricht steigenden Fiebers auf heißer Kohle. Ich wollte endlich Feierabend machen und die Zeit klebte wie doppelseitiges Klebeband zwischen zwei Blättern aus Papier: ohne Schaden geht es nicht mehr auseinander.
Nicht einmal nach der Uhrzeit konnte ich schauen und es sofort wieder vergessen, wie es meine Angewohnheit ist, denn mein Akku im Telefon war alle. Wenn so etwas passiert, spüre ich ständig das Vibrieren in der Hosentasche, meinen Phantomschmerz. Ich befühlte den Apparat und fragte meine Kollegin nach der Zeit. Ich vergaß sie nicht, wie sonst, die Zeit blieb einfach stehen und ich wagte kaum erneut zu fragen.
Als ich dann kurz vor Dienstschluss die Toilette betrat, bemerkte ich die laufende Spülung in einer der Kabinen. Ich ging hinein, besah mir den Schaden. Der Hebel für die Arretierung der Wasserleitung bei Erreichen der Höchstmarke war defekt. Das Wasser sprudelte darüber hinweg und gluckerte ungenutzt in den Tank. Ich musste das Wasser abstellen. Um den Spülkasten nicht leer laufen zu lassen und damit folgende Gäste das Klo nicht verstopfen, schloss ich die Tür ab, ich holte mir einen Zettel und beschrieb ihn mit dem Wort „Defekt“.
Ich fand kein Klebeband für den Zettel, ich wusste ja bereits, wo es steckte und suchte nicht weiter danach. Ich nahm ein Pflaster aus dem Verbandskasten und befestigte den Zettel mit Hilfe des Pflasters an der Kabinentür, in der Hoffnung, die Botschaft würde schon verstanden werden. Dann hatte ich endlich Feierabend.
Ich hatte heute gleich mehrere Eingebungen innerhalb so kurzer Zeit, dass ich mein Notizbuch damit schlicht nicht strapazieren konnte. Da war die russische Referentin eines Vortrags, die ich wegen ihres Nachnamens erst einmal fragen musste, ob sie denn überhaupt aus Russland kommt. In dem Vortrag ging es um Mikropolitik und um Sätze mit seltsamen Verbpositionen, was das Verständnis leider arg beeinträchtigte. Der Nachname aber, der als erster und letzter Eintrag in meinem Notizbuch landete, endete mit „-ov“, was mich zu der Frage nach ihrer Herkunft brachte.
Ursprünglich, so dachte ich nämlich, sei es so gewesen, dass Nachnamen, die auf „-ov“ enden, Menschen aus der Ukraine oder aus Weißrussland produzieren, während die Nachnamenendung „-ow“ den Russen vorbehalten sei. Eine seltsame Beobachtung, ich weiß, aber mein System hatte bis dahin meist funktioniert, so dass ich mir ziemlich sicher war nach den vielen Fragerunden, die ähnlich konsternierte Gesichter hervorgerufen hatten wie das von heute – man stelle sich nur vor: in einem gut gefüllten Seminarraum zu sitzen, zu schwitzen und aufgeregt zu sein, weil gleich ein Referat zu einem Thema ansteht, das kritisch beäugt wird von den Seminarteilnehmern und noch kritischer vom Dozenten selbst, und dann kommt da so ein Typ, liest sich das Deckblatt der Powerpointpräsentation durch und fragt nach der eigenen Herkunft, weil der Name natürlich auch auf dem Titelblatt zu finden ist; das bringt einen doch völlig aus dem Konzept.
Sie sagte mir jedenfalls, sie komme aus Russland. Das nötigte mich dazu, eine kleine Notiz in mein Büchlein zu schreiben, woraufhin meine Banknachbarin fragte, ob dies ein Tagebuch sei. Ich verneinte und schrieb weiter an meinem kleinen Absatz zur Namenskunde. Ich überlege mir ja immer, warum, wer worauf zu kommen scheint, und es war ziemlich schnell klar, dass die Datumsanzeige, mit der ich den ersten Absatz eines Tages zu kennzeichnen pflege, die Frage nach dem Tagebuch herausgefordert hatte. Und kurz bevor das Seminar dann beginnen sollte, sagte ich der Referentin deshalb auch, weshalb ich sie so aus dem Konzept bringen musste: nämlich wegen meiner Beobachtung der Nachnamenendungen „-ov“ und „-ow“. Sie hatte dazu leider keine Idee.
Da ich mich bis dahin strikt geweigert hätte, eine andere Lösung als die Meine überhaupt in Betracht zu ziehen, muss ich seitdem immer wieder darüber nachdenken, wer denn die Eindeutschung eines slawischen Nachnamens vornimmt. Es muss ein Beamter des Einwohnermeldeamtes sein. Und da meine bisherige Theorie überhaupt nichts zu taugen scheint, habe ich mich jetzt darauf verstiegen, dass der Unterschied der Nachnamenendung im Osten und Westen der Bundesrepublik wurzelt. Während nämlich ein Ostdeutscher durchaus in den Genuss des Erlernens der russischen Sprache gekommen sein könnte, sich also mit der Eindeutschung russischer Nachnamen auskennen könnte, trifft das für Westdeutsche wahrscheinlich nicht zu. Eine Dienstanweisung wird es dazu wohl kaum geben. So sind also alle Emigranten, die im Ostteil der Republik eingebürgert wurden mit einem „-ow“ belegt, während die im Westen Eingebürgerten mit dem „-ov“ vorlieb nehmen müssen.
Das ist natürlich alles furchtbar einfach und erklärt in keinster Weise, welche Eingebungen ich denn noch zu erwarten hatte, aber darum ging es ja auch gar nicht.
Dass die deutsche Sprache sich vermittels simpelster Mathematik, ja, dass sich die verschiedensten Sprachen durch einfachste logische Zusammenhänge, wie sie die Mathematik bietet, erklären lässt, ist seit Chomsky und Turings längst kein Geheimnis mehr, das sich Linguisten hinter vorgehaltener Hand beim Pausenbrot im Sprachlabor erzählen müssen. Keine Krümel rieselten davon an die Öffentlichkeit, sondern ganze Berge von Monographien, Artikeln in Fachzeitschriften und nicht zuletzt auch Beiträge in populärwissenschaftlichen Magazinen und televisionellen Formaten. Doch lässt sich der interessierte Laie oftmals vom wissenschaftlichen Kauderwelsch täuschen und versinkt in sprachlose Apathie, sobald im ersten Satz der wissenschaftlichen Ausführungen mehrere Fremdworte auftauchen. Diese dem Wissenschaftler gemeinhin als distinktive Maßnahme getarnte, zu Eigen geratene Persönlichkeitsstörung, ist es zu verdanken, dass vieles, selbst die einfachsten Zusammenhänge im Verborgenen bleiben.
Heute möchte ich deshalb auf einen dieser simplen Zusammenhänge aufmerksam machen, sozusagen einen der „Krümel“ unter die Lupe nehmen: 1 + 1= 2. So einfach wie diese Gleichung daher kommt, vermittelt sie doch einen Charme, der es in sich hat. Neben dem Operator, dem Pluszeichen, das auf Addition hindeutet, sehen wir uns in der linken Hälfte der Gleichung mit zwei gleichen Zahlen konfrontiert, den Operanden. Diese verschmelzen, folgt man dem Gleichheitszeichen hinüber auf die rechte Seite, zu einer völlig neuen Zahl, dem dritten Zahlensymbol in dieser Gleichung. Verstörend daran könnte jetzt mein Ausdruck „drittes Zahlensymbol“ gewirkt haben, denn eigentlich sind nur zwei unterschiedliche Symbole in der Gleichung zu finden. Das hat aber durchaus seinen Sinn, denn um die Mathematik auf die Sprache zu übertragen benötigt der versierte Wissenschaftler viel mehr als nur die schlichte Übereinkunft des gerade angewendeten Zahlenkonzeptes.
Stünde nun zum Beispiel statt der Zahl 1 der Ausdruck Präposition und stünde für die Zahl 2 der Ausdruck Adverb, so hieße die eben noch unter 1 + 1 = 2 firmierende Gleichung: Präposition + Präposition = Adverb. Welchen Grad von Abstraktheit der Wissenschaftler beim Betrachten dieser Gleichung anwendet, ist ihm selbst überlassen, doch wie sich selbst für den Laien erschließen muss, 1 und 1 muss nicht dasselbe sein. So könnte zum Beispiel, um der Gleichung wieder die Praxisnähe angedeihen zu lassen, die unsereiner für notwendig erachtet, statt dem sperrigen Begriff „Präposition“ zu verwenden, einfach eine solche in die Gleichung eingefügt werden ( Welcher nicht halbwegs Gebildete kann mit der Zuordnung von Worten zu der Kategorie Präposition nichts anfangen? Doch wer von diesen kann auch etwas von der Etymologie, dem Geheimnis der Genese etwas beisteuern: nur der Spezialist, der Wissenschaftler, das macht er natürlich auch, aber leider nicht in allseits verständlicher Sprache ).
Nehmen wir die Präposition „vor“. Sie ist deshalb sehr gut geeignet, weil sie in sich bereits zwei unterschiedliche Fälle von Anwendung vereint, die erheblichen Einfluss auf das Satzgefüge haben können. Zum Einen ist sie als lokale, also den Ort spezifizierende Präposition bekannt, und zum Anderen gebietet sie auch über den temporalen, also den zeitlichen Ablauf bestimmenden Aspekt des Satzgefüges. Sie sehen, meine Damen und Herren: 1 und 1 ist nicht immer dasselbe. Ein ähnlicher Zusammenhang, der Sie nun hoffentlich gänzlich überzeugen wird, ist der Umstand, dass wir uns als gemeinsamen Grad der Abstraktion zwei verschiedene Präposition vorzustellen haben, die, obwohl in sich fast völlig verschieden, die Position des zweiten Operators 1 einnehmen soll: die Präposition „bei“. „Bei“ verhält sich ähnlich unentschieden in seiner Anwendung wie die Präposition „vor“, denn sowohl „beim Essen“ als auch „bei der Oma“ sind sinnvolle Ausdrücke, die sowohl den lokalen, als auch den temporalen Bedeutungsinhalt einer Phrase auszudrücken vermögen. Dass „bei“ allerdings immer den dritten Fall, den Dativ, fordert, unterscheidet sie in ihrer Vielseitigkeit vom „vor“. Würde man der Gleichung 1 + 1 = 2 stur folgen, ergäbe sich jetzt folgendes Phänomen: vor + bei = vorbei.
Das bestätigt natürlich nur den zuvor bereits untermauerten Zusammenhang, dass Präposition + Präposition = Adverb ist und wäre ehrlich gesagt viel zu simpel für den Wissenschaftler. Es verrät darüber hinaus auch noch etwas, das ich hier nur in Ansätzen schildern möchte, weil ich meine mathematischen Kenntnisse leider nicht in so tiefe Gewässer schicken möchte. Aber ansatzweise möchte ich dem geneigten Leser hier anzudeuten versuchen, weshalb der Wissenschaftler sich nicht nur in seinen schriftlichen oder mündlichen Ausführungen vom „normal“ Gebildeten unterscheidet, sondern darüber hinaus auch zu erstaunlichen Schlüssen kommen kann, die dann in Fachzeitschriften, Monographien, Sie wissen was ich meine….: Nehmen wir einmal an, bei der Gleichung 1 + 1 = 2 handelte es sich statt um ganze Zahlen um Brüche, also: 1/1 + 1/1 = 2/1. Der Mathematiker als auch der „Normalgebildete“ neigen dazu diesen Wust an Überfluss einfach wegzukürzen. Nicht so der Linguist. Der betrachtet die Komponenten erst einmal nach ihren Eigenschaften, bevor er sich dem Kürzen widmet und anders als beim Mathematiker, wo Gleiches gern gegen Gleiches aufgewogen wird, sprich gekürzt wird, sind es beim Linguisten, die Unterschiede, die nicht zu zählen haben.
Daraus ergibt sich dann in unserem Versuchsaufbau folgendes Szenario: „vor“ verlangt sowohl den dritten als auch den vierten Fall, kann sowohl temporal als auch lokal verwendet werden. „Bei“ verlangt lediglich den dritten Fall, kann ebenfalls lokal und temporal verwendet werden. Daraus ergibt sich, nach Kürzung aller Unterschiede, dass nach erfolgter Addition von beiderseitig befähigten, also lokal und temporal begabten Präpositionen ein Adverb entstehen muss, dass ausschließlich temporale Bezüge zuzulassen scheint. Dem Linguisten, der natürlich nur den allerletzten Satz, mit möglichst vielen Fremdwörtern belegt, in den Äther der medialen Verwertung schickt, obliegt es nun auf honorigem Posten, diese These zu beweisen. Das versteht niemand. Deshalb sieht sich nicht nur der Linguist, sondern insbesondere der Wissenschaftler im Allgemeinen stets und ständig der Elfenbeinturmargumentation ausgesetzt und er fühlt sich als unverstandener Experte aufs schmählichste in seiner Persönlichkeit verletzt.
Ich hoffe, meine bescheidenen Erklärungsversuche haben neben der allseitigen Erheiterung auch für ein wenig Erhellung gesorgt, meine Ausführungen sind damit am Ende. Vorbei.