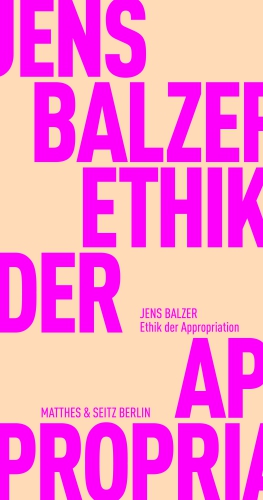Feuilleton/Literaturredaktion: Frau Martina Sulner
Teil 6
Dieses Mal habe ich mir wirklich ungebührlich lange Zeit gelassen, um meine Beschreibung der Vorlesung „Angewandte Literaturwissenschaft“ abzuliefern. Es war Vorlesungsunterbrechung und ich war im Urlaub, deshalb dauerte es diesmal etwas länger. Zu Gast war Frau Martina Sulner von der HAZ. Thematisch „überschattet“ war die Veranstaltung von dem Titel „Feuilleton / Literaturredaktion“.
Ich habe mich während der Vorlesung schon einige Male davon überzeugen lassen können, dass es sich bei den Gastdozenten nicht ausschließlich um „Elfenbeinturmbewohner“ handelt. So wurde ich auch hier wieder angenehm überrascht von einer Dame, die ganz und gar nicht den Eindruck vermittelte, abseits des realen Lebens und in abgehobener Position vor sich hin zu arbeiten; die sich mit klarer, lauter Stimme gegen geöffnete Fenster und damit verbundenem Straßenlärm durchsetzte. Das Plenum war beschaulich brav und leise, aber auch in besonderem Maße interessiert. Frühe Fragen verzerrten den Dialogcharakter der Vorlesung, ein Pluspunkt. Inhaltlich kam nicht viel Neues auf den Tisch. Das übliche Bla Bla beim Lebenslauf. Was ich schon länger nicht mehr gehört hatte, war der ominöse Anruf eines potentiellen Arbeitgebers, der da einfach mal so wissen wollte, „ob sie (Frau Sulner) nicht diesen oder jenen Job machen wolle“, in ihrem Fall den Pauschalistenjob bei der HAZ. Mentoren seien wichtig, Praktika nicht zu vergessen usw. Was gäbe es also noch Interessantes zu berichten, fragte ich mich.

Diese Todesanzeige geht zurück auf die Äußerung Martina Sulners, in 15 Jahren werde es immer noch Zeitungen geben. Recht hat sie, nur wie sieht diese Zeitung der Zukunft aus? Die HAZ hat kein Feuilleton, genauso wenig wie jede andere Zeitung im „Madsack-Imperium“. Todesanzeigen und sinkende Auflagen haben sie aber alle. Die Todesanzeigen finden sich übrigens recht häufig in dem Teil der Zeitung, der sich Feuilleton nennt. Ist das Zufall? Ist es Zufall, dass das Feuilleton laut Prof. Košenina immer die Seiten der Zeitung sind, die in Fitnessstudios, Bibliotheken, Friseursalons usw. als erstes vergriffen sind und wie hängt das mit den Todesanzeigen zusammen? Prof. Eva Martha Eckkramer von der Universität Mannheim äußert sich dazu ungewöhnlich vage für eine Wissenschaftlerin: „Anscheinend gehört der Todesanzeigenteil zu einem der meistgelesenen Teile einer Tageszeitung, der einen sehr hohen Grad an Aufmerksamkeit genießt.“¹ Arg rüde äußert sich dieser Blogger: „Hier in meiner unmittelbaren Umgebung interessiert es den geneigten Tagesblatt-Leser weit mehr, wer in den Todesanzeigen steht und wie die Heimmannschaft der 8.Liga am vorherigen Samstagnachmittag gespielt hat, obwohl man selbst dem Spiel seine bierflaschenbewehrte Aufwartung gemacht hatte. Wenn da im Feuilleton über eine Seite hinweg nur "Zicke-zacke-Hühnerkacke" zu lesen ist, merkt dass doch keine Sau.“ Es könnte also lange und ausgiebig darüber diskutiert werden, ob die Todesanzeigen deshalb im Feuilleton stehen, weil sie so beliebt sind, oder ob das Feuilleton deshalb immer vergriffen ist, weil die Todesanzeigen darin abgedruckt sind – die altbekannte Huhn-und-Ei-Frage, wobei ich noch nicht herausgefunden habe, wer die Todesanzeigen ins Feuilleton getan hat. Es könnte auch danach gefragt werden, ob sich hinter dem Feuilleton-Leser ein Aufschneider versteckt, der, seit es den Kindle gibt, leider nicht mehr als sogenannter „Bildungsbürger“ enttarnt werden kann, weil er nicht mehr in der Straßenbahn eine leicht zerlesene Ausgabe der „Dialektik der Aufklärung“ liest, sondern in einen kleinen schwarzen Kasten guckt, der auch die neueste Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs anzeigen könnte. Solche Fragen will ich hier aber gar nicht stellen.
Was macht eine Zeitung zukunftsfähig? Frau Sulner sagte, dass es eine Gratwanderung sei, den „etablierten“ Abonnenten (Altersgruppe 60+) nicht zu verschrecken und andererseits den „jungen Leser“ zu gewinnen. Hier wird natürlich nicht nach Antworten gesucht, sondern lediglich die Schwierigkeit des Unterfangens herausgestellt. Frau Sulner äußerte sich – nicht ohne Bedauern – zu den letzten Marktanalysen der Madsack-Gruppe, die allesamt leider schon viel zu alt sind, um noch repräsentativ zu sein. Hoffentlich sind sie nicht schon so alt, wie die Abonnenten, wobei dies allerdings erklären würde, was bei der NP gerade passiert. Wie es nicht geht, beweist nämlich seit längerem die Neue Presse, indem sie sich bei den Schlagzeilen dem Niveau der Bildzeitung nähert. Auf Rückfrage meinerseits bei einem dort tätigen Redakteur sagte dieser, dass das ein heikles Thema sei und kontrovers diskutiert wurde, letztendlich aber der Abgrenzung (Schärfung?) des eigenen Profils dienen sollte. Aha! Mein Schuss ins Blaue dazu sähe ungefähr folgendermaßen aus: man betrachte einmal die Statistiken der Seite meedia.de² und veranschauliche sich die Grafiken der HAZ/NP und der Bild nebeneinander. Da fällt auf, dass sich die Käuferschicht der Bild nicht aus Abonnenten, sondern eher aus Direkteinkäufern zusammensetzt und die der NP und HAZ größtenteils aus Abonnenten. Die Zahl der Abonnenten zu erhöhen ist wie gesagt eine „Gratwanderung“, also bleiben nur die Direktkäufer. Das heißt, derjenige, der seine Zeitung althergebracht am Kiosk oder beim Bäcker einkauft, soll statt zur Bild jetzt zur NP greifen Das macht man mit einer reißerischen Schlagzeile und funktioniert wohl ähnlich wie bei dem Impulskauf an der Supermarktkasse, wenn man dort steht, wartet und plötzlich zu den Tic Tac greift. Ähnliches dachte sich wohl die NP und versucht nun mit reißerischen Schlagzeilen und A4-formatigen Werbeaufstellern, den Käufer beim Kiosk oder Bäcker auf die NP einzuschwören. Dadurch dass auch die Bild sinkende Auflagen hat und sich die NP trotzdem dazu durchrang, diese Strategie zu fahren, hätte das Ganze durchaus etwas altruistisches – denn wer liest schon gerne die Bild. Hätte, weil es scheinbar nur funktioniert, wenn das Niveau bei der NP selbst auch sinkt. Nicht die Zeitung ist hier die Ware, sondern der Leser.
Der hier zu Tage tretende Solipsismus zeigt sich auch an anderer Stelle. Wenn zum Beispiel Di Lorenzo und Schirrmacher von Katrin Göhring-Eckardt interviewt werden und sich im Kommentarstrang unter dem Interview nicht nur gelöschte Einträge (Meinungsfreiheit?!?), sondern vor allem unbeantwortete Kommentare wiederfinden (auf den Inhalt des Interviews einzugehen, obwohl streckenweise durchaus lesenswert, würde hier zu weit führen). Ich teile nicht die Meinung, dass „schöne Worte“ den Nimbus des „Einkanalmediums Zeitung“ hinwegredigieren können. Uneingelöst bleibt somit das „Dialogangebot“ (davon sprach auch Frau Martina Sulner). Da unterhält und streitet man sich lieber über die Zeitungsgrenzen hinaus aber bitte schön im erlesenen Kreis. Die heutige Avantgarde – und damit meine ich nicht den Literaturwissenschaftler oder die, die es noch werden wollen – liest ja sowieso mehrere Zeitungstitel, sie kann dem Gequassel problemlos folgen und folgt den Quasslern natürlich überall hin; sie geht dafür ins Fitnessstudio, zum Friseur oder in die Bibliothek, denn an steigenden Abonnentenzahlen kann man die Avantgarde leider nicht ausmachen. Wenn sich die Zeitungsmacher also weiterhin vor einem „echten“ Dialog verschließen, den Leser dazu verdammen, trotz bekundetem Interesse (Abonnement) immer ein wenig außen vor zu bleiben, ist das Feuilleton nichts weiter ein Statusemblem und die Zeitung nichts weiter als gutes Papier, um die guten schwarzen Schnürschuhe zum Glänzen zu bringen.
¹Eva Martha-Eckkramer, Sabine Divis-Kastberger, Die Todesanzeige als Spiegel kultureller Konventionen, Mannheim 2009?, S.19.
²Hier können sich fast alle Zeitungstitel der Madsack-Gruppe und so ziemlich alle großen Zeitungstitel angeschaut werden, ein Blick, der sich lohnt.
Teil 8
Dieses Mal habe ich mir wirklich ungebührlich lange Zeit gelassen, um meine Beschreibung der Vorlesung „Angewandte Literaturwissenschaft“ abzuliefern. Es war Vorlesungsunterbrechung und ich war im Urlaub, deshalb dauerte es diesmal etwas länger. Zu Gast war Frau Martina Sulner von der HAZ. Thematisch „überschattet“ war die Veranstaltung von dem Titel „Feuilleton / Literaturredaktion“.
Ich habe mich während der Vorlesung schon einige Male davon überzeugen lassen können, dass es sich bei den Gastdozenten nicht ausschließlich um „Elfenbeinturmbewohner“ handelt. So wurde ich auch hier wieder angenehm überrascht von einer Dame, die ganz und gar nicht den Eindruck vermittelte, abseits des realen Lebens und in abgehobener Position vor sich hin zu arbeiten; die sich mit klarer, lauter Stimme gegen geöffnete Fenster und damit verbundenem Straßenlärm durchsetzte. Das Plenum war beschaulich brav und leise, aber auch in besonderem Maße interessiert. Frühe Fragen verzerrten den Dialogcharakter der Vorlesung, ein Pluspunkt. Inhaltlich kam nicht viel Neues auf den Tisch. Das übliche Bla Bla beim Lebenslauf. Was ich schon länger nicht mehr gehört hatte, war der ominöse Anruf eines potentiellen Arbeitgebers, der da einfach mal so wissen wollte, „ob sie (Frau Sulner) nicht diesen oder jenen Job machen wolle“, in ihrem Fall den Pauschalistenjob bei der HAZ. Mentoren seien wichtig, Praktika nicht zu vergessen usw. Was gäbe es also noch Interessantes zu berichten, fragte ich mich.
Diese Todesanzeige geht zurück auf die Äußerung Martina Sulners, in 15 Jahren werde es immer noch Zeitungen geben. Recht hat sie, nur wie sieht diese Zeitung der Zukunft aus? Die HAZ hat kein Feuilleton, genauso wenig wie jede andere Zeitung im „Madsack-Imperium“. Todesanzeigen und sinkende Auflagen haben sie aber alle. Die Todesanzeigen finden sich übrigens recht häufig in dem Teil der Zeitung, der sich Feuilleton nennt. Ist das Zufall? Ist es Zufall, dass das Feuilleton laut Prof. Košenina immer die Seiten der Zeitung sind, die in Fitnessstudios, Bibliotheken, Friseursalons usw. als erstes vergriffen sind und wie hängt das mit den Todesanzeigen zusammen? Prof. Eva Martha Eckkramer von der Universität Mannheim äußert sich dazu ungewöhnlich vage für eine Wissenschaftlerin: „Anscheinend gehört der Todesanzeigenteil zu einem der meistgelesenen Teile einer Tageszeitung, der einen sehr hohen Grad an Aufmerksamkeit genießt.“¹ Arg rüde äußert sich dieser Blogger: „Hier in meiner unmittelbaren Umgebung interessiert es den geneigten Tagesblatt-Leser weit mehr, wer in den Todesanzeigen steht und wie die Heimmannschaft der 8.Liga am vorherigen Samstagnachmittag gespielt hat, obwohl man selbst dem Spiel seine bierflaschenbewehrte Aufwartung gemacht hatte. Wenn da im Feuilleton über eine Seite hinweg nur "Zicke-zacke-Hühnerkacke" zu lesen ist, merkt dass doch keine Sau.“ Es könnte also lange und ausgiebig darüber diskutiert werden, ob die Todesanzeigen deshalb im Feuilleton stehen, weil sie so beliebt sind, oder ob das Feuilleton deshalb immer vergriffen ist, weil die Todesanzeigen darin abgedruckt sind – die altbekannte Huhn-und-Ei-Frage, wobei ich noch nicht herausgefunden habe, wer die Todesanzeigen ins Feuilleton getan hat. Es könnte auch danach gefragt werden, ob sich hinter dem Feuilleton-Leser ein Aufschneider versteckt, der, seit es den Kindle gibt, leider nicht mehr als sogenannter „Bildungsbürger“ enttarnt werden kann, weil er nicht mehr in der Straßenbahn eine leicht zerlesene Ausgabe der „Dialektik der Aufklärung“ liest, sondern in einen kleinen schwarzen Kasten guckt, der auch die neueste Ausgabe des Lustigen Taschenbuchs anzeigen könnte. Solche Fragen will ich hier aber gar nicht stellen.
Was macht eine Zeitung zukunftsfähig? Frau Sulner sagte, dass es eine Gratwanderung sei, den „etablierten“ Abonnenten (Altersgruppe 60+) nicht zu verschrecken und andererseits den „jungen Leser“ zu gewinnen. Hier wird natürlich nicht nach Antworten gesucht, sondern lediglich die Schwierigkeit des Unterfangens herausgestellt. Frau Sulner äußerte sich – nicht ohne Bedauern – zu den letzten Marktanalysen der Madsack-Gruppe, die allesamt leider schon viel zu alt sind, um noch repräsentativ zu sein. Hoffentlich sind sie nicht schon so alt, wie die Abonnenten, wobei dies allerdings erklären würde, was bei der NP gerade passiert. Wie es nicht geht, beweist nämlich seit längerem die Neue Presse, indem sie sich bei den Schlagzeilen dem Niveau der Bildzeitung nähert. Auf Rückfrage meinerseits bei einem dort tätigen Redakteur sagte dieser, dass das ein heikles Thema sei und kontrovers diskutiert wurde, letztendlich aber der Abgrenzung (Schärfung?) des eigenen Profils dienen sollte. Aha! Mein Schuss ins Blaue dazu sähe ungefähr folgendermaßen aus: man betrachte einmal die Statistiken der Seite meedia.de² und veranschauliche sich die Grafiken der HAZ/NP und der Bild nebeneinander. Da fällt auf, dass sich die Käuferschicht der Bild nicht aus Abonnenten, sondern eher aus Direkteinkäufern zusammensetzt und die der NP und HAZ größtenteils aus Abonnenten. Die Zahl der Abonnenten zu erhöhen ist wie gesagt eine „Gratwanderung“, also bleiben nur die Direktkäufer. Das heißt, derjenige, der seine Zeitung althergebracht am Kiosk oder beim Bäcker einkauft, soll statt zur Bild jetzt zur NP greifen Das macht man mit einer reißerischen Schlagzeile und funktioniert wohl ähnlich wie bei dem Impulskauf an der Supermarktkasse, wenn man dort steht, wartet und plötzlich zu den Tic Tac greift. Ähnliches dachte sich wohl die NP und versucht nun mit reißerischen Schlagzeilen und A4-formatigen Werbeaufstellern, den Käufer beim Kiosk oder Bäcker auf die NP einzuschwören. Dadurch dass auch die Bild sinkende Auflagen hat und sich die NP trotzdem dazu durchrang, diese Strategie zu fahren, hätte das Ganze durchaus etwas altruistisches – denn wer liest schon gerne die Bild. Hätte, weil es scheinbar nur funktioniert, wenn das Niveau bei der NP selbst auch sinkt. Nicht die Zeitung ist hier die Ware, sondern der Leser.
Der hier zu Tage tretende Solipsismus zeigt sich auch an anderer Stelle. Wenn zum Beispiel Di Lorenzo und Schirrmacher von Katrin Göhring-Eckardt interviewt werden und sich im Kommentarstrang unter dem Interview nicht nur gelöschte Einträge (Meinungsfreiheit?!?), sondern vor allem unbeantwortete Kommentare wiederfinden (auf den Inhalt des Interviews einzugehen, obwohl streckenweise durchaus lesenswert, würde hier zu weit führen). Ich teile nicht die Meinung, dass „schöne Worte“ den Nimbus des „Einkanalmediums Zeitung“ hinwegredigieren können. Uneingelöst bleibt somit das „Dialogangebot“ (davon sprach auch Frau Martina Sulner). Da unterhält und streitet man sich lieber über die Zeitungsgrenzen hinaus aber bitte schön im erlesenen Kreis. Die heutige Avantgarde – und damit meine ich nicht den Literaturwissenschaftler oder die, die es noch werden wollen – liest ja sowieso mehrere Zeitungstitel, sie kann dem Gequassel problemlos folgen und folgt den Quasslern natürlich überall hin; sie geht dafür ins Fitnessstudio, zum Friseur oder in die Bibliothek, denn an steigenden Abonnentenzahlen kann man die Avantgarde leider nicht ausmachen. Wenn sich die Zeitungsmacher also weiterhin vor einem „echten“ Dialog verschließen, den Leser dazu verdammen, trotz bekundetem Interesse (Abonnement) immer ein wenig außen vor zu bleiben, ist das Feuilleton nichts weiter ein Statusemblem und die Zeitung nichts weiter als gutes Papier, um die guten schwarzen Schnürschuhe zum Glänzen zu bringen.
¹Eva Martha-Eckkramer, Sabine Divis-Kastberger, Die Todesanzeige als Spiegel kultureller Konventionen, Mannheim 2009?, S.19.
²Hier können sich fast alle Zeitungstitel der Madsack-Gruppe und so ziemlich alle großen Zeitungstitel angeschaut werden, ein Blick, der sich lohnt.
Teil 8
Shhhhh - 4. Jun, 07:04