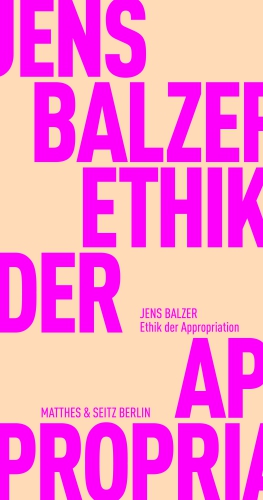Walther Kiaulehn: Lesebuch für Lächler
Vor geraumer Zeit erwarb ich bei meinem Antiquariat des Vertrauens ein kleines, schmuckes Rowohltbändchen von Walther Kiaulehn, das „Lesebuch für Lächler“. Seitdem begleitet mich dieses Buch überallhin, denn immer wenn ich nur wenig Zeit zum Lesen habe, lohnt sich kein Blick in schwere Lektüre, dann muss es etwas Leichtes sein. Das Gute an diesem Buch ist auch, dass es aufgrund der kurzen bis kürzesten Texte, die in fast keinem Zusammenhang zueinander stehen, völlig egal ist, wo man mit dem Lesen beginnt.
Es gibt trotzdem zwei Zusammenhänge innerhalb der Texte in diesem Buch, die dem eben gesagten aber nicht widersprechen. Zum einen ist es die Form. Es sind allesamt kleine Texte, die im Feuilleton der „BZ“, der Berliner Zeitung, zwischen 1923 und 1929 erschienen sind. Der andere Zusammenhang besteht darin, dass den Texten bestimmte Mottos übergestülpt worden sind, es demnach eine leise Orientierung innerhalb eines breit gefächerten Themenfeldes gibt. Da finden sich Texte zum Reisen, zu den Jahreszeiten, von der Liebe u.a.
Das stört aber nicht im geringsten, wenn mir danach ist, das Buch aufzuschlagen und einfach drauflos zu lesen. Die Texte sind elegant, eloquent, witzig, traurig, überraschend und meistens viel zu schnell zu Ende. Sollten Sie diesem Büchlein über den Weg laufen, kaufen Sie es! Es wird billiger sein als eine Ausgabe der SZ, deren Streiflicht auf der Titelseite manchmal ebenso gut daherkommt, wie die hier ausgewählten Texte.
Und da es sich ja um ein rororo handelt, darf natürlich die obligatorische Werbung im Buch nicht fehlen:
Autor: Walther Kiaulehn
Titel: Lesebuch für Lächler
beworbenes Produkt: Peter Stuyvesant Zigaretten
Fundstelle: zwischen S. 42 und S. 43
„DAS IST DAS SCHÖNE BEIM LESEN: MAN KANN DABEI RAUCHEN!“

Bildquelle: Walther Kiaulehn: Lesebuch für Lächler, Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH, Hamburg 1960.
Es gibt trotzdem zwei Zusammenhänge innerhalb der Texte in diesem Buch, die dem eben gesagten aber nicht widersprechen. Zum einen ist es die Form. Es sind allesamt kleine Texte, die im Feuilleton der „BZ“, der Berliner Zeitung, zwischen 1923 und 1929 erschienen sind. Der andere Zusammenhang besteht darin, dass den Texten bestimmte Mottos übergestülpt worden sind, es demnach eine leise Orientierung innerhalb eines breit gefächerten Themenfeldes gibt. Da finden sich Texte zum Reisen, zu den Jahreszeiten, von der Liebe u.a.
Das stört aber nicht im geringsten, wenn mir danach ist, das Buch aufzuschlagen und einfach drauflos zu lesen. Die Texte sind elegant, eloquent, witzig, traurig, überraschend und meistens viel zu schnell zu Ende. Sollten Sie diesem Büchlein über den Weg laufen, kaufen Sie es! Es wird billiger sein als eine Ausgabe der SZ, deren Streiflicht auf der Titelseite manchmal ebenso gut daherkommt, wie die hier ausgewählten Texte.
Und da es sich ja um ein rororo handelt, darf natürlich die obligatorische Werbung im Buch nicht fehlen:
Autor: Walther Kiaulehn
Titel: Lesebuch für Lächler
beworbenes Produkt: Peter Stuyvesant Zigaretten
Fundstelle: zwischen S. 42 und S. 43
„DAS IST DAS SCHÖNE BEIM LESEN: MAN KANN DABEI RAUCHEN!“

Bildquelle: Walther Kiaulehn: Lesebuch für Lächler, Rowohlt Taschenbuchverlag GmbH, Hamburg 1960.
Shhhhh - 8. Nov, 12:33