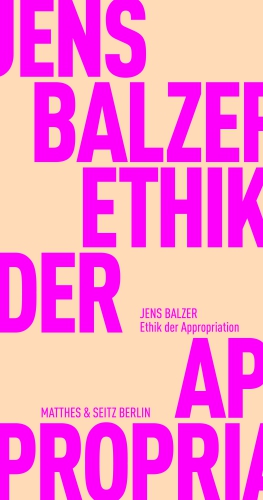Intelligenztests
Im Rahmen eines Seminars, das gestern seinen Abschluss fand, haben wir uns intensiv mit dem Konstrukt der Intelligenz beschäftigt und sind in der abschließenden Diskussion zu dem Ergebnis gekommen, dass nicht unbedingt viel darauf zu geben ist, mindestens jedoch gesunde Skepsis an den Tag gelegt werden sollte, wenn von der Intelligenz oder dem Intelligenzquotienten die Rede ist. Im Laufe des Seminars haben wir unterschiedliche Modelle der Intelligenzberechnung durchgenommen, einen Faktor g, also eine allgemeine Intelligenz, hatten viele dieser Modelle gemeinsam und auch die Unterscheidung in fluide, also Problemlösefähigkeit und logisches Denken, und kristalline Intelligenz, explizites Wissen, war vielen Modellen eigen.
Eine Frage, die allerdings nicht beantwortet werden konnte, hat mich während des Seminars immer wieder beschäftigt. Wie verhält sich die Akzeptanz des Wertes der eigenen Intelligenz zum gemessenen Ergebnis? Meine Hypothese dazu lautet, dass sie sich ebenso verhält wie das Aufkommen des IQ selbst, nämlich entlang einer Gaußkurve. Das heißt genauer, dass die Akzeptanz zum Ergebnis im Intelligenztest nach gemessenem IQ in der Spanne von 85 bis 115, also von einer Standardabweichung zu beiden Seiten der 100, am höchsten ist und je nach Höhe des gemessenen Wertes zu beiden Seiten hin abfällt. Konkreter würde das für die Intelligenzmessung bedeuten, dass insbesondere sehr niedrig ausfallende und sehr hoch ausgefallene Messergebnisse von den jeweiligen Probanden weniger akzeptiert werden, als Werte im Normalbereich.
Doch was bedeutet das? Auf dem Gebiet der differentiellen Psychologie stellt die Intelligenzforschung einen nicht kleinen Forschungszweig dar, der unter Umständen erheblich in das Leben Vieler eingreifen kann. Sei es nun der Einstellungstest bei einem Arbeitgeber oder die Vorschuluntersuchung oder ein Schullaufbahntest. All diese Ergebnisse können dazu führen, dass Lebenswege vorgezeichnet werden, die von den Betroffenen unterschiedlich aufgenommen werden können. Im Allgemeinen verlässt sich aber vor allem der Tester auf das Ergebnis und gibt dernach Empfehlungen für Job oder Schullaufbahn. Gekniffen sind die Getesteten, wenn das Ergebnis nicht das gewünschte, bzw. eher erhoffte Resultat liefert.
Zwei Extrembeispiele sollen das einmal näher erläutern: Vor nicht allzu langer Zeit geisterte der Fall des Marvin Wilson durch die Presse und führte nicht zuletzt wegen des bei ihm gemessenen IQs zu einem Aufschrei der Empörung. Wilson hatte einen IQ von 61, was in den USA als geistig behindert gilt. Somit ist die Schuldfähigkeit eingeschränkt. Trotzdem wurde Wilson hingerichtet, weil er in anderen Messungen einen IQ von 71 bzw. 75 erreichte. Wie gekniffen der Getestete in diesem Fall war, muss nicht näher erläutert werden.
In einem anderen Fall – auch dieser findet im Netz Verbreitung – geht es um eine New Yorker Stripperin, die angeblich einen sehr hohen IQ haben soll. Ich konnte das nicht genauer nachprüfen, ob es sich bei dieser Messung eher um eine Ente oder um ein tatsächlich stattgefundenes Ereignis handelte, muss es aber gar nicht, denn zwei Dinge werden dabei klar: sollte es sich um eine Ente handeln, scheint zumindest der Wunsch nach einer „Normalisierung“ erkennbar zu sein, also die Akzeptanz des Messergebnisses nimmt auch bei hohen IQs ab. Oder, sollte es tatsächlich wahr sein, bestätigt es meine Hypothese zumindest insofern, als dass ein hohes Ergebnis nicht automatisch zu den bestmöglichen Lebensentwürfen führt.
In beiden Fällen, wie auch in vielen anderen sind es jeweils nur die Tester, bzw. die Beobachter, die etwas davon zu haben scheinen, den Getesteten geht es entweder nichts an oder es ist ihnen egal. Die anfänglich beschriebene „gesunde Skepsis“ reicht bei weitem nicht aus, wäre mein Ergebnis dieser Überlegungen. Offenes Misstrauen jeglicher Art dieser Tests, den Entwicklern und Anwendern gegenüber wäre wohl eher angebracht.
Eine Frage, die allerdings nicht beantwortet werden konnte, hat mich während des Seminars immer wieder beschäftigt. Wie verhält sich die Akzeptanz des Wertes der eigenen Intelligenz zum gemessenen Ergebnis? Meine Hypothese dazu lautet, dass sie sich ebenso verhält wie das Aufkommen des IQ selbst, nämlich entlang einer Gaußkurve. Das heißt genauer, dass die Akzeptanz zum Ergebnis im Intelligenztest nach gemessenem IQ in der Spanne von 85 bis 115, also von einer Standardabweichung zu beiden Seiten der 100, am höchsten ist und je nach Höhe des gemessenen Wertes zu beiden Seiten hin abfällt. Konkreter würde das für die Intelligenzmessung bedeuten, dass insbesondere sehr niedrig ausfallende und sehr hoch ausgefallene Messergebnisse von den jeweiligen Probanden weniger akzeptiert werden, als Werte im Normalbereich.
Doch was bedeutet das? Auf dem Gebiet der differentiellen Psychologie stellt die Intelligenzforschung einen nicht kleinen Forschungszweig dar, der unter Umständen erheblich in das Leben Vieler eingreifen kann. Sei es nun der Einstellungstest bei einem Arbeitgeber oder die Vorschuluntersuchung oder ein Schullaufbahntest. All diese Ergebnisse können dazu führen, dass Lebenswege vorgezeichnet werden, die von den Betroffenen unterschiedlich aufgenommen werden können. Im Allgemeinen verlässt sich aber vor allem der Tester auf das Ergebnis und gibt dernach Empfehlungen für Job oder Schullaufbahn. Gekniffen sind die Getesteten, wenn das Ergebnis nicht das gewünschte, bzw. eher erhoffte Resultat liefert.
Zwei Extrembeispiele sollen das einmal näher erläutern: Vor nicht allzu langer Zeit geisterte der Fall des Marvin Wilson durch die Presse und führte nicht zuletzt wegen des bei ihm gemessenen IQs zu einem Aufschrei der Empörung. Wilson hatte einen IQ von 61, was in den USA als geistig behindert gilt. Somit ist die Schuldfähigkeit eingeschränkt. Trotzdem wurde Wilson hingerichtet, weil er in anderen Messungen einen IQ von 71 bzw. 75 erreichte. Wie gekniffen der Getestete in diesem Fall war, muss nicht näher erläutert werden.
In einem anderen Fall – auch dieser findet im Netz Verbreitung – geht es um eine New Yorker Stripperin, die angeblich einen sehr hohen IQ haben soll. Ich konnte das nicht genauer nachprüfen, ob es sich bei dieser Messung eher um eine Ente oder um ein tatsächlich stattgefundenes Ereignis handelte, muss es aber gar nicht, denn zwei Dinge werden dabei klar: sollte es sich um eine Ente handeln, scheint zumindest der Wunsch nach einer „Normalisierung“ erkennbar zu sein, also die Akzeptanz des Messergebnisses nimmt auch bei hohen IQs ab. Oder, sollte es tatsächlich wahr sein, bestätigt es meine Hypothese zumindest insofern, als dass ein hohes Ergebnis nicht automatisch zu den bestmöglichen Lebensentwürfen führt.
In beiden Fällen, wie auch in vielen anderen sind es jeweils nur die Tester, bzw. die Beobachter, die etwas davon zu haben scheinen, den Getesteten geht es entweder nichts an oder es ist ihnen egal. Die anfänglich beschriebene „gesunde Skepsis“ reicht bei weitem nicht aus, wäre mein Ergebnis dieser Überlegungen. Offenes Misstrauen jeglicher Art dieser Tests, den Entwicklern und Anwendern gegenüber wäre wohl eher angebracht.
Shhhhh - 13. Jul, 21:48