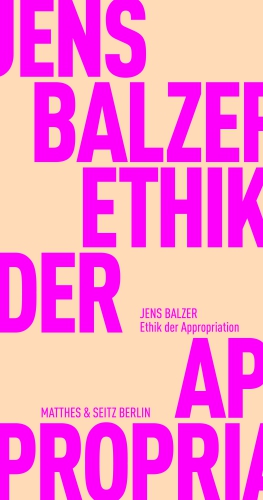Als ich heute Morgen meinen Sohn zur Kita gebracht hatte und mich danach darauf verstieg, zum Supermarkt zu laufen wegen eines Stücks Butter, da war von der Hitze noch nicht viel zu spüren. Ich dachte jedenfalls, dass ich davon nicht allzu viel spürte, weil ich zuvor ja meinen Sohn auf den Schultern getragen hatte. Die daraus resultierende Anstrengung und der leichte Schweißfilm also waren nichts, worüber ich mich beunruhigen müsste.
Auf dem Rückweg jedoch, als mir nach Verlassen des Supermarktes, der übrigens ordentlich heruntergekühlt worden war, die Hitze wie eine Ohrfeige um das Gesicht schlug, da wusste ich, es ist Zeit, aus der Sonne zu gehen. Ich schlug einen Weg durch den Schatten ein. Alte und große Bäume stehen hier entlang des Schnellwegs, der direkt neben meinem Pfad eine Auffahrt hat. Dort wird das Blätterrascheln noch vom Motorenlärm übertönt, wenn denn der Wind durch die Blätter rauschen würde.
Ein Stück weiter den Pfad entlang, der Schnellweg biegt nach links ab - oder ist es mein Weg, der nach rechts abbiegt? - wird es leiser. Fast flüsterleise. Bis auf den Vogel, der mir schon weiter oben aufgefallen war und mich von Baumwipfel zu Baumwipfel zu begleiten scheint. Ich kann den Gesang nicht zuordnen. Bleibe ich stehen und sehe mich nach ihm um, dann kann ich ihn nicht entdecken, dann ist es still. Fröhlich zwitschert er wieder, sobald ich mich in Bewegung setze.
Als ich das Ende des Wegs erreiche und wieder auf die Straße komme, zwitschert der Vogel immer noch. Aber weder auf einem Garagendach noch auf einem Fenstersims ist etwas zu sehen. Ich werde noch verrückt, denke ich, trinke einen Schluck aus dem Wegwasser, schaue nach unten auf meine Füße, die in Flip Flops stecken und vor sich hin schwitzen. Dann wird mir alles klar. Ich gehe ein Stück, ohne meine Füße aus den Augen zu lassen und siehe da, von dort kommt das Zwitschern: nasse Haut auf Gummi.
Die Vorlesung vom Montag war wieder sondergleichen. Da fragt der Professor das Publikum doch tatsächlich nach einem Sendeformat auf RTL oder Pro 7, ich weiß es nicht mehr. "The biggest Loser", kann das sein? Und wenig später fragt er schon wieder nach einem anderen. Da ich ganz vorne sitze, hätte ich ihm darauf gern geantwortet, dass ich kein Reality-Doku-Dreck schaue,
dafür lieber die Welt lese. Nur ist mir das leider nicht eingefallen in dem Moment. Dass ihm beim Thema Leistungsbeurteilung überhaupt solche seltsamen Dinge einfallen. Das muss am Mond gelegen haben, oder an der Uhrzeit, oder der Hitze, was weiß ich:
„…Ich muss das Kind nachts wecken können… und dann 8 mal 7! Das muss kommen… und nicht nach 4 Tagen lernen…“
„…Das Schiff ist hundert Meter lang und vierzig Meter breit. Wie alt ist der Kapitän? …und dann fangen die an zu rechnen…“
„…Versetzungen sind wie Siedler von Catan Spielen. 3 Holz sind 1 Schaf... Da ist die Fünf und dort hat er 2 Dreien… das ist alles hoch mysteriös…“
„…Kind kommt nach Hause. ,Na Chantal, was haste geschrieben?‘ ,Ne 4, aber das Beste war eine 3,5.‘
„…Sagen wir, Sie haben ein Date. Sie gehen essen und merken: er schmatzt. Wenn das für Sie ein NoGo ist, ist das gegessen. Haben Sie aber schon 8 Dates vorher absolviert – Sie waren im Zoo oder so – und stellen dann erst fest, dass er schmatzt, ist das vielleicht nicht so schlimm… …um mal ein harmloses Beispiel zu nennen…“
Hinsichtlich des pathetischen Weltrettungsszenarios am Sonntagabend auf Pro 7 könnte man meinen, dass der größte Bildschirm den Fernseher im Kopf nicht ersetzen kann. Es lief nämlich zur besten Sendezeit und in Konkurrenz zum „Tatort“ auf der ARD „Transformers 3“. Die tollen Bilder des einen Films sind natürlich auf einem kleinen Fernseher nicht zu genießen, viel zu schnell kommt man dahinter, welchem Irrtum man aufsaß. Beim Tatort verhält es sich eher anders herum, hier kann ein umso kleineres Bild den Genuss steigern.
Wer die Wahl hat, hat deshalb auch die Qual, zumindest darauf konnten wir uns anschließend bei Tische einigen, der, wie so oft, natürlich in der Mensa stand und uns Gestalten vor dem Hungertod bewahrte. Beim Essen ging das übrigens genauso, denn es gab Köttbullar. Auch das vegetarische Gericht, eine Art Quiche, haute so manchen von uns von den Socken, und der Eintopf, eine riesengroße Schüssel gefüllt mit Milchreis, Kirschen, Zucker und Zimt, brachte die Entscheidungsfindung bei so einigen ebenfalls ins Wanken. Ich entschied mich für Köttbullar und Milchreis, obwohl das zwei vollwertige Mahlzeiten darstellen sollte. Allerdings war ich mir sicher, dass die Löffel auf den Tabletts der Anderen auch ihre Verwendung finden würden, sollte ich nach Verschlingen der Fleischbällchen, Kroketten und Spargel für einen kurzen Moment Schwäche zeigen, wenn ich mich nach den Köttbullar dem Milchreis zuwende.
An einem anderen Tag, so schien es auf den ersten Blick, war die Auswahl nicht so verlockend in der Breite, dafür in der Tiefe. Da standen nämlich, zuerst allein, später in Gesellschaft eines einzelnen Herren, 5 Suppen auf einem Tablett und dampften bis sie kalt wurden. Da wir unweit davon Platz genommen hatten, wurde neben dem Fotos anfertigen mit dem Handy und dem allgemeinen Gerede auch beschlossen, dass derjenige, der zu dem Herrn hingeht und fragt, was es damit auf sich hat, einen Kaffee spendiert bekommt. Das war ich. Weil der Mann die übrige Woche keine Zeit mehr hatte, die Mensa zu besuchen, hat er sich, in seinem Beutel hinterlegt, ein Gefäß mitgenommen, um die erkaltete Suppe später umzufüllen und diese an den verbleibenden Tagen der Woche zu Haus zu verspeisen.
Nun kann man sich darüber streiten, ob es gehaltvoll war, den Rest der Woche nur Suppe zu essen oder am heutigen Tage nicht doch die Quiche statt der Köttbullar probiert zu haben. Über eine falsche Entscheidung musste ich mich jedenfalls nicht ärgern: am Sonntagabend durfte ich am Strand arbeiten und konnte somit weder in den Genuss von „Tatort“ noch „Transformers 3“ kommen. Glück gehabt.
Es folgen vier unterschiedliche Beschreibungen ein und desselben Tisches, die sich durch ihre jeweiligen Blickwinkel und Verfasser voneinander unterscheiden. Jede der gemachten Aussagen ist wahr. Die Textentstehung war folgendermaßen reglementiert: Schreibe mit maximal 200 Wörtern innerhalb von maximal 3 Sätzen auf, was dir zu diesem Tisch einfällt. Der Tisch stand vor uns, wir saßen in lockerer Runde um ihn herum und hatten jeder ein Blatt Papier und einen Stift erhalten.
Shhhhh: 3 Sätze, 48 Wörter
Auf dem Tisch stehen mein volles Bier, mein leeres Bier und weitere Biere. Der Tisch ist viereckig, verfügt über vier Beine und zwei Ablageflächen, die übereinander angeordnet sind. Die Höhe des Tisches lässt eine Benutzung als Esstisch nur bedingt zu, er dient eher der Ablage innerhalb eines Sitzgruppenensembles.
Trithemius:
3 Sätze, 43 Wörter
Die Tischfläche ist quadratisch, darauf stehen 9 leere, bzw. halbleere Bierflaschen. Wie tief der Tisch gegründet ist mit seinen vier brettartigen Stumpen, weiß ich nicht. Eventuell durchstoßen sie das Laminat, die untere Wohnung wie senkrechte Säulen und ragen tief in die Erde hinein.
Herr Putzig: 3 Sätze, 60 Wörter
Der Tisch ist schon sehr alt, er stand schon in meiner Langzeit-WG in der Lenaustraße. Er gehörte meiner ersten und zweiten Mitbewohnerin Peggy und stand jahrelang im Wohnzimmer. An den Ecken ist der ganze Schmutz der letzten Jahre, den ich sehr eklig finde und manchmal versuche abzuwischen, was mir jedoch nicht immer gelingt – der Schmutz ist schon sehr alt.
Filipe d'Accord:
3 Sätze, 38 Wörter
Herr Putzig hat einen eckigen Wohnzimmertisch aus Holz mit einer Hauptebene und einer Unterebene. In der Unterebene liegen Süßigkeiten fürs Kiffen und anderer Kram. Auf der Ebene oben stehen mehrere Bierflaschen, leere und volle, Aschenbecher und weitere Kleinteile.
Nun da wir uns den Tisch bildlich vorstellen können, wäre es mir sehr recht, wenn wir gemeinsam ein paar Informationen zusammentragen. Diese Informationen sollen anhand von Fragen ermittelt und sogleich beantwortet werden. Ich gebe dazu ein Beispiel:
Wer ist der Gastgeber? Herr Putzig, weil er in Text 4 als Besitzer genannt wird und in Text 3 selbst von diesem Tisch spricht, als wäre es sein eigener.
So abwegig die Information auch ist, scheuen Sie sich nicht, mithilfe der Texte eine Wirklichkeit darum zu konstruieren. Sie kann der wirklichen Wirklichkeit kaum widersprechen, denn es ist Ihre eigene, ganz so wie die Beschreibungen den jeweiligen Autoren gehört. Nur einen Beweis sollten Sie erbringen und er sollte natürlich in den Texten zu finden sein.
edit: Natürlich kann der gesamte Text für die Spekulationen genutzt werden. Ich tat dies im Beispiel ja ebenfalls, indem ich voraussetzte, dass der Tisch, um den wir saßen, bei jemandem zu Hause steht und wir dessen Gäste sind.
Das Abenteuer ist in seiner Etymologie eines der gut erforschten Wörter, wie es scheint. Wir lassen das etymologische Wörterbuch deshalb außen vor. Lautmalerisch steckt da nämlich viel mehr drin, als die Etymologie uns sagen kann, und es ist dann längst nicht so weit hergeholt, wie wir glauben zu wissen, oder gerade doch, das klären wir gleich.
Wie bereits gesagt besteht das Abenteuer auf der Ebene der Lautmalerei aus dem „Abend“ und aus „teuer“. Anders als heute und auch anders als bei anderen Konsonanten neigt das Deutsche ja zur Verdopplung der Konsonanten, die heutzutage sogar noch reglementiert ist – man denke einmal an die drei „f“ in Schifffahrt – aber das war ja nicht immer so. Wen mag es da verwundern, dass wir ein „d“ vom „Abend“ im Abenteuer zugunsten des sowieso ausgesprochenen „t“ von „teuer“ unterschlagen.
Wir neigen ja außerdem zur Auslautverhärtung, was ein „d“ am Ende eines Wortes sowieso zu einem ausgesprochenen „t“ macht – man denke nur einmal kurz an Worte wie Tand oder Schwund. Und zufällig folgt dem eigentlichen „d“ auch noch ein „t“, weil wir neben all dieser Neigungen einer dritten Angewohnheit frönen: wir komponieren, das heißt wir setzen Wörter zusammen. So ein „d“ kann da leicht verloren gehen.
Aber wir neigen auch zu anderen Spielereien, die sich jenseits der Grammatik mit dem Wort auseinandersetzen. Unserem Naturell folgend, stellen wir fest, dass uns selbst die Semantik nicht heilig ist. Wie oft neigen wir zur Beschönigung, zur Übertreibung, kurz: zum Bedeutungswandel. Was uns gestern noch peinlich war, ist uns morgen schon zur Heldentat geraten. Was sagt uns also das verschwundene „d“ aus dem Abenteuer wirklich? Es sagt uns, dass wir hinter aller Beschönigung und Übertreibung einen teuren Abend hatten. Oder anders gesagt: es war dunkel und wir ließen Federn.
Denken Sie einmal darüber nach! Denken Sie einmal darüber nach, was Ihr letztes Abenteuer eigentlich gewesen ist! Da ist doch bestimmt einiges weit hergeholt und wir stehen mit unserer Schilderung weit besser da, als mit der Wirklichkeit: ein echtes Abendteuer eben.
Dieser Text gehört zu der bekannten Reihe um den geschäftigen Laborchef Dr. Klenk.
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Nicht nur die eine Theorie zu Grau hatte der gute Goethe, sondern mindestens zwei sind weithin bekannt. Das Grau steht hier für die Tristesse eines theorieüberladenen Magisterlebens auf der einen Seite und auf der anderen hatte Goethe seine ganz eigene Theorie zur Farbenlehre, dem Grau kommt dabei noch eine besondere Rolle zu, wie wir gleich feststellen werden.
Der zweiten Tristesse, also dem Grau nicht im, sondern auf dem Kopf, wurde vor kurzem der Kampf angesagt. Einerseits, so sagt es uns Doktor Klenk, sei es ein neuer Megatrend, zu seinem grauen Haupthaar zu stehen, und andererseits hätte er ein probates Mittel entdeckt, das Grau auch auf seine Farbechtheit hin erstrahlen zu lassen. Doktor Klenk bemächtigte sich nämlich der Theorie Goethes und hat sie für uns alle praxistauglich gemacht. „Mit Blick auf die steigenden Verkaufszahlen“ zeigt sich der Herr Doktor deshalb sehr selbstbewusst und zuversichtlich. Doch Moment! Worum geht es hier überhaupt?
Fangen wir besser am Anfang an: „Und grün des Lebens goldner Baum.“, endet das berühmte Bonmot Goethes und nichts anderes hat der Doktor Klenk getan. Er hat sich zum einen der etwas seltsamen Farbmetapher bedient; die als Kulturartikel getarnte Werbebotschaft in der Zeitung mit der gewagten thesenartigen Überschrift „Goethe hätte PowerGrau genommen“ beginnt nämlich mit einem ähnlich gut ausgeklügelten Teaser: „Der bekannte Laborchef Dr. A. Klenk über sein Shampoo, das graue Männer vom Gilb befreit.“ Und zum zweiten kann hier die Farbenlehre Goethes nachvollzogen werden, denn: grün ist des Lebens goldner Baum!
Das Grau des Hauptes ist vom Gilb beschmutzt. Dr. Klenk kämpfte jahrelang um die Emanzipation des Grau, weil er mittlerweile selbst ergraut ist über seine Tätigkeit im Labor, und Alpecin stellt ja leider keine Haarfärbemittel her. Wie hat er das gemacht? Er hat seinem Shampoo „lila Farbpigmente“ beigemengt, die den Gilb abdecken und das Grau in seinem vollen Glanz erstrahlen lassen. Um dies zu verdeutlichen hat er seiner Werbebotschaft diesmal keine Wachstumskurve beigefügt, sondern 5 Haarsträhnen unterschiedlicher Couleur, die im Verlaufe von keiner Haarbehandlung über 5, 10, 30 bis insgesamt 60 Haarwäschen immer grauer werden. So oder so ähnlich findet sich das Ganze schon bei Goethe, der ja ein großer Kenner allen Grauens, äh Graues war.
Mit diesem einmaligen Produkt können Sie sich, werte Leser, in einen echten Silberrücken verwandeln! Niemand wird Sie mehr auf Ihren Zigarettenkonsum, auf Ihre manisch anmutenden Höhensonnensitzungen oder schlicht auf Ihren straßenköterblonden Schopf ansprechen. Einzige Schwäche der Argumentation ist die Dauer der Behandlung, die nicht weiter spezifiziert wurde auf einen bestimmten Zeitraum. Es stellt sich nämlich die Frage, ob Sie die Haarwäsche mit einem Mal auf 60 Anwendungen bringen müssen und ob Sie nach den 60 erfolgten Haarwäschen damit aufhören müssen. Ich für meinen Teil vermute ja, dass sich hinter diesem Zurückhalten wichtiger Informationen ein weiteres Kalkül versteckt: Sollten Sie die Haarwäschen auf einmal ausführen, könnte es sein, dass Sie 1. sehr viel Shampoo benötigen und 2. nach erfolgter Behandlung eventuell auch noch das Mittel gegen Haarausfall kaufen, weil sich ihr Schädel in ein Feuchtbiotop verwandelt hat. Oder sollten Sie die Haarwäschen in den üblichen Haarwaschprozeduren über einen normalen Zeitraum absolvieren, von sagen wir 60 Tagen, und sich deshalb das Ergebnis nicht einstellen, kaufen Sie noch mehr von diesem Mittel. Alles in allem eine Win-Win-Situation.
Gratulieren wir also dem Laborchef Dr. Klenk für seine ausgeklügeltes Produkt (und hier noch die
beispielhafte Werbeanzeige aus der Presse)!
Mit einem Berg von Fishermens Friend bewaffnet, startete ich meinen Weg nach Großbritannien. Wie das genau vonstatten ging, kann ich nicht mehr sagen, nur dass wir plötzlich da waren und prompt, wer hätte das nicht schon geahnt, von der Polizei überprüft wurden. Natürlich waren in meinen Hustenpastillenpackungen neben den übliche Hustenpastillen auch ein paar wichtige Medikamente drin, die an unserem Reiseort so unverschämt teuer sein sollten, dass wir uns diese einfach von zu Hause mitnahmen. Natürlich wurden wir entdeckt. Das Pärchen vor mir versuchte noch sich herauszureden, aber sie hatten keine Chance, sie wurden sofort verknackt.
Als ich als nächstes an die Reihe kam, probierte ich gar nicht erst zu leugnen, ich holte die Übeltäter aus der Tasche, schüttelte sie aus, gestand mein Vergehen in radebrechendem Englisch und wurde verstanden. Der Polizist, der jetzt Richter war, verdonnerte mich zu einer Strafe von 23 Schilling, die ich sofort zu bezahlen hätte. Am Kassenschalter zählte die Dame meine Euros ab, der Umrechnungskurs war fast 1:1, ich wurde 27 Euro los. Dann kam plötzlich dieser Polizist wieder, der plötzlich Richter war und jetzt wieder Polizist, und versuchte mich in ein Gespräch zu verwickeln, auf Deutsch. Ich aber war gewarnt und verließ England auf dem schnellsten Wege, ich wachte auf.
Eine besonders merkwürdige Facette des Todes ist sein Gestank, mal abgesehen vom Toten selbst, der vielleicht ganz andere Probleme hatte. Der Tod macht etwas mit den Lebenden, es findet plötzlich eine Verdrängung der Umstände statt, die sich nicht nur sich selbst gegenüber beschwichtigend äußern kann: Gestank durch Tod ist dann nämlich selten Tod, da stinkt zum Beispiel lieber etwas anderes. In unserem Fall war es Güllegeruch von frisch gedüngten Feldern, weil das Fenster offen war. Ich wusste es besser und sagte dazu nichts. Ich schaltete stattdessen die Klimaanlage im Auto aus und öffnete meinerseits ebenfalls das Fenster. Wir fuhren nach Haus.
Später, ich befand mich vor dem Haus, wo die Person wohnte, deren Auto wir uns geliehen hatten, erinnerte ich mich des Gestanks. Ich ging zum längst geparkten, abgeschlossenen Auto zurück, öffnete die Motorhaube und steckte meine Nase in Angelegenheiten. Schnell war der Geruchsherd ausgemacht. Es war ein kleiner Vogel, der, tot, in einer Ecke lag und stank. Stinken ist ein starkes Verb: stinken, stank, gestunken. Das ist auch ein ziemlich starkes Indiz dafür, wie uns die Nase umtreibt. Jedenfalls, der Vogel stank erbärmlich. Er lag eingekeilt neben dem Eingang der Lüftung. Ich entfernte ihn mit einem Stock und ging nach getaner Arbeit zurück zur Haustür, wo ich den Schlüssel in den Briefkasten werfen sollte.
Als ich da so stand, sah ich mich um nach jemandem, der womöglich einen Schlüssel für die Haustür besitzen könnte. Es ist mir immer sehr unangenehm irgendwo klingeln zu müssen, um in einen Hausflur zu kommen, denn die Person, in deren Briefkasten der Autoschlüssel gehörte war nicht da; der Briefkasten aber war im Hausflur an der Wand befestigt. Ich öffnete mein mitgebrachtes Bier, was ich mir für den Fußweg heimwärts mitgebracht hatte, da sprach es plötzlich hinter mir: „Alkohol tötet.“ Er maß nur einen Meter, war aber ganz Empörung. Leben tötet, dachte ich. In seinem Haus, diesem Haus, sei ein Mann gestorben letzte Woche, weil er zu viel Bier getrunken hatte. Werd‘ du erst mal so alt wie ich, dachte ich, dann reden wir noch mal. Ich ignorierte ihn weitestgehend, war aber froh, dass er die Tür aufschloss und mich den Autoschlüssel in den Briefkasten versenken ließ. Nur wenige Tage später erfuhr ich dann die Geschichte des toten Mannes in diesem Haus. 3 Wochen lang merkte niemand etwas, bis auf den Gestank. Der Gestank führte dann auch zum Auffinden der Leiche. Wenn ich mal tot bin, möchte ich auch ordentlich stinken.