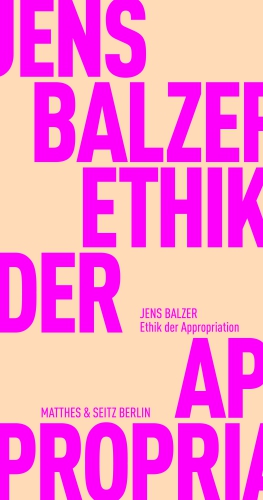Das Buch wird digital. Einer
Anregung folgend habe ich mich endlich dazu durchgerungen, meine Literatur zu ordnen und Mitgenommenes in einer Datei zu speichern. Es ist bisher erst ein Titel aber die Arbeit damit ist zum Einen sehr einfach und zum Anderen sehr hilfreich, wenn ich später darauf zurückkommen will. Luhmanns Zettelkasten habe ich mir dabei noch nicht zu Gemüte geführt und mich auch entgegen der empfohlenen Software für Citavi entschieden. Das hat den Vorteil, dass es auf Deutsch ist und den Nachteil, dass man es bei vollständiger Nutzung bezahlen muss, da pro Katalog nur 100 Titel zur Verfügung stehen. Den Nachteil habe ich bisher noch erreicht. Ich werde zu gegebener Zeit mehr davon berichten.
Bahnhöfe sind ein Aushängeschild für jede Stadt gewesen. Im 19. Jahrhundert musste jeder Ort, der etwas auf sich hielt, mit einem solchen ausgestattet sein und heute ist das ziemlich lästig, wenn man aus finanziellen Gründen mit den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn unterwegs ist und an Orten wie Övelgünne oder Schandelah hält. Aber nichts für ungut, das ist ein selbstgewähltes Leid und außerdem eine andere Geschichte. Durch Zufall bekam ich ein paar schöne Bilder vom Hundertwasserbahnhof in Uelzen und einen Artikel dazu zu
lesen. Ich kenne den Bahnhof ziemlich genau, denn ich bin auf meinen Reisen des öfteren an diesem "Prachtstück" umgestiegen; einmal sogar war dies meine Zielstation und es blieb genügend Zeit, sich dem ganzen Ausmaß der Architektur zu widmen.
Doch zuvor noch ein kleiner Schritt zurück. Bahnhöfe sind ein Aushängeschild für jede Stadt gewesen. Die Größe einer Stadt und ihr Auftreten gegenüber den verweilenden Gästen ist in nicht wenigen Fällen von monumentaler Bedrängung geprägt. Die schiere Größe der Bahnhofshallen schüchtert ein. Umso größer oder bedeutender ein Bahnhof ist oder zu sein wünscht, desto größer und monumentaler ist sein Auftreten. Wer einmal in der Halle der Grand Central Station in New York stand, wird das nachvollziehen können.
In deutschen Städten sind die Bahnhofshallen kleiner, dennoch sind sie für Publikumsverkehr konzipiert, der vermuten lässt, hier hielten Personenzüge mit Güterzuglänge auf allen Bahnsteigen - gleichzeitig. In Uelzen nicht. Uelzen ist ein kleiner verschlafener Ort, der eher durch EHEC von der Gurkenpresse bedacht wird als dass sich irgendjemand für den Bahnhof interessieren könnte, obwohl dieser von Hundertwasser konzipiert wurde.
Ähnlich geht es wohl dem Bahnhof in Lehrte, der zu seinen Hochzeiten einmal zum Drehkreuz Norddeutschlands ausgebaut werden sollte und nicht im Bahnhofsgebäude sondern im Schienennetz seinen monumentalen Charakter offenbart. Schienen soweit das Auge blicken kann. Nicht umsonst heißt in Gedenken an den Lehrter Bahnhof ein Berliner Bahnhof Lehrter Bahnhof, alles klar? Zurück nach Uelzen. Uelzen ist aufgrund seiner Beschaffenheit, ich erwähnte einen Teil des üblichen Procederes in meinem Artikel
davor, ein wichtiger Knotenpunkt auf der Strecke von Hannover nach Hamburg. Zu fragen wäre hier nach den Gründen dafür. Ist der Bahnhof vorher dagewesen ( also der Hundertwasserbahnhof ) und dann entschieden worden, dass Nahverkehrszugreisende an diesem Bahnhof umsteigen müssen oder war das schon immer so und man dachte sich, hier baue ich doch mal was zum Gucken hin, einen Hingucker?
Keine Frage, ein Hingucker ist der Bahnhof. Überall sind Schiefen und Krummen. Die Fliesen sind von feinstem Mosaik unter Berücksichtigung keinerlei Ordnung angebracht worden. Selbst die Kanten der Fliesen stoßen unsauber aufeinander. Die Unart, mit schlurfendem Gang über den Boden zu schleichen, kann hier zu ernsthaften Verletzungen führen. Im Regelfall steigt man in Uelzen von einem Metronom in den anderen, um sein Ziel zu erreichen ( der Metronom fährt von Göttingen nach Hamburg ). Man steigt nicht nur um, sondern man wechselt auch den Bahnsteig. Dafür ist man gezwungen, den wahrscheinlich schon vorher viel zu engen Gang unter den Schienen hindurch zu nutzen. Nur dass zu früheren Zeiten nicht einmal halb so viele Menschen in Uelzen umgestiegen sind. Heute ist der Gang dafür eine schiefe Ebene mit etlichen Fallstricken und Hinguckern -
Heinrich Hoffmann sei gegrüßt. Rollstuhlfahrer, Kinderwagenschieber oder auch nur profane Rollibesitzer werden des öfteren darüber geflucht haben, dass ihr jeweiliges Gefährt nicht die Spur hält. Aber dafür hat man ja was zu gucken. Denkste, zum Gucken hat man nämlich kaum Zeit. Die Spanne von 19 Minuten Umsteigezeit verfliegt in Bälde, wenn man auf vollen Bahnsteigen einen entfernten Bahnsteig erreichen muss. Es bricht Hektik aus. Fahrradfahrer - bzw. Fahrradmitnehmer passt wohl besser, denn sie fahren ja nicht, sondern transportieren es nur mit der Bahn - haben das größte Problem von allen, in den hinterletzten Waggons ausgestiegen müssen sie zu den hinterletzten Waggons, um weiterzukommen. Wer schonmal einen Fahrradlenker in den Nieren hatte, kennt die Probleme. Verständnis bleibt dann häufig auf der Strecke. Auch die Bahnsteigbezeichnung ist nicht mehr profan genug, um sich dem Verständnis des Reisenden aufzudrängen. Von Hannover nach Hamburg kommend, steigt man in Uelzen an Gleis 301 aus und an 103 wieder ein. Wenn ich einmal die Zeit finde, lache ich über diesen Witz.
Ich frage mich nach dieser ganzen Litanei, was wollte Hundertwasser damit bezwecken? Das ist sicher nicht alles auf seinem Mist gewachsen, da kommen ganz andere widrige Umstände dazu, wie zum Beispiel die Privatisierung der Deutschen Bahn und das Veräußern einer lukrativen Bahnstrecke an anderen Bahnanbieter, um ihnen die wenig geliebten Strecken gleich mit aufs Auge drücken zu können. Da kommt Geltungssucht von Bürgermeistern dazu, die sich in solchen "Prestigeobjekten" verewigt sehen wollen und dann gibt es auch Bahnreisende, die das Gesehene tatsächlich schön finden und sich darüber freuen, dass ein völlig zweckferne Architektur am Arsch der Welt ihr Dasein fristet. Diese letzte Kategorie hat eine Stunde und 19 Minuten Aufenthalt in Uelzen, die haben bereits vor Reiseantritt eingeplant, eine Stunde länger dort zu verweilen. Das sind die Leute, die mit der Gemütlichkeit eines Traktors durch die engen Gänge schlurfen, unvermittelt stehen bleiben und mit Armen in Richtungen zeigen, wo man selbst gerade entlang gehen wollte.
Ich wünsche mir Bewegungsfreiheit, schlichten Pragmatismus, wenn ich schon zum Umsteigen gezwungen werde. Ich kann mich sicherlich an dem schönen Bahnhof ergötzen aber nicht jedesmal aus Neue, irgendwann ist der Lack ab und dann möchte ich einfach nur noch ankommen und den Bahnhöfen dieser Welt entkommen.
Wir erkennen plötzlich die kleinen und großen Zusammenhänge. Mit jedem neuen Satz entschleiert sich das Sichtfeld."Häufig sind scheinbar unabhängige Ereignisse durch ein kausales Band verknüpft; täuschen lässt man sich durch die Gleichzeitigkeit, die einen Zufall suggeriert." Wir dröseln die Gedankenwelt Varamos auf, holen die Fäden hervor und stricken eine Kausalkette, die von Gleichmäßigkeitsrennen über Anarchisten bis hin zu falschen Geldscheinen führt. Wo diese Kette anfängt, ist gar nicht mehr so richtig klar dabei, denn nicht mit dem Erscheinen der beiden falschen Scheine, ist ihre Existenz erklärt. Völlig unbegründet, denn die Seiten fliegen nur so dahin, meinen wir plötzlich, es ginge nicht vorwärts im Buch und doch stehen wir nicht, der Zug stand vielleicht. Ein verspäteter ICE war auf der Überholspur. Ich saß diesmal nicht im Fahrradabteil, dort war kein Platz mehr. Ich saß in einem der Gänge auf der Zwischenetage, dort wo man sitzt, wenn man weder unten noch oben sitzen will - oder kann, weil alles voll ist - dort, wo sich der Übergang von einem Wagen in den nächsten befindet.
Die Frage, was zuerst da war, stellt sich uns immer wieder. Auch die Umkehrung dieses Effekts passiert ständig. Varamo geht an einem Haus vorbei, dessen Gast er später wird. Die Bewohner schmuggeln Golfschläger und senden undefinierbare Laute über den Äther, die Varamo immer hören kann, wenn er dort vorüber geht, was er immer tut, um pünktlich seinen Kaffee zu trinken. Es stellt sich heraus, dass die Signale nur Varamos Pünktlichkeit wegen immer um diese Zeit abgesendet werden, wäre er nicht so pünktlich hätte er sie vielleicht nur wenige Male mitbekommen. Seine dadurch eingebildete Geisteskrankheit steht also im kausalen Zusammenhang mit seiner Pünktlichkeit - Zuverlässigkeit, Pflichtgefühl? Ohne es gewollt zu haben, richten sich andere nach ihm - dem unscheinbaren Staatsdiener - vielleicht wäre er besser Anarchist geworden.
Hamburg. Der Zug hielt in Hamburg-Harburg und mir wurde klar, dass ich mit dem Ende des Buches auch mein erstes Ziel erreichen werde, Hamburg Hauptbahnhof. Von dort aus geht es weiter zum Berliner Tor. Ich bin immer noch meine Insel, alles um mich herum ist fremd. Immer wieder denke ich an das Gedicht, das im Buch nicht zu finden war. Ich stelle mir vor, wie es wohl klingen mag.
Ich steige in die S-Bahn und bin nach wenigen Minuten dort, wo mich in einer halben Stunde ein Auto abholen wird, um mich an mein letztes Ziel des Tages zu bringen, Wismar. Das Buch ist in meinem Rucksack - und in meinem Kopf; gleichzeitig.
Nach hinten raus, in Richtung Bürgerweide führt mich mein Weg. Ich komme aus dem Bahnhof heraus, wende mich nach rechts und laufe unter der Unterführung durch. Zu meiner rechten rückt ein kleiner grüner Platz in mein Blickfeld, umsäumt von breiten und stark befahrenen Straßen. Dort fressen sich mehrere kleinere und zwei große Hasen am Gras satt. Ich muss schon wieder an die Insel denken und plötzlich erkenne ich: Der Roman ist das Gedicht.
"Obacht vor der Prokrastination, die der Literatur soviel Schaden zugefügt hat." Das geben die Verleger Varamo mit auf den Weg, und wenn ich bedenke, welche beiden mächtigen Bücher da noch auf mich warten, dann beschleicht mich das Gefühl, genau dieser zu unterliegen. Meine Rechtfertigung, auf Zugreisen mit leichtem Gepäck zu verreisen, klingt dann wie eine billige Ausrede. Aber tatsächlich, so war es. Ich wollte lediglich Platz in meinem Rucksack haben und nicht so schwer tragen müssen, also kam mir das dünne bunte Büchlein in die Tasche.
Die Welt war Colón; Colón war der Platz. Wie in vielen lateinamerikanischen Städten scheinen die Regierungsviertel um große Plätze herum angelegt worden zu sein. In der Mitte sprießt ein kleiner Park, der trotz all der Hektik um ihn herum - schließlich wird der Verkehr ja im Kreis um den Park an den Regierungsgebäuden vorbei geleitet - ein Ort der Entspannung sein kann; eine Insel im Meer der Autohupen, Händler, Passanten und nicht zuletzt sogar Vögel, die alle etwas zu sagen haben. Meine Insel war ein Platz in der zweiten Klasse des Metronoms nach Hamburg, im Fahrradabteil habe ich zwischen Kinderwagen, Fahrrädern, Kindern, Müttern, Fahrradfahrern mein Lager aufgeschlagen. Im Klappentext ist von einem Gedicht die Rede, ich blätterte im Buch auf der Suche danach, fand nichts als ganze Seiten ohne Absätze. Erinnerungen an "Das Parfüm" wurden wach und meine positive Grundstimmung wollte kippen. Die Schienen halten jedoch alles fest, kein Schlenker, kein Gegenwind ist stark genug, um mich jetzt nicht in das Buch vertiefen zu können - zu müssen, das Chaos stieg proportional zum sinkenden Platzangebot; mit jedem Bahnhof zog ich mich enger zusammen, um den Menschen Platz zu machen.
Es sind die kleinen Augenblicke, denen dieses Buch gewidmet zu sein scheint. Immer wieder rekuriert das gerade Gelesene auf etwas Vorangegangenes und immer wieder deuten die Details in die Zukunft. Es ist beinah so, als läse man das Buch von allen Seiten gleichzeitig. Das bekam ich nicht mit, zumindest nicht gleich. Natürlich hatte ich wie immer einen Marker und einen Kugelschreiber dabei und markierte damit fleißig beim Lesen. Auf S. 29 erst wurde mir plötzlich klar, wie das Buch funktioniert. Ich sollte des hohen Tons wegen auf S. 9 zurückblättern, tat dies, las noch einmal und blätterte wieder vor. Befriedigt und irgendwie unpassend schaute ich in die Runde.
Varamo läuft über den anfangs beschriebenen Platz und wir laufen mit. Wir können den Krach förmlich riechen - und das Rascheln der beiden falschen Hundertpesoscheine in seiner Tasche. Natürlich umtreiben ihn Sorgen, trotz der gehorteten Konserven, alles wird plötzlich klar und bekommt einen Sinn; warum das Kleingeld doch im Gegensatz zu den großen Scheinen einen so großen Wert hat, in seinem Fall hat es sogar einen doppelten Sinn, denn das Geld zu wechseln traut er sich nicht. Ich wechselte jetzt meinen Platz. Ich wechselte auf der Hälfte der Strecke den Zug, denn es ist zwar widersinnig in Uelzen von einem aus Göttingen kommenden Metronom in einen anderen Metronom einzusteigen, der aus Hamburg kommt, um beide Metronome dann wieder zu ihren Ursprungsbahnhöfen zurückfahren zu sehen, aber ob man das will oder nicht, danach wird nicht gefragt, das wird eben so gemacht. Nein, so war es nicht ganz, nur einer fuhr zurück, der andere wurde gegen einen leeren Metronom ausgetauscht, der sich unweit des Bahnhofs in den eigens dafür gebauten Lagerhäusern befand und mit dem jetzt ebenfalls leeren Metronom seinen Platz tauschte...
Dass das soviel Arbeit machen kann, hätte ich nie gedacht. Meine Interviewpartnerin ist meine ehemalige Deutsch-, Geschichte- und Sozialkundelehrerin. Ich habe sie ausgewählt, weil sie für das Referat, wo ich dran beteiligt bin, eine gute Gesprächspartnerin bildet - nicht nur wegen ihres etwas verqueren Lebenslauf, sondern auch wegen ihrer Unterrichtsfächer. Geschichtslehrer in der ehemaligen DDR gewesen zu sein und das auch darüber hinaus, ist nicht vielen gelungen. Die Gründe dafür ergeben sich schon fast gänzlich aus der ersten Frage, die ich ihr stellte.
Wie sah Ihr eigener Werdegang in der DDR aus? Beginnen Sie mit der Schulausbildung bis zum Abitur und dem anschließenden Hochschulstudium. Gab es dabei bestimmte Hürden zu nehmen und wenn ja, wie sahen diese aus?
Also ich komme aus einem christlichen Elternhaus, bin in einem Arbeiterviertel von Magdeburg geboren. In diesem Arbeiterviertel lebten natürlich auch viele Arbeiter, die sich nach dem Krieg dem neuen System, das ja proletarierfreundlich war, auch angepasst haben, so dass solche Kinder wie ich durchaus als exotisch galten und sich in der Schule auch zurückhalten mussten. Und das tat man dann instinktiv und dann hatte man seine Ruhe. Als ich eingeschult wurde, war der Christenlehreunterricht noch fester Bestandteil des Stundenplans und ich denke, das hat die Voraussetzungen geschaffen, dass ich trotz meiner Herkunft nur mit meinen Fähigkeiten etwas erreichen konnte – also leichter als zum Beispiel nach 1971 als sich die DDR fest etabliert hatte.
Meine Eltern waren Angestellte. Es gibt sonst niemanden, auch meine Geschwister nicht und in Wirklichkeit hätten womöglich in anderen Gesellschaftsordnungen in Deutschland meine Eltern es nicht geschafft ein Kind diese Laufbahn gehen zu lassen. Da war wieder der Vorteil, dass die DDR das Geld nicht zurückhielt, wenn jemand kam, der nicht sofort konform wirkte. Das lief also ganz ruhig ab. Ich war dann auch „prädestiniert“ auf das Gymnasium zu gehen, mein Vater allerdings wurde dann gelähmt. Aufgrund dessen disponierte meine Familie anders. Das kam nicht von oben. Ich sollte nun die 10. Klasse beenden, dann in eine Berufsausbildung mit Abitur gehen. Diese Möglichkeit gab es, heute sagt man wahrscheinlich dritter Bildungsweg dazu.
Das lief dann genauso locker ab. Ich habe also dann auf Wunsch meines Vaters Kaufmann gelernt, obwohl das nicht unbedingt mein Traum war, habe mein Abitur absolviert, meinen Kaufmann, sodass ich damit immer Geld verdienen konnte, wenn ich keines hatte, zum Beispiel Abschlussbilanzen in großen Betrieben. Das wurde noch alles mit dem kopf gemacht, es gab ja keine Computer, was dem Verstand ja nicht geschadet hat.
Aufgrund der kaufmännischen Ausbildung, vielleicht und meines schon immer vorhandenen Faibles für Geschichte – das gehört ja zusammen, Ökonomie und Geschichte – habe ich mich dann entschieden, Geschichte zu studieren, was man mir in Leipzig empfohlen hat, weil mein Traum nicht mehr zu verwirklichen war – angeblich waren die Plätze im germanistischen Seminar alle vergeben. Heute, wo ich alt bin und zwei Systeme erfahren habe, möchte ich sagen, man musste von der Herkunft her koscher sein, um Germanistik studieren zu können, denn es existierte ja eine Zensur, das hatte ich bis dahin noch nicht so richtig begriffen, weil es mir so im Großen und Ganzen nicht schlecht ging. Das heißt also, ich wurde in Wirklichkeit zu keinen Dingen gezwungen in politischer Hinsicht, das darf man aber nicht als positiv bewerten, es hängt immer alles von den Menschen ab, mit denen man lebt. Und bis dahin war ich mit Lehrern verbunden, die der individuellen Entwicklung Raum gaben, trotz der ideologischen Zwänge. Es zählte in meiner Entwicklung vor diesen Menschen immer die Fähigkeit, da hatte ich vielleicht auch Glück.
Das Germanistikstudium wurde demzufolge nichts, am gleichen Tag habe ich mich dann für das Geschichtsstudium entschieden, da auch die Aufnahmeprüfung bestanden und als Studienrichtung Neuzeit, d.h. ab den großen Entdeckungen durch Christoph Columbus. In der marxistischen Geschichtswissenschaft hat man ja so eingeteilt, teilweise wird es heute aber auch noch benutzt. Da studierte ich dann zwei Jahre in Leipzig an der Uni. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es war eine unheimlich offene Atmosphäre. Dann kam die Hochschulreform, ich glaube 1972, wir haben uns nicht vorstellen können, dass es in der DDR eine Reform geben kann und haben das nicht so ernst genommen. Dann bekamen wir jedoch neue Studentenausweise, auf denen nicht mehr draufstand „Geschichte der Neuzeit“, sondern „Wissenschaftlicher Kommunismus/Geschichte“. Das gefiel uns nicht. Wissenschaftlicher Kommunismus wurde plötzlich ein Fach, pflichtgemäß gelehrt. Wir habe das in Wirklichkeit nicht als Wissenschaft angesehen. Natürlich, das gebe ich zu, mit dem Gedanken des Kommunismus kann man sich rein logisch und argumentativ anfreunden, wenn man mit der „Teilerei“ zufrieden ist. Als Unterrichtsfach war das für uns kaum zu akzeptieren. Wir hatten sowieso schon die Fächer Philosophie und Ökonomie, in beiden musste ein Staatsexamen gemacht werden, also schriftliche und mündliche Prüfung. Das war die reinste Propaganda. Es gab große Unruhen an der Universität, weil die Studenten das nicht wollten. Ich kann heute nicht mehr sagen, wie sie es geschafft haben, uns zu besänftigen. Man hat dann Events gestaltet, unter anderem sollte Fidel Castro vor den Studenten über sich und Ché Guevara sprechen. Dann kam aber ein anderer Kubaner, weil es Fidel angeblich nicht so gut ging an diesem Tag. Irgendwie verliefen die Proteste dann im Sande. Und damit hat man uns vielleicht betäubt, es wirkte international und offen. Man vergaß im Endeffekt die Mauer und auch der Studentenausweis rückte in den Hintergrund. In Wirklichkeit hätten wir durchhalten sollen, das war eine Frechheit.
Dann kam es bei mir persönlich zu einem Einschnitt, ich hatte schon mein Diplomthema, das war ganz toll. Ich konnte mir aussuchen die Entwicklung des Proletariats, also mit der Entstehung der kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse, entweder in den USA oder in Belgien. Und meine Professorin sagte zu mir, dass wenn wir nach Belgien führen, würden wir beide zusammen hinfahren, ich solle meine Diplomarbeit schreiben und zwischendurch fahren wir nach Paris und kaufen Parfüm. Das machen wir, war meine Antwort. Zum Glück ist das nichts geworden. Als Student gab es da keinerlei Beschränkungen, auch nicht seitens der Professoren, wenn solch ein Thema vergeben wurde, war es selbstverständlich, dass so etwas nicht ohne vor Ort zu sein auch bearbeitet werden konnte. Allerdings musste ich – das wusste ich damals noch nicht – einen kleinen schicksalhaften Zettel unterschreiben, der auch relativ neutral rüberkam. Und zwar, wenn man im Ausland weilt, weder über die DDR erzählt noch Kontakte knüpfen und natürlich zurückkehren, sich also im Rahmen der Bedingungen bewegt. Wenn ich nach Belgien gegangen wäre, hätte ein Diplom gemacht, hätte ich heute nicht unterrichten dürfen, dann wäre ich in der Stasi gewesen, obwohl das erstmal nichts damit zu tun zu haben scheint.
Das hat sich aber alles zerschlagen, weil ich schwanger war. Ich habe mich beurlauben lassen für ein Jahr, und als mein erstes Kind geboren war und mich gerade ein wenig erholt hatte, war mein zweites Kind unterwegs. Ich habe mir das dann nicht mehr zugetraut, denn es gab keine Krippenplätze. Man hatte jeder Frau einen Krippenplatz versprochen man die Geburtenrate durch finanzielle Zuwendungen forciert – und man konnte sich in der DDR ja auch in Ruhe lieben und Kinder kriegen und Fremdgehen auch, das war alles nicht so spießig und kontrolliert, also machten die Leute das auch – aber die Plätze waren gar nicht da. Wohnungen und Krippenplätze, das waren die großen Mängel, weshalb die Leute oft weder ein noch aus wussten und den beruflichen Weg doch abbrechen mussten. So ging es mir auch. Ich bin dann meinem Mann gefolgt, er hat in Eisenach sein Diplom gemacht, als Ingenieur in der Automobilbranche. Wir hatten überhaupt kein Geld. Mein Mann lief ja ebenfalls noch als Student, das hieß für uns beide ca. 200 Mark Einkommen im Monat. Die Miete machte ca. ein Drittel unseres Verdienstes aus. Es war ein kärgliches Studentenleben.
Ich entschloss mich dann aber, wieder zu studieren. Das war für mich kein Zustand, ich arbeitete in Gotha in einem Großbetrieb im Außenhandel und da habe ich viel Geld verdient. Trotzdem habe ich mich dazu entschlossen zu studieren, weil ich meine wissenschaftlichen und kulturellen Ambitionen verwirklichen wollte. An das Lehrerdasein habe ich gar nicht gedacht ich bin kein Lehrerfreund gewesen und heute noch nicht. Diese Möglichkeit ergab sich für mich dann aber nicht mehr. Das war damals Alltag und ist es wahrscheinlich heute ebenfalls, wenn man zwei Kinder hat. Für eine wissenschaftliche Karriere musste man schon erwägen, ob man seine Familie im gewissen Sinne im Stich lässt oder sich ihr zuwendet. Das Lehrerstudium war also ein Kompromiss. Das Studium habe ich dann auch erfolgreich absolviert, das war natürlich anstrengend mit Familie und Kindern. Das klingt alles so leicht, wenn man immer sagt, in der DDR wurde alles gefördert, so war das nicht – ich lief zum Beispiel nicht über die förderwürdigen Leute, das hieß Arbeiterschaft zu sein, in der SED musste man sein, dann hätte ich 300,- Mark Stipendium bekommen. Da ich aber nichts von alledem war, sondern alles nur „mein Wunsch“ – wie man das dann formulierte – war es sehr schwer. Ich musste kämpfen, auf allen Verwaltungsgremien in Magdeburg bin ich mit meinen Kindern hingezogen und habe gesagt, ich möchte studieren. Immer wieder wurde mir gesagt: Mädchen, das geht nicht. Ich sagte, gut, dann komme ich nächste Woche wieder, vielleicht haben Sie sich das bis dahin anders überlegt. Ich war immer wieder dort und fragte, wo es geschrieben steht, dass ich nicht studieren darf. Dafür gab es aber keine Richtlinien. Irgendwann habe ich dann jemanden getroffen, der so genervt war, dass sie mich doch studieren ließen. Ich wollte eigentlich Sport studieren, das wurde mir allerdings ausgetrieben. Für ein Sportstudium war ich bereits zu alt ( 26 oder 27 ). Die Fakultät war eine Zweigstelle der DFK Leipzig, das war ja das renommierte Institut für unsere Nachwuchssportler und da musste man schon was bringen. Deshalb habe ich mich dann für ein Studium der Geschichte und Deutsch entschieden.
1981 bin ich dann an die POS Lindenhof, später Leninschule, gekommen und musste genau wie die Lehrer im Westen – das möchte ich mit Nachdruck betonen, denn in der Hinsicht werden wir bis heute diskriminiert – ein zweijähriges Referendariat absolvieren, außer vielleicht man war politisch vorbelastet. Alle anderen mussten in diesen zwei Jahren beweisen, dass sie zum Lehrer taugen. Nach einem Jahr, mir wurde aufgrund guter Leistungen – und vielleicht auch aus sozialen Gründen, denn ich hatte bereits zwei Kinder im schulfähigen Alter – ein Jahr erlassen. Ich verdiente zum ersten Mal richtig Geld. Das waren ca. 700,- Mark. Da arbeitete ich dann eine ganze Weile, bis mich eine Mutter, die Direktorin an einer Berufsschule war und krampfhaft einen Deutschlehrer suchte, abgeworben. Und weil ihre Söhne bei mir lesen und schreiben gelernt hatten, fragte sie mich – es ging also nicht anders als heute, nicht alles über Partei und Stasi. Den Segen von der Schulverwaltung gab es auch und es fehlte nur noch die Partei. Weil ich aber der Tochter der Parteisekretärin ebenfalls Lesen und Schreiben beigebracht hatte – deren Töchter jetzt wieder meine Schüler sind – und anscheinend einen guten Ruf genossen habe – wir kannten uns ja nicht persönlich – hat sie das ebenfalls befürwortet und ich konnte dann an die Berufsschule wechseln. Das war der endgültige Ritterschlag. In der Berufsschule hat man wesentlich mehr Geld verdient, denn die wurden aus der Wirtschaft unterstützt. Man konnte im Prämiensystem besser bedacht werden. Ich hatte es dort sehr gut. Ich war die einzige Deutschlehrerin, niemand konnte mich verbessern. Geschichte musste ich an den Nagel hängen, denn auch die wenigen Abiturienten – das war eine Berufsschule für Gastronomie – hatten keinen Geschichtsunterricht. Hier hatte ich meinen Platz gefunden, als dann die Wende kam.
Die Betriebe wurden dann aufgelöst und somit auch die Berufsschulen und meine Schulleitung empfahl mir dann, mich für das Gymnasium zu bewerben und da ich auch politisch nicht vorbelastet war, konnte ich am Gymnasium unterrichten. Ich landete beim Scholl-Gymnasium, zu dem ich eigentlich nicht wollte, denn als ich Abiturient war, gab es in Magdeburg drei EOS. Zwei waren althergebrachte EOS OvG und EOS Humboldt – ich lernte damals am EOS OvG – und das dritte war das 1949 neu geschaffene Geschwister-Scholl-Gymnasium, für das Proletariat. Und so heimlich bestand ja noch der Krieg zwischen dem Bürgertum und dem Proletariat. Das Bürgertum belächelte die Arbeiterkinder. Das zeigte sich dann immer beim Sportfest in der Hermann Gieseler Halle, gegenüber saßen sich OvG und Humboldt und an der Stirnseite musste Scholl Aufstellung nehmen und wenn die einliefen pfiff alles und manchmal flogen auch schon mal ein paar Sachen hinüber.
Die Erscheinung des künstlichen Menschen hat sich im Laufe der Jahrhunderte einem fortwährenden Wandel unterzogen, sie fand Eingang in die unterschiedlichsten Kulturkreise und ist bis heute präsent geblieben. Der Schritt aus dem Reich der Phantasie in die Wirklichkeit ist dabei längst getan, Automaten, Maschinen, Roboter sind Teil unseres Lebens. Doch nicht nur an der Erscheinung selbst vollzog sich dieser Bedeutungswandel, auch der Schöpfer erlag dieser Veränderung. Er wandelte sich vom Künstler, zum Magier und schließlich zum Gelehrten. Das Einzige, was dabei fortwährend Bestand hatte, ist das Verhältnis zueinander. Der Schöpfer erschafft sich einen Diener.
Die Reflektion und Thematisierung von kultureller und wissenschaftlicher Entwicklung innerhalb der Literatur hält bis heute an. Von eminenter Wichtigkeit erscheint diese Entwicklung zur Zeit der Aufklärung, denn das dort geprägte Bild vom Schöpfer und seinem Diener erfährt neben einer allgemeinen Renaissance den Wandel vom magischen zum technischen Verhältnis.
Künstliche Menschen sind jedoch nicht erst seit der Epoche der Aufklärung Gegenstand der Literatur. Eine der ältesten Überlieferungen ist in der griechischen Mythologie zu finden, wonach Prometheus, den ersten Menschen formte und Athene ihm durch einen Schmetterling Leben einhauchte. Ovid beschrieb in den Metamorphosen Pygmalions Liebe zu der durch ihn geschaffenen Elfenbeinstatue, die auf seine Gebete zum Fest der Venus hin lebendig wird und seine Liebe erwidert. Ein anderes Beispiel findet sich bei Polybios. Sein Tyrann Nabis verfügte über eine Maschine, die seiner Frau Apega bis aufs Haar glich. Sie ermöglichte es ihm seine Forderungen gegenüber dem Bürger durchzusetzen, indem sie die Arme um ihn schlang und ihn an sich heranzog. Die Arme und die Brüste waren mit eisernen Nägeln beschlagen und entlockten dem Bürger entweder das von Nabis geforderte Geld oder er starb in ihren Armen. Hier erscheinen gleich drei unterschiedliche Erbauer und mit ihnen auch drei unterschiedliche Geschöpfe. Der Prometheus, der Titan und Göttergleiche, als Schöpfer der Menschheit sollte im eigentlichen Sinne ausgeklammert werden, allerdings ist er der Vorbote einer anmaßenden Menschheit, die das Werk der Schöpfung selbst in die Hand nehmen will. Bei Pygmalion und Nabis stehen hingegen nicht die Anmaßung, sondern vielmehr die Zweckmäßigkeit im Vordergrund. Außerdem sind beide Schöpfer bereits Menschen, der eine ist Künstler, der andere Tyrann.
Im Mittelalter setzt sich die literarische Auseinandersetzung mit dem Stoff weiter fort. Der Türhüter des Albertus Magnus, ein eiserner Kopf, der sogar sprechen konnte, die Golemsage um Rabbi Löw aus Prag und die Sage vom Holzmenschen aus der chinesischen Tripitaka sollen hier als Beispiele für die unterschiedlichen Kulturkreise und ihrer Verarbeitung des Motivs genügen. Zudem sind auch die antiken Inhalte weiter verarbeitet worden.
Beredte Zeugnisse der neuerlichen Weiterentwicklung des Kunstmenschenmotivs gehen auch mit dem Fortschritt der Wissenschaft einher, die Renaissance lieferte dafür einige Beispiele. Als besonders markantes Beispiel sollen hier die Ausführungen Paracelsus zur „Putrefaction“ und „generatio“ in der Schrift „De generatione rerum naturalium“ genannt werden. Er unterscheidet dabei die natürliche Erzeugung „ohne alle Kunst“ und die künstliche „durch alchiam“. Beide Prozesse bedürfen jedoch der „feuchten Wärme“. Aus diesem Prozess kann dann in wohlgefälliger Form – das heißt nicht gotteslästerlich – ein Homunkulus gezüchtet werden, der, sobald er eine gewisse Größe und Alter erlangt, über alle Geheimnisse der Welt verfügt.
Der Sieg des Individuums über die Masse – dies ist durchaus schon eine Errungenschaft der Renaissance, der Künstler zum Beispiel tritt aus seiner Anonymität hervor – bildet abgesehen von der Notwendigkeit seiner Identifizierung in frühkapitalistischer Zeit ein solides Fundament für alle Bereiche der Wissenschaft und treibt im 17. Und 18 Jh. ihre Blüten. Nicht nur die Medizin profitiert davon. Es kommt zur Begründung gänzlich neuer Wissenschaften, die nicht unbedingt neu im eigentlichen Sinne des Wortes sind, aber in ihrer Abgrenzung und Definition etwas Neues darstellen. Die Wiederentdeckung des Menschen in Kultur und Wissenschaft ist die Renaissance der Epoche der Aufklärung. Mit der Frage, was ist der Mensch muss natürlich auch die Frage einhergehen, was ist der Mensch nicht. Der Mensch ist nicht mehr nur stummer Diener sondern vielmehr Schöpfer. Den Mut zu haben, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und dies auch öffentlich zu machen sind die Maximen des aufgeklärten Menschen. Der Prometheus der Aufklärung, Goethes Prometheus, ist wieder der Vorbote, die Spitze des Eisbergs. Den Stimmen der Mahner und Moralisten entkommt er nicht gänzlich, sie sind in der Literatur des 18. Jh. immer noch in der Überzahl aber der Mensch als Schöpfer ist literarisch nicht mehr aufzuhalten. Schrieben die Jakobs ( Jakob Emden und Jacob Grimm ) noch von einem bösen Ende des Schöpfers der Golems, so ist nicht einmal 50 Jahre später schon ein guter Ausgang der Sage möglich. Lawrence Sterne, der englische Pedant zu Jean Paul, und viel später Raoul Hausmann führen den Homunkulus ins Possierliche. In Goethes Faust dient er nur noch der Ablenkung vom Wunsche Fausts, Helena zu besitzen.
Das schöpferische Element der Aufklärung lebt allerdings nicht nur von einem Zustrom immer neuer Verarbeitungen alter Stoffe, es entstehen auch etliche Neuentwicklungen. Johann Christian Wiegleb fertigt in „Vaucansons Beschreibung eines mechanischen Flötenspielers“ eine literarische Skizze zum Aufbau und der Funktionsweise des künstlichen Musikanten an, den Vaucanson 1737 erbaute und der ein Repertoire von 12 Liedern spielen konnte. Wiegleb war es auch, der dem künstlichen Menschen des Albertus Magnus ( nach der Sage, nicht nur ein eherner sprechender Kopf, wie er vielen Gelehrten des Mittelalters zugeschrieben worden ist, sondern ein komplett künstlicher Mensch ) seine Daseinsberechtigung gegenüber der kirchlichen Meinung, dass solch eine Kreatur teuflisch sein müsse, verteidigt. Aus der Zauberei wird Wissenschaft. Auch Jean Paul nimmt sich des Stoffes an und ersinnt in der aufkommenden Euphorie der Automatenherstellung einen Menschen, der sich für jede erdenkliche Tätigkeit, die ein Mensch durchzuführen hat, ein maschinelles Pendant entwickelt, um sich diesen lästigen Tätigkeiten zu entledigen. Dabei entstehen nicht nur Vorläufer heutzutage nicht mehr wegzudenkender Hilfsmittel wie zum Beispiel die Schreibmaschine, sondern auch Maschinen, die so abwegige Funktionen wie das Kauen von Nahrung vollführen.
Der künstliche Mensch hatte also schon immer seinen festen Platz in der Literatur und fast jede literarische Epoche setzte sich auf ihre Weise mit dem Phänomen auseinander. Neuerliche Entwicklungen in der Wissenschaft – ob nun die Medizin, das neu eröffnete Feld der Psychologie oder die Physik und Chemie – erschlossen der Literatur ein schier unerschöpfliches Arsenal an Ideen, Nuancen und Fokussierungen. Der eigentliche Akt der Schöpfung, die Wahrnehmung durch den Menschen oder auch seine moralische Verteidigung können bei der Verarbeitung des reichhaltigen Angebots nur noch Stichproben liefern. Vollständig erfassbar ist das Phänomen wohl nicht mehr.
Der echte Schlaf ist flüchtig. Die reinsten Essenzen sind von jugendlicher Unschuld und für kein Geld der Welt zu kaufen. Das Bett ist völlig egal. Ein rostiger Suppentopf könnte als Kopfkissen dienen und als Decke vielleicht der Lappen, den man normalerweise darauf verwendet, den Ölstand beim Auto abzumessen. Das ist alles egal.
Für diesen Schlaf braucht es kein Interieur. All die Zeremonienmeister mit ihren Kaschmiraugenmasken, Wasserbetten mit verschiedenen Beruhigungsstufen oder ganz spezieller Einschlafmusik, sie wollen alle nur eins:
Sie wollen kurz erwachen, weil sie das Gefühl haben, über sie wacht jemand, und mit diesem Gefühl wieder einschlafen – so wie mein Sohn, 10 Wochen alt.
Ich habe noch etliche Texte in petto, da komme ich auf die unterschiedlichsten Autoren, deren Stil ich
anscheinend kopiere. Viele davon habe ich noch nie gelesen, geschweige denn überhaupt gekannt. Von
Phyllis inspiriert konnte ich davon nicht genug bekommen und habe etliche Texte durch die Analyse geschickt, aber am liebsten wäre mir das:
Es gibt immer einiges zu kritisieren, wenn ich eine Vorlesung besuche, und immer gibt es auch zwei Seiten von denen aus ich dies beurteilen will. Da gibt es zum Einen die Forderung der Dozenten, für ein Referat ein Handout zu erstellen, damit die Hörer dem Vortrag zum Einen folgen können und zum Anderen nach dem Seminar etwas Handfestes erhalten, was sie für eigene Aufzeichnungen nutzen können. Wenn also in einer Ringvorlesung der Dozent - häufig sind das Professoren – kein Handout herausgibt, liefert er Angriffsfläche für den Hörer, der von den selben Leuten dazu genötigt wird und andererseits adeln sie sich damit selbst, indem sie auf solche Kinkerlitzchen verzichten.
Wo bin ich? Im wunderschön restaurierten Chemiehörsaal der Leibniz-Universität Hannover in Begleitung von
Trithemius, der mit nicht weniger Begeisterung an dieser Vorlesung teilnimmt. Worum geht es? Es geht um Jean Paul und Leibniz, also keine geringeren als die treibenden Kräfte in der Philosophie des 17. und der Literatur des 18. und 19. Jahrhundert. Die Verbindungen liegen auf der Hand, und wie es der eingangs erläuternde Professor feststellte, keine unfruchtbare Verbindung. Angetreten ist eine Kennerin des Fachs. Lange Zeit war sie für die Edition der Werke Jean Pauls zuständig und neuerdings widmet sie sich den Leibnizschen Briefwechseln.
Schon früh zeichnen sich zwei Schwerpunkte ab, um die der Vortrag kreist. Da ist die Monadologie von Leibniz zu nennen und das Leib-Seele-Problem, was sich in der Frühaufklärung manifestierte und bis in die Spätaufklärung heiß diskutiert wurde. Eine Lösung ist heute noch lange nicht in Sicht, es bleibt also genug Stoff für Literaten und Philosophen gleichermaßen.
Genauso früh wird mir klar, dass ich dem Vortrag in seiner Gänze nicht folgen werde, denn die Akustik lässt aufgrund des lauten Lichts ( der Lüfter des bilderwerfenden Projektors stört die akustische Aufnahme des Gesagten erheblich ) und dem mangelnden Talent der Sprecherin zu lauter und deutlicher Artikulation zu wünschen übrig.
Die Sprecherin zitiert Jean Paul, sie lässt glücklicherweise das Zitat auf dem Projektor erscheinen. Sie referiert, dass Leibniz sowohl in London als auch in Hannover zur gleichen Zeit verweilen könnte und nur durch die Trennung von Leib und Seele wäre eines der Schriftstücke zwar erdacht aber nicht verfasst worden, weil es der Seele an Händen mangelte. Die Einheit von Körper und Seele und ihrer Rezeption durch Jean Paul wird hier sehr deutlich. Leibniz selbst spricht von zwei unabhängig voneinander gleich schlagenden Uhren; ein passender Vergleich zur Ausführung Jean Pauls davor. Hier steige ich dann aus. Die Notizen dazu habe ich später frecherweise von Trithemius abgeschrieben, der insgesamt etwas aufmerksamer war als ich.
Wenn ich am linken Rand säße – immer in Position zur Sprecherin gemeint – wäre es die gleiche Position wie rechts vom Rand, wenn ich allein ihr Manuskript fokussierte. Es wären die gleichen Blätter, zu zwar unterschiedlichen Seiten geneigt – die Rechtshänderin ist unverkennbar – aber die Menge wäre immer die gleiche. Es neigt sich ein aus vielleicht einem, maximal zwei, Blättern bestehendes Bündel direkt nach unten, während der Rest des Manuskripts nichts an seiner durch die rechte Hand beigebrachte Spannung eingebüßt hat und starr dahin zeigt, wohin sich die Sprecherin wendet. Ich kann ungefähr erahnen, wie viele Blätter es noch sind. Quatsch! Ich kann optimistisch schätzen. Mit jedem Blatt, was sie zur Seite legt, schätze ich erneut – optimistisch.
Eine schlimme Vorstellung bietet die penible Ablage der Blätter, die sorgsam rückseitig aufeinander auf dem Tisch gestapelt werden. Man stelle sich vor, nachdem das letzte Blatt abgelegt ist, wird der abgelegte Stapel in seiner hinterlassenen Ordnung von Neuem aufgenommen und das Referat geht in die zweite Runde, die Rückseiten kommen an die Reihe. Meiner Gemütsverfassung zwar nicht zuträglich wäre dies trotzdem eine außergewöhnliche Performance.
Hah, das letzte Blatt ist erreicht.
Angelesen.
Aufgelesen.
Abgelegt.
Überlebt.
Als ich am Wochenende in meiner alten Heimat war, besuchte ich zusammen mit meiner Frau und Kind einen guten Freund und seine Frau. Wir kennen uns schon seit unserer Geburt sozusagen, zumindest unsere Mütter kennen sich schon so lang und wir beide seit dem Kindergarten.
Meine "alte Heimat" ist eben absolut zufällig von mir geschrieben worden, und während dies geschah, musste ich mich doch über die Präzision dieser Formulierung wundern, die sowohl meine alte Verbundenheit mit Magdeburg aber auch nur ein Zurückblättern zu einem längst abgeschlossenen Kapitel bedeutete. Hier bin ich aufgewachsen, habe meine Jugend verlebt aber als es ernst wurde, bin ich abgereist und habe mir ein neues Domizil gesucht. Das ist jetzt 6 Jahre her.
Am Samstag saßen wir dann bei den beiden herum, zuerst im Wohnzimmer und später der besseren Unterhaltung wegen auf dem Dach des Hauses. Das Haus ist ein zehngeschossiger Klotz, der letzte unsanierte in einer Reihe, die im Abstand H1 zu insgesamt sieben solcher Klötzer angeordnet sind. H1 bedeutet, es ist genausoviel Platz zwischen den Gebäuden, wie jedes einzelne hoch ist. Als Architekt muss man so etwas wissen und mein Freund ist Architekt. Warum er jedoch als aus gutbürgerlichem Elternhaus stammender, niemals auf eine Plattenwohnung angewiesener in eine solche gezogen ist, erschließt sich mir nur durch solche im Nebensatz formulierten Feinheiten.
Er wohnt in der 10. Etage, die als 9. gekennzeichnet ist, weil es ja auch ein EG gibt. Auch das ist mir ein Rätsel aber danach habe ich ihn nicht gefragt. Der Fahrstuhl fährt übrigens nur bis in die 8. Etage. Das hat er schon immer so gehandhabt und bei den meisten 10ern ist das wohl heute noch so - wenn nicht die Fahrstuhlanlage komplett überholt worden ist. Wir müssen also immer noch eine Etage nach oben laufen, im Fall, dass wir auf dem Dach sitzen wollen, sogar zwei. Für die Aussicht macht man das aber gern.
Sitzt man wie wir mit Blick in die langsam untergehende Abendsonne so erschließt sich in weiter Entfernung ein Meer aus Windrädern. Ganz nah und halb links befindet sich das Gelände der medizinischen Akademie, die heute anders heißt. Ein Meer aus sattem Grün mit versprenkelt darin zum Vorschein kommenden alten Ziegeldächern. Rechts der Sonne erstreckt sich die Stadt. Früher, vor der Zerstörung im zweiten Weltkrieg muss Magdeburg mehr Kirchen als Christen gehabt haben, heute sind es weniger Kirchen, die Zahl der Christen kenne ich nicht. Ein paar neue Kirchen sind auch gebaut worden. Der Schandfleck halb rechts, die Johanniskirche, wurde ja schon vor Jahren voll saniert, mittlerweile kann man auch von dort die Aussicht genießen und vielleicht stehen dort gerade Leute auf dem Turm und schauen zu uns herüber. Um etwas zu erkennen, sind wir aber viel zu weit weg.
Noch weiter rechts kommt der Dom, den man schon deshalb nicht verwechseln kann, weil es die höchste Erhebung in der Gegend darstellt. Die Gerüste, die beide Türme bekleistern, kann man nicht mehr abnehmen, weil sich der Boden darunter - der Domfelsen - als nicht so hart präsentiert, wie es die Erbauer gern gehabt hätten. Der Dom sackt ab, langsam. Vielleicht ist es bald ein schiefer Dom. Vielleicht ist er schon schief. Hinter uns ergrünt seit ein paar Jahren das stillgelegte ehemalige Gelände der SKET, dem Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann. Viele der Produktionshallen sind abgerissen, dort stehen jetzt kleine Birken und Pappeln und Ahorn und Linden.
In nächster Nähe von uns zu beiden Seiten, schaut man in die langen Fensterreihen der anderen Klötzer. Wie ein Adventskalender gehen ständig irgendwo die Lichter an und es erscheinen Menschen vor den Fenstern. Dann gehen die Lichter wieder aus und das Leben zieht zu einem neuen Fenster, vielleicht auf der Rückseite, die wir nicht sehen können. Es gibt immer zwei Seiten, die Vorderseite, dort wo der Eingang ist, haben die Fenster eine klare Hierarchie. In der Mitte ist das Flurfenster. Links davon kommt zuerst das Küchenfenster, dann das Badezimmer. Danach häufig das Kinderzimmer und dann kommt noch ein häufig als Schlafzimmer genutzter Raum, danach ist Schluss. Zur rechten kommt zuerst das Badzimmerfenster, dann die Küche und auch danach häufig das Kinderzimmer - heute wohl eher der Hobbyraum, Kinder gibt es hier nicht mehr so viele. Die Symmetrie wird durch den Blockcharakter durchbrochen. Die Versorgungsleitungen sind immer gleich, deshalb ist links zuerst die Küche und nach weiter außen hin das Bad und auf der rechten Seite ist es genau anders herum.
Auf der Rückseite des Gebäudes ist es schwieriger, die Zimmer ihren Funktionen zuzuordnen. Wenn ich jedoch ganz rechts außen beginne, kommt wohl zuerst das Wohnzimmer der Wohnung, die auf der Vorderseite über das Kinderzimmer und das Schlafzimmer auf der linken Seite verfügte. Danach folgt das Schlafzimmer einer Wohnung, die nach vorn raus überhaupt kein Zimmer hat. Diese Wohnung gleicht im Grundriß der Wohnung meines Freundes bis ins kleinste Detail, die Inneneinrichtung bei ihm ist jedoch einzigartig. Dann kommt das Wohnzimmer und dann das Küchenfenster. Nun ist die linke bzw. rechte Seite eines Eingangs abgeschlossen. Es folgt die umgekehrt angeordnete Fensterreihe der rechten bzw. linke Seite des Eingangs.
Gegen 23.00 Uhr sind wir runtergegangen vom Dach, die Sonne war längst verschwunden. Die Faszination dieser aus dem Gedächtnis erfolgten Rekonstruktion lässt mich ein klein wenig nachvollziehen, was meinen Freund in die Platte treibt, die Aussicht vom Dach natürlich auch.