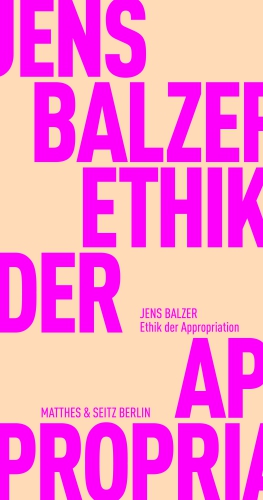Eine Rezension, die ich gestern noch geschrieben habe für ein Seminar. Ist ein wenig lang, deshalb teile ich sie in zwei Teile auf. Morgen oder heute Abend, je nachdem wie ich es schaffe, kommt dann Teil 2 dazu. Im zweiten Teil gibt es ein alternatives Ende, dass ich kursiv halten werde. Hier im Text sind auch zwei Stellen kursiv, die erste ist von mir noch nicht zu Ende gedacht, jedenfalls nicht wirklich (verdammt, wo ist nur meine Ausgabe von "Homo Faber"?), die zweite würde ich wohl weglassen, wenn ich mich für das alternative Ende entscheiden müsste.
 Eine Zeitung von
Eine Zeitung von hinten nach vorn zu lesen ist nicht nur vorstellbar, sondern wird auch häufig praktiziert. Aber einen Roman? Kapitelweise am Ende beginnend zum Anfang vorzudringen, würde die Geschichte komplett rückwärts ablaufen lassen. Aber die Gesetze der Kausalität haben umgekehrt angelegt die gleiche Berechtigung wie ihre lineare, chronologische Reihenfolge. Und finden sich beide Strukturen in einem Roman, sowohl die aufeinanderfolgende, einem Zeitfluss unterworfene Erzählung, als auch die auf das Prinzip von Ursache und Wirkung beruhende, die scheinbar willkürliche, die rückwärtsgerichtete Erinnerung, dann sind die Aussichten nicht schlecht, so oder so einen Zusammenhang herzustellen.
Ulrich Peltzers Roman „Das bessere Leben“ ist ein solcher. Zugegeben, nicht alles hängt zusammen. Manches ist nur lose verknüpft, vieles hat gar keine Verbindung, aber Peltzer wäre kein guter Konstrukteur, wenn er diese Klippen nicht zu meistern wüsste; das hat er hier eindrucksvoll bewiesen. Es geht ihm in seinem Buch um nicht weniger als die ganz großen Zusammenhänge, um das Geflecht aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, erzählt aus der Sicht von einem guten Dutzend an Personen.
Gleich zu Anfang des Romans finden wir uns in einem Traum wieder, der fast 40 Jahre in die Vergangenheit führt. Auf den Campus der Kent-State-University im Jahr 1970, wo bei Studentenprotesten vier Studenten unter ungeklärten Umständen zu Tode kommen. Der Träumende ist Sylvester Lee Fleming, Mitte 50, der sich nicht nur zufällig in seine eigene Vergangenheit zurückträumt, sondern sich, auch in der Zeit, zu der der Roman spielt, im Mai eines Jahres befindet: „Er nahm sein Blackberry hoch (07:08, 2.5.2006, Mist)…“ Fleming ist ein Backup-Mann, ein
homo Faber der Ökonomie, ein Mann fürs Grobe und Feine, diskret, effizient. Er ist überall zu Hause, virtuos auf der Klaviatur globaler, halblegaler Finanzgeschäfte, dessen einzige Schwäche das Träumen zu sein scheint, das kann er nicht kontrollieren, nur abstellen mittels Tabletten.
Der zweite Protagonist ist kein wirklicher Widerpart. Auch er bereist im Auftrag die Welt, fädelt Deals ein, schließt Verträge ab, klärt Finanzierungen, hofiert Geschäftspartner, lässt sich hofieren. Jochen Brockmann ist Anfang 50, Sales-Manager, wie er sich selbst beschreibt, und arbeitet seit 14 Jahren für die gleiche Firma. Man könnte in ihm fast einen Anachronismus nennen, bedenkt man, wie hoch die personelle Fluktuation in diesen Bereichen ist. Wie schnell hochrangige Manager kommen und wieder gehen, entweder weil sich lukrativere Posten ergeben oder weil kompetenteres Personal nachrückt und altes verdrängt.
Letzterem, so scheint es, fällt auch Brockmann zum Opfer. Sein Arbeitgeber verliert nach und nach die Autonomie an einen Finanzinvestor, einen Hedgefonds, der immer größere Anteile der Firma aufkauft, um am Ende die Aktienmehrheit, somit die Entscheidungsgewalt innerhalb des Konzerns zu erhalten. „Die Branche kränkelt, Übernahmen stehen auf der Tagesordnung“, säuselt Fleming verschwörerisch während ihrer letzten Begegnung in einer Bar. Sie lernten sich kennen in der Lobby eines Hotels in Sao Paulo. Zufällig, könnten wir fragen? „Und?“ fragt Brockmann, irgendwie unberührt, obwohl er längst ahnt, dass sich Fleming nicht ohne Grund in dieser Weise an ihn wendet. „Es wird im Augenblick sehr viel Geld bewegt, man wirft Gewicht ab, schlankere Geschäftsmodelle sind gefragt. Auch im Maschinenbau.“, führt Fleming weiter aus. Und spätestens als er den Namen Basaldella fallen lässt, der Noch-Firmeneigner, bei dem Brockmann angestellt ist, ist klar, welche Rolle der Zufall hier spielt.
Peltzer interpretiert nicht, er konstruiert nur. Geschickt baut er um seine Figuren einen Wald aus Synchronizitäten, die seine Figuren entweder selbst assoziieren, träumen manchmal, wie im Fall von Fleming, oder sie passieren einfach, stellen sich eher zufällig ein wie die Begegnung Angelika Volkhardts und Jochen Brockmann in einem Amsterdamer Restaurant namens „Blue Pepper“. Dort wäre Angelika Ende des Monats mit Fleming verabredet gewesen. Sie reserviert sich dort einen Tisch ein paar Wochen vorher, um das Essen zu probieren und trifft auf Brockmann, der von einer eher ziellosen, in den Straßen und in seinen Gedanken stattfindenden Wanderung ablassen muss, weil ihn plötzlich das Knie schmerzt. Sie essen zusammen, es funkt irgendwie zwischen beiden, und obwohl sie kaum etwas voneinander wissen, versuchen sie später beide, den anderen ausfindig zu machen. Sie wollen sich wieder sehen...
Fortsetzung folgt
Teil 2
*Bildquelle: Wikipedia