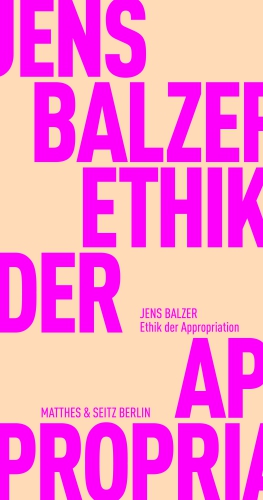Bücherregalbiographien Übersicht
Da sich bereits 5 Beiträge zu dem Projekt der Beschreibung des eigenen Bücherregals gefunden haben und ich eigentlich guter Dinge bin, vielleicht noch ein paar weitere dazu bewegen zu können, mitzumachen, möchte ich hier noch einmal die Idee vorstellen.
Der Autor darf alles. Einzige Bedingung ist, dass es sich um Dinge dreht, die Inhalt eines Bücherregals sind. Weder die Anzahl der Bücher oder Dinge, die beschrieben werden, ist festgelegt, es kann also auch ein einziges Lieblingsbuch sein oder ein ganzer Stapel. Es kann mit Foto oder ohne sein, es kann gar nicht um Bücher gehen, wenn nur das Regal dabei ist oder anders herum. Keine noch so abwegige Idee ist unwillkommen. Jeder kann so viele Texte beisteuern, wie Regale oder Bücher vorhanden sind.
Zwei weitere Bedingung habe ich doch noch: Am Anfang des Textes soll auf den vorherigen Text verlinkt werden und am Ende auf den folgenden. Der Link auf den folgenden Text wird erstellt, sobald sich der oder die Autor:in per Kommentar im Blog mit dem letzten gelisteten Text meldet und ihren Text dort ankündigt ( am besten schon veröffentlicht hat ).
Ich werde diesen Text hier immer wieder aktualisieren und alle Texte verlinkt in diesen Beitrag einpflegen, damit jeder, der darüber stolpert, eine Übersicht erhalten kann, wo die Texte nachzulesen sind. Diese Übersicht kann natürlich auch jede/r andere machen, aber das ist nicht Pflicht.
Folge 1: Notizen jenseits des Regals
Folge 2: Biographie des Regals
Folge 3: „Hl. Joseph, bitt’ für uns!“ – Die Biographie des Regals
Folge 4: Lieber der Spatz im Regal
Folge 5: Regal - Fang hui -und wech
Folge 6: Die Thronverschwörung und ein Sieg der Kaisertreuen
Folge 7: Diskjockeyverbandspräsident ohne Mitglieder
Folge 8: [M]Eine [virtuelle] Bibliothek
Folge 9: Regalgedöns
Folge 10: Buchrückenpoesie
Der Autor darf alles. Einzige Bedingung ist, dass es sich um Dinge dreht, die Inhalt eines Bücherregals sind. Weder die Anzahl der Bücher oder Dinge, die beschrieben werden, ist festgelegt, es kann also auch ein einziges Lieblingsbuch sein oder ein ganzer Stapel. Es kann mit Foto oder ohne sein, es kann gar nicht um Bücher gehen, wenn nur das Regal dabei ist oder anders herum. Keine noch so abwegige Idee ist unwillkommen. Jeder kann so viele Texte beisteuern, wie Regale oder Bücher vorhanden sind.
Zwei weitere Bedingung habe ich doch noch: Am Anfang des Textes soll auf den vorherigen Text verlinkt werden und am Ende auf den folgenden. Der Link auf den folgenden Text wird erstellt, sobald sich der oder die Autor:in per Kommentar im Blog mit dem letzten gelisteten Text meldet und ihren Text dort ankündigt ( am besten schon veröffentlicht hat ).
Ich werde diesen Text hier immer wieder aktualisieren und alle Texte verlinkt in diesen Beitrag einpflegen, damit jeder, der darüber stolpert, eine Übersicht erhalten kann, wo die Texte nachzulesen sind. Diese Übersicht kann natürlich auch jede/r andere machen, aber das ist nicht Pflicht.
Folge 1: Notizen jenseits des Regals
Folge 2: Biographie des Regals
Folge 3: „Hl. Joseph, bitt’ für uns!“ – Die Biographie des Regals
Folge 4: Lieber der Spatz im Regal
Folge 5: Regal - Fang hui -und wech
Folge 6: Die Thronverschwörung und ein Sieg der Kaisertreuen
Folge 7: Diskjockeyverbandspräsident ohne Mitglieder
Folge 8: [M]Eine [virtuelle] Bibliothek
Folge 9: Regalgedöns
Folge 10: Buchrückenpoesie
Shhhhh - 18. Mär, 12:20