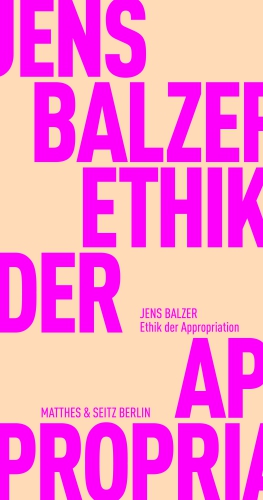letzte Ölung
Als ich mich fast erstickt, hustend, halb erblindet durch das Badezimmer tastete, weil mir die Luft, die voll von kleinen Tröpfchen aus der Düse des Badreinigers war, in Hals, Nase und Augen kratzte, musste ich plötzlich an die Hörfunkwerbung in der Metro neulich denken. Dort sollte mir von einer gutgelaunt flötenden Frauenstimme suggeriert werden, dass das Saubermachen zur "echten Wellnesserfahrung" würde, wenn ich doch nur ein paar Tropfen ätherisches Öl in meinen mit heißem Wasser gefüllten Putzeimer einließe.
Der Mann von heute putzt gar nicht mit einem Eimer heißem Wasser, sondern mit ultrascharfem Reiniger, dessen Anwendungshinweise keine Hinweise, sondern Werbebotschaften sind. Diese Botschaften suggerieren, dass Rost, Kalk, Fett usw. kein Problem sei, mit dem sich der Haushälter länger als eine Minute zu beschäftigen hat, denn genau so lang ist die Einwirkzeit des Gifts und dann lässt sich alles einfach abspülen. Viel eher sollte man die Warnhinweise lesen und sollte dort etwas stehen wie: Atmen Sie auf keinen Fall die Aerosole in der Luft ein!, heißt das, für Duschkabinen ist der Reiniger völlig ungeeignet.
Nachdem ich aus Sicherheitsgründen meine Duschkabine geschlossen hatte und nach drei Minuten Husten wieder ins Bad getorkelt kam, fragte ich mich, wie ich denn nun meine Dusche von innen abspülen könne, ohne dabei die Türen öffnen zu müssen, wir haben nämlich kein Fenster im Bad, mit dem sich frische Luft zuführen ließe. Leider fand ich dazu keinen Hinweis auf der Sprühflasche und so hielt ich die Luft an, kniff die Augen zusammen und dachte an Eukalyptus.
Der Mann von heute putzt gar nicht mit einem Eimer heißem Wasser, sondern mit ultrascharfem Reiniger, dessen Anwendungshinweise keine Hinweise, sondern Werbebotschaften sind. Diese Botschaften suggerieren, dass Rost, Kalk, Fett usw. kein Problem sei, mit dem sich der Haushälter länger als eine Minute zu beschäftigen hat, denn genau so lang ist die Einwirkzeit des Gifts und dann lässt sich alles einfach abspülen. Viel eher sollte man die Warnhinweise lesen und sollte dort etwas stehen wie: Atmen Sie auf keinen Fall die Aerosole in der Luft ein!, heißt das, für Duschkabinen ist der Reiniger völlig ungeeignet.
Nachdem ich aus Sicherheitsgründen meine Duschkabine geschlossen hatte und nach drei Minuten Husten wieder ins Bad getorkelt kam, fragte ich mich, wie ich denn nun meine Dusche von innen abspülen könne, ohne dabei die Türen öffnen zu müssen, wir haben nämlich kein Fenster im Bad, mit dem sich frische Luft zuführen ließe. Leider fand ich dazu keinen Hinweis auf der Sprühflasche und so hielt ich die Luft an, kniff die Augen zusammen und dachte an Eukalyptus.
Shhhhh - 12. Jul, 23:04