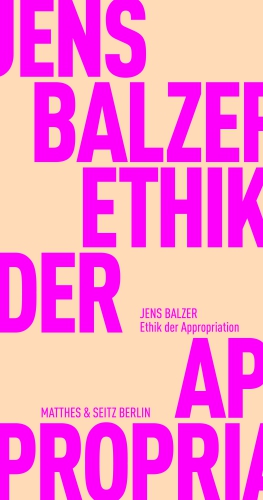Schulalltag in der DDR III
Ein vorletzter Teil des Interviews.
Die vorher erschienenen gibt es hier: Teil I und Teil II
3. Wie gestaltete sich die Organisation von Klassenfahrten und inwieweit konnte der Alltag der Schüler in den Ferien mitgestaltet werden? Wer machte was?
Im Prinzip war das eine ganz einfache Sache. Ich bekomme jetzt vielleicht die Altersgruppen nicht mehr so zusammen, aber es gab ja für die jüngeren Schüler die Ferienspiele. Die wurden angeboten – ich glaube so etwas gibt es jetzt auch wieder - für die kleineren Schüler. Die Gruppierungen sind heute noch genauso. Heute heißt es auch Hort. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mittelstufe da noch mit dabei war. Für die größeren Schüler wurde ebenfalls eine Ferienplanung angeboten, Veranstaltungen zu denen man sich traf. Da musste man sich vorher anmelden und einen geringen Obolus bezahlen und dann konnten die Schüler während der Ferien in der Schule betreut werden.
Mit der 8. Klasse jedoch hörte das auf. Die 9. und 10. Klasse konnte aber mit einbezogen werden, wenn sie Lust dazu hatten, natürlich ohne Bezahlung. Mehr habe ich persönlich als Ferienbetreuung nicht kennengelernt, ich bin ja erst 1980 Lehrerin geworden. In meiner Kindheit war das ähnlich, deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen.
In Wirklichkeit hatte das weniger einen politischen Hintergrund, und dass das FDJ und Pionierorganisationen machten, war nur aus organisatorischen Gründen so – Arbeitsteilung eben. Und diese Leute, die jetzt in der Lehrerschaft eingebunden waren und auch Funktionen in den Jugendorganisationen wahrnahmen, hatten dadurch weniger Unterrichtsstunden zu leisten. Teilweise gehörten auch die Staatsbürgerkundelehrer dazu, die Pionierleiter usw. Wir Fachlehrer empfanden das deshalb nicht als ungerecht, weil diese Lehrer sich eben mit solchen Planungen befassen mussten. Die Schülerbetreuung außerhalb des Unterrichts war also neben dem Unterricht ein gleich behandeltes Thema. Die Pionierorganisationen mussten neben ihren politischen Zielen, die sie vertraten auch den sozialen Anspruch der Kinderbetreuung wahrnehmen. Die Klassenlehrer waren natürlich ebenfalls gefragt. Sie konnten und sollten sich mit einbringen. Dazu kam ein Gremium aus Eltern, der sogenannte Elternbeirat. Hier bestand eine ganz enge Zusammenarbeit. Das wird oft unterschlagen. Die war in Wirklichkeit genauso vertraut und eng wie heute. Das hieß, dass man gemeinsam mit dem Elternbeirat für die Klasse die Probleme löste und z.B. auch Klassenfahrten und dergleichen plante. Eine Klassenfahrt musste stattfinden, nicht so wie heute, dass dort auch mal nicht gefahren wird, weil der Lehrer keine Lust hatte oder weil die Eltern nicht genug Geld hatten. Einer Klassenfahrt wurde neben der Wissensvermittlung ein hoher pädagogischer Wert beigemessen. Kinder sollten lernen, miteinander auszukommen und zwar in einer anderen Atmosphäre als dem Schulalltag. Die Ziele, die sich für die Klassenfahrten ausgesucht worden sind, entsprachen zum Teil auch dem Wissensinhalt des Schuljahres. Da wurde nicht einfach irgendwo hingefahren, um für 2 Wochen die Badehose anzuziehen, da wurde auch weiterhin Wissen vermittelt. Ich selbst musste kurz nach der Wende plötzlich sehr komplizierte Begründungen schreiben, ich weiß nicht, wer da hysterischer war, die Beamten aus dem Westen oder die „neuen“ Beamten aus dem Osten. Das war schrecklich, denn dazwischen zerrieb man den Lehrer. Die Kardinalfrage von heute ist ja auch immer wieder die Finanzierung, das spielte damals keine große Rolle.
Ich habe immer versucht, mit einer 9. Klasse nach Weimar zu fahren, das war mir als Deutschlehrer sehr wichtig. Heute fragt man ja die Schüler: Wo wollt ihr denn hinfahren?, und dann sagen die: Nach Barzelona!, und nicht nach Weimar. Aber da ärgere ich mich nicht mehr drüber. Die Fahrten nach Weimar jedoch waren mir sehr wichtig, da habe ich alles eingesetzt. Die Kinder waren da anfangs nie sehr glücklich aber im Verlauf der Reise, konnten sie soviel mitnehmen, sie haben soviel gesehen und gelernt und sie waren im richtigen Alter, um das auch genießen zu können. Vorher oder nachher habe ich mich nie anders gefühlt. Es war immer das Gleiche, auch die organisatorischen Sachen. Wir konnten entweder ein Elternteil oder einen weiteren Lehrer als zweiten Erziehungsberechtigten mitnehmen. Wir haben damals weniger Kollegen mitgenommen, denn diese sollten ja nicht raus dem Unterricht. Deshalb sind immer Elternteile mitgefahren.
Die vorher erschienenen gibt es hier: Teil I und Teil II
3. Wie gestaltete sich die Organisation von Klassenfahrten und inwieweit konnte der Alltag der Schüler in den Ferien mitgestaltet werden? Wer machte was?
Im Prinzip war das eine ganz einfache Sache. Ich bekomme jetzt vielleicht die Altersgruppen nicht mehr so zusammen, aber es gab ja für die jüngeren Schüler die Ferienspiele. Die wurden angeboten – ich glaube so etwas gibt es jetzt auch wieder - für die kleineren Schüler. Die Gruppierungen sind heute noch genauso. Heute heißt es auch Hort. Ich bin mir nicht sicher, ob die Mittelstufe da noch mit dabei war. Für die größeren Schüler wurde ebenfalls eine Ferienplanung angeboten, Veranstaltungen zu denen man sich traf. Da musste man sich vorher anmelden und einen geringen Obolus bezahlen und dann konnten die Schüler während der Ferien in der Schule betreut werden.
Mit der 8. Klasse jedoch hörte das auf. Die 9. und 10. Klasse konnte aber mit einbezogen werden, wenn sie Lust dazu hatten, natürlich ohne Bezahlung. Mehr habe ich persönlich als Ferienbetreuung nicht kennengelernt, ich bin ja erst 1980 Lehrerin geworden. In meiner Kindheit war das ähnlich, deshalb kann ich dazu nicht so viel sagen.
In Wirklichkeit hatte das weniger einen politischen Hintergrund, und dass das FDJ und Pionierorganisationen machten, war nur aus organisatorischen Gründen so – Arbeitsteilung eben. Und diese Leute, die jetzt in der Lehrerschaft eingebunden waren und auch Funktionen in den Jugendorganisationen wahrnahmen, hatten dadurch weniger Unterrichtsstunden zu leisten. Teilweise gehörten auch die Staatsbürgerkundelehrer dazu, die Pionierleiter usw. Wir Fachlehrer empfanden das deshalb nicht als ungerecht, weil diese Lehrer sich eben mit solchen Planungen befassen mussten. Die Schülerbetreuung außerhalb des Unterrichts war also neben dem Unterricht ein gleich behandeltes Thema. Die Pionierorganisationen mussten neben ihren politischen Zielen, die sie vertraten auch den sozialen Anspruch der Kinderbetreuung wahrnehmen. Die Klassenlehrer waren natürlich ebenfalls gefragt. Sie konnten und sollten sich mit einbringen. Dazu kam ein Gremium aus Eltern, der sogenannte Elternbeirat. Hier bestand eine ganz enge Zusammenarbeit. Das wird oft unterschlagen. Die war in Wirklichkeit genauso vertraut und eng wie heute. Das hieß, dass man gemeinsam mit dem Elternbeirat für die Klasse die Probleme löste und z.B. auch Klassenfahrten und dergleichen plante. Eine Klassenfahrt musste stattfinden, nicht so wie heute, dass dort auch mal nicht gefahren wird, weil der Lehrer keine Lust hatte oder weil die Eltern nicht genug Geld hatten. Einer Klassenfahrt wurde neben der Wissensvermittlung ein hoher pädagogischer Wert beigemessen. Kinder sollten lernen, miteinander auszukommen und zwar in einer anderen Atmosphäre als dem Schulalltag. Die Ziele, die sich für die Klassenfahrten ausgesucht worden sind, entsprachen zum Teil auch dem Wissensinhalt des Schuljahres. Da wurde nicht einfach irgendwo hingefahren, um für 2 Wochen die Badehose anzuziehen, da wurde auch weiterhin Wissen vermittelt. Ich selbst musste kurz nach der Wende plötzlich sehr komplizierte Begründungen schreiben, ich weiß nicht, wer da hysterischer war, die Beamten aus dem Westen oder die „neuen“ Beamten aus dem Osten. Das war schrecklich, denn dazwischen zerrieb man den Lehrer. Die Kardinalfrage von heute ist ja auch immer wieder die Finanzierung, das spielte damals keine große Rolle.
Ich habe immer versucht, mit einer 9. Klasse nach Weimar zu fahren, das war mir als Deutschlehrer sehr wichtig. Heute fragt man ja die Schüler: Wo wollt ihr denn hinfahren?, und dann sagen die: Nach Barzelona!, und nicht nach Weimar. Aber da ärgere ich mich nicht mehr drüber. Die Fahrten nach Weimar jedoch waren mir sehr wichtig, da habe ich alles eingesetzt. Die Kinder waren da anfangs nie sehr glücklich aber im Verlauf der Reise, konnten sie soviel mitnehmen, sie haben soviel gesehen und gelernt und sie waren im richtigen Alter, um das auch genießen zu können. Vorher oder nachher habe ich mich nie anders gefühlt. Es war immer das Gleiche, auch die organisatorischen Sachen. Wir konnten entweder ein Elternteil oder einen weiteren Lehrer als zweiten Erziehungsberechtigten mitnehmen. Wir haben damals weniger Kollegen mitgenommen, denn diese sollten ja nicht raus dem Unterricht. Deshalb sind immer Elternteile mitgefahren.
Shhhhh - 13. Jul, 12:38