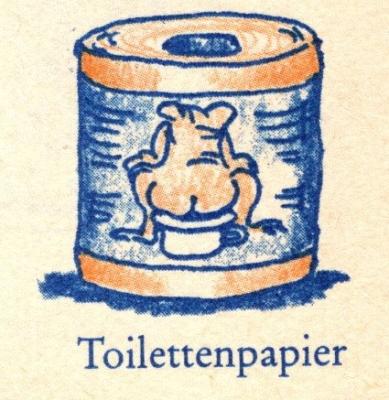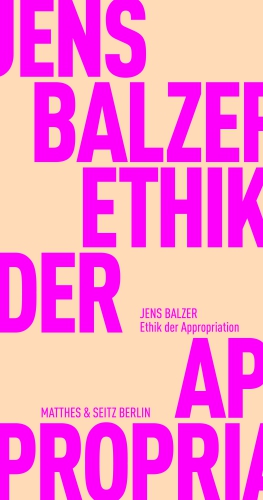Als ich die letzten Fußgänger umfahren (nicht umgefahren) hatte, die letzte Ecke, um die ich noch herum musste, in Sichtweite kam, nahm ich während des Radfahrens mein Smartphone aus der Tasche, um auf die Uhr zu sehen. 19:33. Machtergreifung, schoss es mir durch den Kopf. Die letzte Ecke war umfahren, ich schloss das Rad an und sah die Stufen hinauf in die leere Eingangshalle. Alle waren bereits drin, ich war zu spät. Egal, dachte ich und drehte mir eine Zigarette.
Als ich die Tür zum Vortragsraum öffnen wollte, war sie verschlossen. Sogleich kam die Dame am Getränke- und Büchertresen angestürmt und öffnete mir. Das Gespräch, die Lesung hatte bereits begonnen. Gern hätte ich mir noch ein Bier gekauft, musste stattdessen mein Ticket vorzeigen und traute mich dann nicht mehr. Geduckt lief ich durch die Reihen des rechten oberen Teilstücks des T. Die Zuschauer links vom Podium sahen mich kommen, die rechts davon sahen mich gehen. Ich bog links ab, weil ich mir im unteren Bereich des T ein bekanntes Gesicht und eine freien Sitzplatz erhoffte. Das T ergab sich aus der dritten Bestuhlung, die in Front zum Podium aufgebaut war.
Beides war dort vorhanden, bekannte Gesichter und freie Plätze. Vorletzte Reihe links nahm ich Platz. Vor mir ein Mann mit weißem Haar, unglücklicherweise meine Größe. Ich musste mit jeder seiner Bewegungen mitgehen, um das Podium sehen zu können. Direkt hinter mir saß zu Anfang noch jemand, später war er weg. Ich konnte es ihm nicht verübeln. Der arme Kerl wurde ja nun von beiden Seiten seines Sichtbereiches beraubt.
Als Alban Nikolai Herbst endlich zu lesen begann, waren schon etliche Positionswechsel vollzogen. Die Moderatorin führte ausführlichst ein. Überhaupt hatte ich den Eindruck, dass sie vieles in Watte packte, lieber umschrieb, als direkt herausrücken zu wollen. Herbst ging darauf ein oder nicht, wie man’s nimmt. Manche Dinge beantwortete er einfach nicht, anderes vergaß er vielleicht, und wiederum andere Dinge ergaben sich plötzlich anders, so dass die Antwort gegeben schien.
Als Alban Nikolai Herbst endlich zu lesen begann, war es nicht
Traumschiff, sondern ein Gedicht. Ich habe meine Schwierigkeiten mit Gedichten, vor allem, wenn sie vorgetragen werden und ich nicht wenigstens mitlesen kann, wenn sich nichts reimt, wenn mir der Inhalt zu verklausuliert herüberkommt. Ich nahm etwas mit, der Abend war noch jung, ich war hochkonzentriert, ich glaube, es reimte sich sogar manchmal. Eine Ahnung überkam mich, wie das Gedicht mit dem Werk in Verbindung stand. Da rüttelte was an meinem Geist, dann war es vorüber und ich war noch nicht fertig. Wenigstens hatte ich in der Zeit freie Sicht, weil mein Vordermann durch übermäßiges Nicken und Kopfschütteln vergessen hatte, dass sein Weinglas zu seinen Füßen stand, ein wenig davon verschüttete und sich nun daran gemacht hatte, mit Papiertaschentüchern das Malheur zu beseitigen.
Traumschiff. Ein merk-würdiges Buch. Wenn es vorgetragen wird, noch dazu von einem so ausgezeichneten Vorleser wie Herbst, wenn die Passagen bekannt sind, weil schon einmal selbst gelesen, dann offenbart sich eine Schönheit in jedem Satz, nein, ein Geheimnis, dann gelingt plötzlich, wofür vorher ganze Seiten nötig gewesen waren, dann setzt ein Versinken ein, augenblicklich. Das ging dem gesamten Publikum so, hatte ich das Gefühl. Wenn mein Vordermann nur nicht ständig nicken oder den Kopf schütteln würde. Ich zückte mein Notizbuch und schrieb etwas rein, vom Nicken und Schütteln. Meine Nachbarin, eine Kommilitonin aus unserem Seminar, schielte neugierig zu mir herüber. Ich verwies auf den Checker vor mir, sie grinste. Der Platz vor ihr war leer.
Es folgte eine zweite Moderationsphase und nach einer weiteren Schiffsreise ein erneutes Gedicht. Hexameter, für die ich irgendwie ein Gefühl bekam, wenngleich ich sie nicht erkannt hätte, ANH kündigte das vorher an. Es schaukelten mich die Wellen der Betonung. Nur dem Inhalt, dem konnte ich nicht folgen. Schon wieder beschlich mich plötzlich das Gefühl, es reimte sich etwas, dann war es wieder weg. Es folgte eine harte, von Konsonantenclustern geprägte Phase, ein rirtschirsirrirsirtsch, der Reim war reines Wunschdenken, dachte ich mir nun und hoffte auf das Ende. Ich schaltete ab. Ich gab auf fürs Erste. Währenddessen schrieb mir eine andere Studentin aus unserem Kurs ein paar aufgeschnappte Zitate per WhatsApp. Gut dachte, wo ich doch selbst so liederlich in mein Notizbuch kritzelte.
Statt ihn zu fragen, was er als nächstes vorhabe, holte die Moderatorin nun ganz weit aus, wollte ANH nach seinem lyrischen Winter fragen, dachte vielleicht, und nicht zu Unrecht, denn Gedichtbearbeitungen sind ja nicht selten Thema gewesen in den letzten Arbeitsjournalen, jetzt kommt am Ende noch die Lyrik und dann ab aufs Schiff. Aber ANH bügelte das ab. So wäre das nicht. Das könne er doch jetzt noch nicht wissen, da gäbe es einiges, sicher, auch Lyrik, bestimmt.
Das Publikum durfte im Anschluss fragen. Es gab kein Mikro zu Anfang, die Frage kam aus dem linken oberen Balken des T. Ich versuchte, so gut es ging, um die Ecke zu hören, denn zwischen uns lag eine Wand. Nicht möglich. Als das Mikro dann endlich da war, war’s mir egal. ANH las dann noch einmal. Eine wirklich schöne Szene. Ich erkannte sie sofort, stieß meine Nachbarin an. Das ist doch die Szene mit dem „wir“, mit dem echten „wir“, als der Protagonist das Bett einsaut und seine Pflegerin nicht nur vom „wir“ spricht, sondern ihn und sich selbst auch als ein „wir“ betrachtet. Meine Nachbarin nickte und freute sich ebenfalls. Plötzlich ging wieder was, es wurde noch einmal richtig intensiv, ich war wieder im Spiel, dann war’s vorbei. Schön war’s.
Wir gingen noch etwas trinken, ein paar aus unserem Kurs. Unser Dozent kam nicht mit, dafür ANH, seine erste Verlegerin. „Marlboro“, das Buch, welches ich mir neben dem Traumschiff noch signieren ließ. Die Moderatorin kam nach. In einem freien Moment fragte ich ANH wie er das gemacht hätte, das Buch in einem Monat zu schreiben. Ob man dafür am Folgetag noch einmal eine kleine Lektüre anschließt, um wieder in den Text zu kommen. Er verneinte, dafür wäre keine Zeit gewesen. Seine Antwort schweifte ab, und ich war nicht zufrieden, weil ich nicht wissen wollte, wie er vorging, sondern wie es in ihm vorging, wie sich so ein Flow entwickelt, ob da eine Stimmung ist oder ein Schalter, den er umlegen würde. Ich bekam dadurch ein Gefühl dafür, wie schwer es sein muss, Fragen zu formulieren, deren Antwort nicht für einen selbst sind, sondern für ein gesamtes Publikum, wo ich doch selbst kaum in der Lage war, eine Frage zu stellen, deren Antwort mich befriedigt. Das ließ mich anders über die Moderatorin denken.
Wir redeten noch eine ganze Weile, dann dünnte sich die Versammlung aus. Wir Übriggebliebenen wurden wenig später hinaus komplimentiert. Abschied. Ich vergaß, mich von ANHs erster Verlegerin zu verabschieden und ärgerte mich darüber für den Rest der Wachzeit und bis in die nächste hinein. Zu Haus schrieb ich einen ersten Entwurf für mein Blog. In meinem Ärger über meinen flegelhaften Abgang, begann ich den Text mit: „Ich bin so ein Flegel!“ und endete mit: „Was für ein Flegel!“
Egal, mit ANH an einem Tisch war ich schon vorher Flegel: er setzte sich nicht, bevor nicht die Frauen saßen, half ihnen aus und in die Mäntel, rückte Stühle und positionierte jeden Gast einzeln und mehrmals um und um sich herum, bis alle zufrieden waren oder so taten. Ich staunte derweil, guckte nur, hatte mich selbst kaum bewegt. Auf einen dezenten Hinweis hin - kam der von ihm? - holte ich meiner Sitznachbarin einen neuen Stuhl, der alte war irgendwie verschwunden. Wir waren wie ein alter Hund, drehend und ausprobierend, was nun die beste Lage sei, bis wir endlich alle saßen! Ach, ja!