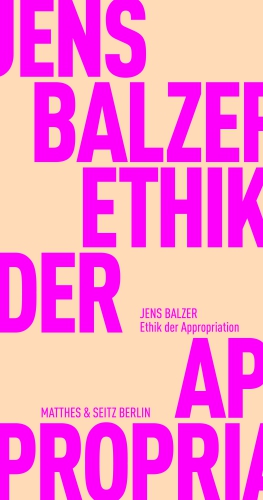Katastrophentourismus
Diesmal durchaus ernsthaft, obwohl meine Rubrik "Wort für Wort" sonst nicht ohne Ironie auskommt, habe ich mich diesem Begriff gewidmet. Der Text ist ziemlich lang geworden, sicherlich ein Manko aber kürzer ging es wirklich nicht.
Man könnte meinen, die weißen Flecken auf der Landkarte sind dem Weiß im weitaufgerissenen Auge gewichen, betrachtet man die vielen Facetten, denen unser Auge in der Fremde ausgesetzt ist. Sandy, ein Wirbelsturm immensen Ausmaßes, tobte gerade über die Westküste der USA, hat zuvor bereits die Karibik verwüstet, Todesopfer gefordert, und doch oder gerade deswegen übt eine solche Naturgewalt genügend Faszination auf uns Menschen aus, Berichten in Funk, Fernsehen und Internet gebannt zu folgen. Reporter im Auge des Sturms, Liveschaltungen, Webcams sind nur ein paar der Beispiele, wie wir uns die Katastrophe ins Wohnzimmer holen; Eindrücke in Echtzeit. Menschen pilgern in Scharen zu einem Ozeanriesen, der schlagseitig vor der italienischen Küste liegt, wo ebenfalls Menschen gestorben sind. In strahlungssicheren Anzügen stapfen Menschen über verseuchten Boden, um sich ein Bild zu machen von einer Gewalt, die Menschen entfesselt haben aber nicht kontrollieren konnten, noch immer nicht.
Doch was hat das alles mit dem Tourismus zu tun, könnte man da fragen? Und ist diese Form des Extremtourismus – was für mich persönlich die wichtigere Frage darstellt – ein heutiges Phänomen, das zu Recht oder zu Unrecht Empörung auslöst? Und welchen Anteil hat die zunehmende globale Vernetzung daran?
Tour, seit dem 17. Jh. in der deutschen Sprache belegt, leitet sich ab aus dem Französischen. Auch im Englischen findet sich ein solcher Begriff, doch die Ableitung aus dem Französischen liegt näher, denn zur Zeit des Sonnenkönigs, als an Höfen in ganz Europa französisch gesprochen wurde, wird neben dem Wort selbst auch die Bedeutung unverändert importiert und setzt sich deshalb von einem heutzutage gleichbedeutenden Wort ab, dass zu dieser Zeit längst nicht das Gleiche aussagte: die Reise. Während nämlich die Reise durchaus als Überwindung einer Entfernung gesehen werden kann, ohne dass der Reisende die gleiche Strecke auch wieder zurück unternimmt, ist im Wort Tour, aus dem der Begriff Tourismus hervorgegangen ist, durchaus eine Wiederkehr an den Ausgangsort angelegt. Die Wurzeln von Tour liegen nämlich im Griechischen tornus (heute noch bekannt und verwandt mit dem Turnus), was so viel wie Dreheisen bedeutete und ein Eisen beschreibt, dass sich auf einer Kreisbahn um einen Punkt, eine Achse o.ä. fortbewegt. Der Zweck einer solchen Unternehmung, also einer Tour im 17. Jh., lag in der Zerstreuung, so stelle ich mir das vor, und deshalb ist die Verbindung zum französischen Hof auch naheliegender denn zum englischen Pendant. Der Tourismus als Begriff der Reise, mitnichten gefahrlos, daran hatte der Engländer aber wahrscheinlich keinen unmaßgeblichen Einfluss. So gibt es Zeugnisse von Rheintourismus durch adlige Engländer, die sich bewusst auf den Weg machten, um sich auf die Spuren der Burgenromantik zu begeben, und es gibt ebenfalls bereits im 19. Jh. den Alpentourismus, der ebenfalls von Engländern unternommen wurde. Daran können sogleich zwei Facetten des Tourismus, sogar des Heutigen, in Augenschein genommen werden, die eine Antwort auf die Frage der Intention geben. Zum einen ist es die Erweiterung des geistigen Horizonts, genauer das Nacherleben von Empfindung vor Ort wie sie zuvor in Büchern und anderen Medien wahrgenommen wurde. Und zum anderen die bewusste Exposition einer Gefahr für Leib und Leben, sozusagen die Grenzerfahrung. Natürlich darf hier keine strikte Trennung erfolgen, denn es kann sowohl nur eins von beidem als auch beides zusammen Grund für eine „Tour“ sein.
Der Tourismus an sich umfasst ja auch längst nicht mehr nur den Bereich, der den Reisenden direkt betrifft, sondern auch Maßnahmen, die diese Reise erst ermöglichen, zum Beispiel Gasthäuser, Reiseführer oder Menschen, die die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellen und an Ort und Stelle bereit stehen. Aus dieser anfangs sicherlich eher spärlichen Peripherie um den Tourismusbegriff ist im Laufe des 20. Jh. eine ganze Industrie gewachsen. Längst ist diese Industrie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und es entstanden Orte, Sehenswürdigkeiten die allein zum Zwecke der Ansicht und des Besuchs errichtet worden sind, die auf Touristen abzielen.
Es gibt aber auch – und das rekuriert wieder auf die zuvor genannten Intentionen – einen Tourismus, der so gar nichts mit dem gemein hat, was sich der Mensch unter dem Tourismusbegriff vorstellt und auf den ersten Blick wenig damit zu haben scheint. Im Alpentourismus der Engländer klang es bereits an, es geht um die Grenzerfahrung. Auch hier muss unterschieden werden, denn Grenzerfahrung ist nicht gleich Grenzerfahrung. Während nämlich das Besteigen des Mont Blanc durchaus als Höchstleistung gelten kann und ein nicht unbeträchtliches Gefahrenpotential für die eigene „heile Haut“ darstellt, kam es bereits früh – die Rede ist vom Ende des 17. und Anfang des 18. Jh. – zu einem weiteren Grenzgang, bei dem die persönliche Gefahr nicht höher war, als beim Überqueren einer Straße. In der Literatur ist diese Art des „Tourismus“ durch nicht wenige Zeugnisse belegt. Zum Beispiel kam man als wohlsituierter Besucher Londons Ende des 18. Jh. nicht um den Besuch Bedlams herum, einer Irrenanstalt, die sich sogar darauf eingerichtet hatte, Besucher zu empfangen und dafür Geld zu nehmen. In anderem Zusammenhang schrieb auch Kleist darüber, ebenso Klingemann oder Musil. Geprägt haben den Begriff des „Irrenhaustourismus“ Reuchlein und Košenina. Vor allem Letzterer ist mir in dieser Thematik im Gedächtnis geblieben, weil seine Erklärung und Einordnung in Anbetracht des aufgeklärten und nach Aufklärung strebenden Menschen, der sich in dieser Zeit selbst in den Mittelpunkt stellt und nicht nur das Normale, den Durchschnitt erfassen will, sondern gerade am Extrem interessiert ist, eine schlüssige Erklärung für die Beweggründe liefert.
Der Neuentdeckung des Menschen könnte sich also nahtlos die Neuentdeckung des Extremereignisses anschließen, wenn sich nicht beides im Tourismusbegriff der Gegenwart bereits gefunden und die Vermischung nicht schon viel früher stattgefunden hätte. Einen Irrenhaustourismus, sofern man nicht Angehörige besucht, gibt es heute nicht mehr, aus gut verständlichen Gründen. Was es aber weiterhin gibt, ist der Katastrophentourimus. Denn während die letzten 2 Jahrhunderte genügend Aufschluss über das Seelenleben des Menschen gegeben haben und auch die Rücksicht der Interessen aller Menschen solche Reisen verbieten, hat die Katastrophe, in welcher Form auch immer sie vorliegt, nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Selbst ein Urteil darüber, wie es sicherlich dazu beigetragen hat, dass es den Irrenhaustourismus heute nicht mehr gibt, haben Menschen bereits recht früh darüber angestellt. Karl Kraus reagierte bereits 1921 auf die in seinen Augen wohl geschmacklose Anzeige der Basler Zeitung, Menschen an die Schlachtstätte Verdun zu führen und dabei Kost und Logis anzubieten. 117 Franken sollte seinerzeit die völlig „ungefährliche Tour“ kosten. Wenn es einen Ort der Varusschlacht gäbe – und nicht 4 oder 5 vermeintliche – würde dies niemanden bestürzen, wenn plötzlich alle Welt dort hinginge. Die Zahl der Besucher insgesamt ging in New York natürlich zurück nach 9/11, aber die Stadt wurde um eine makabre Attraktion reicher, die höchstwahrscheinlich den am häufigsten besuchten Ort in der Großmetropole darstellte in den darauf folgenden Jahren.
Umso länger die zeitliche Distanz zum Extremereignis liegt, desto geringer scheint auch der Grad Aufregung über den Touristen zu sein, der sich sein Reiseziel unter diesen Gesichtspunkten aussucht. Diese Beispiele unter dem Aspekt der schlichten Lust nach Sensation abzutun, könnte die kurzfristigen missbilligenden Reaktionen, wie sie oft in der Zeitung nachzulesen sind, plausibel machen. Auf längere Sicht betrachtet, liegt dem aber eher ein tiefes Unverständnis zugrunde, was von solchen Ereignissen ausgeht, sei es nun die Naturgewalt, die wir in ihrer Gänze längst nicht verstehen oder ob wir Menschen es selbst sind, die mit ungeheuerlichen Taten solche Ereignisse entstehen lassen. Neu ist weder das Eine noch das Andere. Das einzig Neue daran ist, dass der Mensch durch den gesteigerten Informationsfluss viel schneller darauf reagieren kann, als er es vor 50 Jahren noch konnte. Auch gab es gerade in puncto Gefahr für das eigene Leben, kein adäquates Mittel, trotzdem am Ort des Geschehens zu sein. Abhilfe schaffen das Radio, das Fernsehen, das Internet, in dieser Reihenfolge nicht nur dem Auftreten nach, sondern auch am Grad der Intensivierung bzw. Unmittelbarkeit gemessen. Und auch die kurzfristigen Reaktionen darauf fallen einfach häufiger aus, nicht aber anders als schon vor 100 Jahren.
Man könnte meinen, die weißen Flecken auf der Landkarte sind dem Weiß im weitaufgerissenen Auge gewichen, betrachtet man die vielen Facetten, denen unser Auge in der Fremde ausgesetzt ist. Sandy, ein Wirbelsturm immensen Ausmaßes, tobte gerade über die Westküste der USA, hat zuvor bereits die Karibik verwüstet, Todesopfer gefordert, und doch oder gerade deswegen übt eine solche Naturgewalt genügend Faszination auf uns Menschen aus, Berichten in Funk, Fernsehen und Internet gebannt zu folgen. Reporter im Auge des Sturms, Liveschaltungen, Webcams sind nur ein paar der Beispiele, wie wir uns die Katastrophe ins Wohnzimmer holen; Eindrücke in Echtzeit. Menschen pilgern in Scharen zu einem Ozeanriesen, der schlagseitig vor der italienischen Küste liegt, wo ebenfalls Menschen gestorben sind. In strahlungssicheren Anzügen stapfen Menschen über verseuchten Boden, um sich ein Bild zu machen von einer Gewalt, die Menschen entfesselt haben aber nicht kontrollieren konnten, noch immer nicht.
Doch was hat das alles mit dem Tourismus zu tun, könnte man da fragen? Und ist diese Form des Extremtourismus – was für mich persönlich die wichtigere Frage darstellt – ein heutiges Phänomen, das zu Recht oder zu Unrecht Empörung auslöst? Und welchen Anteil hat die zunehmende globale Vernetzung daran?
Tour, seit dem 17. Jh. in der deutschen Sprache belegt, leitet sich ab aus dem Französischen. Auch im Englischen findet sich ein solcher Begriff, doch die Ableitung aus dem Französischen liegt näher, denn zur Zeit des Sonnenkönigs, als an Höfen in ganz Europa französisch gesprochen wurde, wird neben dem Wort selbst auch die Bedeutung unverändert importiert und setzt sich deshalb von einem heutzutage gleichbedeutenden Wort ab, dass zu dieser Zeit längst nicht das Gleiche aussagte: die Reise. Während nämlich die Reise durchaus als Überwindung einer Entfernung gesehen werden kann, ohne dass der Reisende die gleiche Strecke auch wieder zurück unternimmt, ist im Wort Tour, aus dem der Begriff Tourismus hervorgegangen ist, durchaus eine Wiederkehr an den Ausgangsort angelegt. Die Wurzeln von Tour liegen nämlich im Griechischen tornus (heute noch bekannt und verwandt mit dem Turnus), was so viel wie Dreheisen bedeutete und ein Eisen beschreibt, dass sich auf einer Kreisbahn um einen Punkt, eine Achse o.ä. fortbewegt. Der Zweck einer solchen Unternehmung, also einer Tour im 17. Jh., lag in der Zerstreuung, so stelle ich mir das vor, und deshalb ist die Verbindung zum französischen Hof auch naheliegender denn zum englischen Pendant. Der Tourismus als Begriff der Reise, mitnichten gefahrlos, daran hatte der Engländer aber wahrscheinlich keinen unmaßgeblichen Einfluss. So gibt es Zeugnisse von Rheintourismus durch adlige Engländer, die sich bewusst auf den Weg machten, um sich auf die Spuren der Burgenromantik zu begeben, und es gibt ebenfalls bereits im 19. Jh. den Alpentourismus, der ebenfalls von Engländern unternommen wurde. Daran können sogleich zwei Facetten des Tourismus, sogar des Heutigen, in Augenschein genommen werden, die eine Antwort auf die Frage der Intention geben. Zum einen ist es die Erweiterung des geistigen Horizonts, genauer das Nacherleben von Empfindung vor Ort wie sie zuvor in Büchern und anderen Medien wahrgenommen wurde. Und zum anderen die bewusste Exposition einer Gefahr für Leib und Leben, sozusagen die Grenzerfahrung. Natürlich darf hier keine strikte Trennung erfolgen, denn es kann sowohl nur eins von beidem als auch beides zusammen Grund für eine „Tour“ sein.
Der Tourismus an sich umfasst ja auch längst nicht mehr nur den Bereich, der den Reisenden direkt betrifft, sondern auch Maßnahmen, die diese Reise erst ermöglichen, zum Beispiel Gasthäuser, Reiseführer oder Menschen, die die nötige Ausrüstung zur Verfügung stellen und an Ort und Stelle bereit stehen. Aus dieser anfangs sicherlich eher spärlichen Peripherie um den Tourismusbegriff ist im Laufe des 20. Jh. eine ganze Industrie gewachsen. Längst ist diese Industrie ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und es entstanden Orte, Sehenswürdigkeiten die allein zum Zwecke der Ansicht und des Besuchs errichtet worden sind, die auf Touristen abzielen.
Es gibt aber auch – und das rekuriert wieder auf die zuvor genannten Intentionen – einen Tourismus, der so gar nichts mit dem gemein hat, was sich der Mensch unter dem Tourismusbegriff vorstellt und auf den ersten Blick wenig damit zu haben scheint. Im Alpentourismus der Engländer klang es bereits an, es geht um die Grenzerfahrung. Auch hier muss unterschieden werden, denn Grenzerfahrung ist nicht gleich Grenzerfahrung. Während nämlich das Besteigen des Mont Blanc durchaus als Höchstleistung gelten kann und ein nicht unbeträchtliches Gefahrenpotential für die eigene „heile Haut“ darstellt, kam es bereits früh – die Rede ist vom Ende des 17. und Anfang des 18. Jh. – zu einem weiteren Grenzgang, bei dem die persönliche Gefahr nicht höher war, als beim Überqueren einer Straße. In der Literatur ist diese Art des „Tourismus“ durch nicht wenige Zeugnisse belegt. Zum Beispiel kam man als wohlsituierter Besucher Londons Ende des 18. Jh. nicht um den Besuch Bedlams herum, einer Irrenanstalt, die sich sogar darauf eingerichtet hatte, Besucher zu empfangen und dafür Geld zu nehmen. In anderem Zusammenhang schrieb auch Kleist darüber, ebenso Klingemann oder Musil. Geprägt haben den Begriff des „Irrenhaustourismus“ Reuchlein und Košenina. Vor allem Letzterer ist mir in dieser Thematik im Gedächtnis geblieben, weil seine Erklärung und Einordnung in Anbetracht des aufgeklärten und nach Aufklärung strebenden Menschen, der sich in dieser Zeit selbst in den Mittelpunkt stellt und nicht nur das Normale, den Durchschnitt erfassen will, sondern gerade am Extrem interessiert ist, eine schlüssige Erklärung für die Beweggründe liefert.
Der Neuentdeckung des Menschen könnte sich also nahtlos die Neuentdeckung des Extremereignisses anschließen, wenn sich nicht beides im Tourismusbegriff der Gegenwart bereits gefunden und die Vermischung nicht schon viel früher stattgefunden hätte. Einen Irrenhaustourismus, sofern man nicht Angehörige besucht, gibt es heute nicht mehr, aus gut verständlichen Gründen. Was es aber weiterhin gibt, ist der Katastrophentourimus. Denn während die letzten 2 Jahrhunderte genügend Aufschluss über das Seelenleben des Menschen gegeben haben und auch die Rücksicht der Interessen aller Menschen solche Reisen verbieten, hat die Katastrophe, in welcher Form auch immer sie vorliegt, nichts von ihrer Faszination eingebüßt. Selbst ein Urteil darüber, wie es sicherlich dazu beigetragen hat, dass es den Irrenhaustourismus heute nicht mehr gibt, haben Menschen bereits recht früh darüber angestellt. Karl Kraus reagierte bereits 1921 auf die in seinen Augen wohl geschmacklose Anzeige der Basler Zeitung, Menschen an die Schlachtstätte Verdun zu führen und dabei Kost und Logis anzubieten. 117 Franken sollte seinerzeit die völlig „ungefährliche Tour“ kosten. Wenn es einen Ort der Varusschlacht gäbe – und nicht 4 oder 5 vermeintliche – würde dies niemanden bestürzen, wenn plötzlich alle Welt dort hinginge. Die Zahl der Besucher insgesamt ging in New York natürlich zurück nach 9/11, aber die Stadt wurde um eine makabre Attraktion reicher, die höchstwahrscheinlich den am häufigsten besuchten Ort in der Großmetropole darstellte in den darauf folgenden Jahren.
Umso länger die zeitliche Distanz zum Extremereignis liegt, desto geringer scheint auch der Grad Aufregung über den Touristen zu sein, der sich sein Reiseziel unter diesen Gesichtspunkten aussucht. Diese Beispiele unter dem Aspekt der schlichten Lust nach Sensation abzutun, könnte die kurzfristigen missbilligenden Reaktionen, wie sie oft in der Zeitung nachzulesen sind, plausibel machen. Auf längere Sicht betrachtet, liegt dem aber eher ein tiefes Unverständnis zugrunde, was von solchen Ereignissen ausgeht, sei es nun die Naturgewalt, die wir in ihrer Gänze längst nicht verstehen oder ob wir Menschen es selbst sind, die mit ungeheuerlichen Taten solche Ereignisse entstehen lassen. Neu ist weder das Eine noch das Andere. Das einzig Neue daran ist, dass der Mensch durch den gesteigerten Informationsfluss viel schneller darauf reagieren kann, als er es vor 50 Jahren noch konnte. Auch gab es gerade in puncto Gefahr für das eigene Leben, kein adäquates Mittel, trotzdem am Ort des Geschehens zu sein. Abhilfe schaffen das Radio, das Fernsehen, das Internet, in dieser Reihenfolge nicht nur dem Auftreten nach, sondern auch am Grad der Intensivierung bzw. Unmittelbarkeit gemessen. Und auch die kurzfristigen Reaktionen darauf fallen einfach häufiger aus, nicht aber anders als schon vor 100 Jahren.
Shhhhh - 31. Okt, 13:47