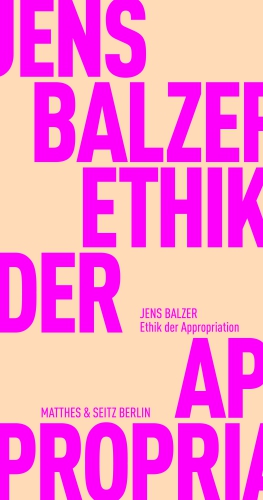Arbeitsgrammatik
Heute Morgen um 7 fuhr ich nicht den gewohnten Weg entlang der Leine ins Theater, sondern, weil ich in einer anderen Gewohnheit drin war, einen anderen Weg. Es war aber auch nichts wie gewöhnlich und doch hat sich der Tag nicht unbedingt von anderen Arbeitstagen unterschieden. Komische Sache.
Das ging schon damit los, dass ich eine Viertelstunde zu früh da war. Der Weg am Leineufer entlang, vorbei am verschlafenen Ihmezentrum, durch die Holperstraße an der Glocksee mit ihren ewig neu entstehenden Graffitis, über die Straße, in der Karl Koch gewohnt hatte, ist nämlich nicht der direkteste aber der schönere Arbeitsweg. Heute fuhr ich über die Dornrößchenbrücke auf dem anderen Ufer, bog unter dem Schnellweg nicht ab in Richtung Glockseebahnhof, um ans Ufer zurück zu kommen, sondern fuhr die Skulpturenmeile entlang, die sich dem Königsworther Platz anschließt. Links stapeln sich die Legosteinchen, erst Contihochhaus, dann das Allianzgebäude und das Arbeitsamt. Rechts, wo ich unterwegs war, stehen ein paar ältere Stadtvillen hinter der massiven Rundung des Gewerkschaftshauses, bis sich ebenfalls ein paar Klötzer in den Blick schieben. Am Clevertor, fuhr ich bei Grün über die Ampel. An der Brücke über die Leine, schräg gegenüber der einzigen katholischen Kirche im alten Stadtkern Hannover, früher notwendig für die Kur, heute wohl eher Kür, fuhr ich bei Rot. Bis auf die wenigen Flohmarktbetreiber waren weder Menschen und erst recht keine Fahrzeuge unterwegs.
Als ich ankam, gab es bereits Kaffee und alle Kollegen waren schon da. Ungewöhnlich. Wir starteten auch nicht um zehn nach 7 wie üblich, sondern erst gegen 8. Auf die Frage, was wir denn zu tun hätten, gab es eine blumige Antwort, die besagte, dass es wohl nicht so viel sei. Weshalb wir da waren, also insgesamt drei Aushilfen, blieb rätselhaft. Auf dem Ballhof 1 angekommen – der Ballhof 2 schien fertig aufgebaut zu sein und aus nichts weiter als einem schwarzen Tanzboden zu bestehen, auf dem ein paar Scheinwerfer und Boxen standen – erwarteten uns drei Züge, an die wir mit hundert Schleifen drei weiße Vorhänge festzurrten. Dann kamen die Tontechniker und die Lichttechnik und die Requisite. Die Requisite war wohl ein Versehen, denn es wurde mir sehr schnell klar, dass nicht nur oben auf dem Ballhof 2, sondern auch unten auf der Hauptbühne nur getanzt werden würde. Und wo getanzt wird, gibt es Kulissen und Requisite in überschaubarer Zahl. Wir gingen deshalb kurze Zeit später wieder nach oben und frühstückten ausgiebig. Dann war ich zufällig gerade nicht da, als drei von uns – die beiden anderen Aushilfen waren dabei – abgeordert wurden. Ich blieb oben sitzen und betrachtete die Uhr, die wegen Batterieschwäche immer langsamer fortkroch. Zum Frühstück ging sie gerade einmal 10 Minuten nach, und ich vermutete, dass das einfach deshalb so war, weil das Frühstück ja auf der Bühne ausgerufen aber im Pausenraum beendet wurde, also 10 Minuten mehr Zeit zum Frühstücken blieb. Als es dann allerdings auf 12 zuging und die Uhr erst bei Viertel nach 11 stand, musste ich meine Theorie wieder verwerfen.
Gegen 1 rief ich einen Kumpel an, der den Dienstplan vor Augen hatte und mir sagte, dass wir nur bis 12 gebucht worden waren, da kam dann endlich ein weiterer Marschbefehl. Wir gingen nach unten, rollten 5 weiße Böden aus und nagelten und klebten die Kanten ab. Um 14 Uhr, als es nur noch darum ging, mit ein paar Bändern die Leinwand zu fixieren, fuhr ich nach Hause, total geschafft vom vielen Rumsitzen. Als ich mir das Geschriebene eben noch einmal durchlas, um eine abschließende, treffende Beschreibung des heutigen Arbeitstages abzugeben, fiel mir nicht s weiter ein, als der zweite Satz im zweiten Absatz. Er steht da mitten drin und eigentlich ist er nicht so wichtig, in seiner Struktur aber sehr ähnlich dem heutigen Schaffen: Hauptsatz ohne Prädikat und dann eine ewige Litanei, bis dann am Ende des langen Einschubs das für den Hauptsatz wichtige Verb kommt, aber eigentlich gar nichts passiert ist.
Das ging schon damit los, dass ich eine Viertelstunde zu früh da war. Der Weg am Leineufer entlang, vorbei am verschlafenen Ihmezentrum, durch die Holperstraße an der Glocksee mit ihren ewig neu entstehenden Graffitis, über die Straße, in der Karl Koch gewohnt hatte, ist nämlich nicht der direkteste aber der schönere Arbeitsweg. Heute fuhr ich über die Dornrößchenbrücke auf dem anderen Ufer, bog unter dem Schnellweg nicht ab in Richtung Glockseebahnhof, um ans Ufer zurück zu kommen, sondern fuhr die Skulpturenmeile entlang, die sich dem Königsworther Platz anschließt. Links stapeln sich die Legosteinchen, erst Contihochhaus, dann das Allianzgebäude und das Arbeitsamt. Rechts, wo ich unterwegs war, stehen ein paar ältere Stadtvillen hinter der massiven Rundung des Gewerkschaftshauses, bis sich ebenfalls ein paar Klötzer in den Blick schieben. Am Clevertor, fuhr ich bei Grün über die Ampel. An der Brücke über die Leine, schräg gegenüber der einzigen katholischen Kirche im alten Stadtkern Hannover, früher notwendig für die Kur, heute wohl eher Kür, fuhr ich bei Rot. Bis auf die wenigen Flohmarktbetreiber waren weder Menschen und erst recht keine Fahrzeuge unterwegs.
Als ich ankam, gab es bereits Kaffee und alle Kollegen waren schon da. Ungewöhnlich. Wir starteten auch nicht um zehn nach 7 wie üblich, sondern erst gegen 8. Auf die Frage, was wir denn zu tun hätten, gab es eine blumige Antwort, die besagte, dass es wohl nicht so viel sei. Weshalb wir da waren, also insgesamt drei Aushilfen, blieb rätselhaft. Auf dem Ballhof 1 angekommen – der Ballhof 2 schien fertig aufgebaut zu sein und aus nichts weiter als einem schwarzen Tanzboden zu bestehen, auf dem ein paar Scheinwerfer und Boxen standen – erwarteten uns drei Züge, an die wir mit hundert Schleifen drei weiße Vorhänge festzurrten. Dann kamen die Tontechniker und die Lichttechnik und die Requisite. Die Requisite war wohl ein Versehen, denn es wurde mir sehr schnell klar, dass nicht nur oben auf dem Ballhof 2, sondern auch unten auf der Hauptbühne nur getanzt werden würde. Und wo getanzt wird, gibt es Kulissen und Requisite in überschaubarer Zahl. Wir gingen deshalb kurze Zeit später wieder nach oben und frühstückten ausgiebig. Dann war ich zufällig gerade nicht da, als drei von uns – die beiden anderen Aushilfen waren dabei – abgeordert wurden. Ich blieb oben sitzen und betrachtete die Uhr, die wegen Batterieschwäche immer langsamer fortkroch. Zum Frühstück ging sie gerade einmal 10 Minuten nach, und ich vermutete, dass das einfach deshalb so war, weil das Frühstück ja auf der Bühne ausgerufen aber im Pausenraum beendet wurde, also 10 Minuten mehr Zeit zum Frühstücken blieb. Als es dann allerdings auf 12 zuging und die Uhr erst bei Viertel nach 11 stand, musste ich meine Theorie wieder verwerfen.
Gegen 1 rief ich einen Kumpel an, der den Dienstplan vor Augen hatte und mir sagte, dass wir nur bis 12 gebucht worden waren, da kam dann endlich ein weiterer Marschbefehl. Wir gingen nach unten, rollten 5 weiße Böden aus und nagelten und klebten die Kanten ab. Um 14 Uhr, als es nur noch darum ging, mit ein paar Bändern die Leinwand zu fixieren, fuhr ich nach Hause, total geschafft vom vielen Rumsitzen. Als ich mir das Geschriebene eben noch einmal durchlas, um eine abschließende, treffende Beschreibung des heutigen Arbeitstages abzugeben, fiel mir nicht s weiter ein, als der zweite Satz im zweiten Absatz. Er steht da mitten drin und eigentlich ist er nicht so wichtig, in seiner Struktur aber sehr ähnlich dem heutigen Schaffen: Hauptsatz ohne Prädikat und dann eine ewige Litanei, bis dann am Ende des langen Einschubs das für den Hauptsatz wichtige Verb kommt, aber eigentlich gar nichts passiert ist.
Shhhhh - 16. Jun, 22:02